web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Bad Ischl
im Salzkammergut, Juni 2024
Bad Ischl ist ein österreichischer Kurort östlich von
Salzburg. Er gilt als Tor zu den Alpenseen und Bergen im Salzkammergut.
In der im Biedermeierstil erbauten Kaiservilla können die Räume
besichtigt werden, in denen der Habsburger Kaiser Franz Joseph l. einst
die Sommermonate verbrachte. Auf dem Anwesen befindet sich auch das
Marmorschlössl, ein Teehaus, das der Kaiser für seine Gemahlin Kaiserin
Elisabeth (Sisi) errichten ließ.

Die Stadt Bad Ischl ist ein österreichischer Kurort am Zusammenfluss
von Traun und Ischl im Bezirk Gmunden, im südlichen Teil
Oberösterreichs. Bad Ischl ist seit jeher Zentrum des Inneren
Salzkammergutes und hat über 14.000 Einwohner.
Der Kaiserzug Bad Ischl fährt
zu den schönsten Plätzen und zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der
Bummelzug wird umweltfreundlich elektrisch betrieben.

1895 wurde das heutige Postamtsgebäude
im Stil der Neo-Renaissance errichtet. Es weist starke Ähnlichkeiten
mit k.k. Postämtern in vielen Städten der ehemaligen Monarchie auf.
Architekt von insgesamt 25 Postämtern war Friedrich Setz (1837 - 1907).
Die von ihm geplanten Postämter waren über die ganze Monarchie
verteilt, man findet sie heute noch neben Österreich in Polen, Ukraine,
Italien und Slowenien.
An der Fassade oben stellen 4 allegorische Figuren Eisenbahn,
Telegraphie, Handel und Schiffahrt dar. Offenbar gleichartige Figuren
zieren auch die vom selben Architekten geplanten Postämter in Bregenz
und Karlsbad, es handelt sich daher um „Massenware“, vermutlich aus
Terrakotta oder einer Gussmasse. Das Haus war modern und äußerst
leistungsfähig. Als 1897 ein verheerendes Hochwasser Ischl heimsuchte
und von der Außenwelt abschnitt, wurden innerhalb von 6 Tagen 15 750
Telegramme verschickt!

Die Trinkhalle ist eine unter
Denkmalschutz stehende ehemalige Kuranlage und dient als
Veranstaltungs- und Ausstellungsgebäude. Sie wurde ab 1829 von Franz
Lössl im klassizistischen Stil als Solebadeanstalt erbaut und 1831 in
Betrieb genommen. Der Neubau erhielt einen Umgang mit korinthischen
Säulen. In den Anfangsjahren trug die Anlage die Bezeichnungen Solbad
oder Wirerbad nach Franz Wirer, dem Wiener Leibarzt Kaiser Franz Joseph
I. Wirer begründete den Ruhm Ischls als Sommerfrische und Kurort. Neben
verschiedenen Bädern wurden Trinkkuren mit Molke verabreicht. Kurgäste
trafen sich im Konversationssalon.
Trinkhalle: 1829 bis 1831 von Franz Lössl erbaut, unter Denkmalschutz stehend

Die Trinkhalle wird von der Kurdirektion Bad Ischl genutzt; außerdem
ist der Bad Ischler Tourismusverband darin untergebracht. Das
Frauenmuseum Salzkammergut ist ein nachhaltiges Zukunftsprojekt der
Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024, dass aus der Ausstellung
„Mein Kleiderkasten - weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter"
entstehen soll.
Frauen und Kleiderkästen sind
dynamische Phänomene, die sich im Laufe der Jahre verändern, sowohl aus
der inneren als auch aus der äußeren Perspektive. Das Thema Kleidung
ist ein Leben lang aktuell und erlaubt ganz neue Einblicke in die
Altersforschung. Kein oberflächliches Thema, aber ein relativ wenig
erforschtes. Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl
Salzkammergut 2024 wird das ungewöhnliche „Paar": "Mode und Alter" vor
den Vorhang gebeten. Die Ausstellung geht auf die sieben
Schlüsselthemen der Studie „Modefreuden - Kleidung als Aussage über
Identität und Lebensgeschichte älterer Frauen zurück, die die
Sozialwissenschaftlerin Elizabeth Baum-Breuer von 2017 bis 2021
durchgeführt hat. Dafür interviewte sie Frauen aus unterschiedlichen
Lebenswelten und deren treffende Zitate führen durch die Ausstellung.
„Mein Kleiderkasten" wird nun in Bad Ischl zum vierten Mal gezeigt
(nach Bad Erlach, Wien und Grundlsee). Mit jeder Ausstellung des
Kleiderkastens gesellen sich mehr Frauen und zusätzliche Themen dazu.
Fast alle diese Frauen sind älter als 65, die älteste ist 103 während
vier jüngere die wichtige Brücke zu heranwachsenden Generationen
bilden. Hier in der Trinkhalle wird ein zusätzlicher Fokus auf Frauen
gesetzt, die in verschiedensten Bereichen Verbindung zum Salzkammergut
und Relevanz für Kultur haben. Insgesamt werden nun 50 Frauen
porträtiert.

Kleiderkästen werden sortiert, ausgeräumt, gezielt oder spontan
ergänzt. Lieblingsstücke gehegt und gepflegt, es kommen neue Stücke
dazu, manchmal werden diese geschenkt, geborgt, gekauft, getauscht oder
gefunden. Was das Äußere betrifft, so ist der Kleiderkasten vielleicht
ein bemalter Bauernkasten, ein Kasten mit Spiegeltür oder
Einbauschrank, möglich, dass er sich in einen begehbaren Schrank
verwandelt hat oder ist zu einem minimalen Stangensystem „avanciert".
Der Stellenwert an Mode im fortgeschrittenen Alter nimmt nicht ab und
wie sich herausstellt, begleiten „Modefreuden" viele Frauen ein Leben
lang.
Die Frauen der Ischler Ausstellung sind so sehr in Bewegung, dass sie
sich ein Stück weit von dem Kleiderkasten emanzipiert haben. Anhand von
Kleidungsstücken, Photos und Artefakten werden ihre Identitäten,
Lebenswege, und kulturelle Beiträge illustriert. Alle diese Frauen
haben oder hatten Berührungs-punkte mit dem Salzkammergut, viele der
Frauen sind bekannte Persönlichkeiten, etliche leben in der Region,
manche kommen als „Sommerfrischlerinnen", einige sind leider schon
verstorben.

Zweifelsohne sind in Kleidung und Mode die Mütter die wichtigsten
Vorbilder, einerseits durch Stil und Eleganz und andererseits durch die
Fähigkeit, auch mit bescheidenen Mitteln sich und die Kinder „tip-top"
zu kleiden. Viele Frauen erzählten von Kleidern aus alten Vorhängen und
Tischtüchern, sogar von Mänteln und Jacken aus Decken. In der negativen
Richtung waren Mütter überhaupt nicht an Mode interessiert, hatten,
laut ihren Töchtern, einen schlechten Geschmack oder waren übertrieben
eitel. Doch können auch Prominente, Freundinnen, Töchter und Enkelinnen
Vorbilder sein: Mode hat die schöne Eigenschaft, Generationen zu
verbinden und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.
Ausstellung: Mein Kleiderkasten - WEIBLICHE LEBENSFREUDE BIS INS HOHE ALTER

In altersspezifischen Lebensübergängen, wie beispielsweise dem Wechsel
in eine andere Wohnumgebung, kann das „sich Herrichten" eine Strategie
sein, die Herausforderung zu bewältigen. Auch wenn körperliche
Veränderungen manchmal beschwerlich und irritierend sein können, werden
ältere Frauen nicht „unsichtbar" - im Gegenteil. Immer mehr hat
Schönheit etwas mit dem inneren Ausdruck zu tun, mit der Einstellung zu
sich selbst, dem Umfeld und dem Leben.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus - Erbaut im 13. Jhdt., spätbarocke Erweiterung 1769-80, Turm mit achteckigem Spitzhelm gotisch.

Die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus wird überragt von einem 72 Meter
hohen Turm. Im Inneren fallen die Fresken, die Altarbilder, die
Mosaike, der geschnitzte Kreuzweg und vor allem die einzigartige
„Kaiser-Jubiläums-Orgel” ins Auge.
Der Außenbereich der Kirche zeigt die einfache Form des Klassizismus.
Die an der Außenwand befindliche Statue des Kirchenpatrons trägt die
Jahreszahl „1769“. Der riesige schwarze Doppeladler und die lateinische
Inschrift über dem Hauptportal (auf Deutsch übersetzt: „Aus Frömmigkeit
und Freigiebigkeit der Kaiserin“) geben einen Hinweis auf die
maßgebliche Geldgeberin, Kaiserin Maria Theresia.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus: 1344 urkundlich erwähnt, Turm von 1490,
Kirchenschiff 1771–1780, Fresken von Georg Mader (1877), Altarbilder
von Leopold Kupelwieser (1847–1851)
Die Größenausmaße der Stadtpfarrkirche Bad Ischl sind: Gesamtlänge 52
Meter, Breite 22 Meter, Kuppelhöhe 20 Meter, Fassungsvermögen für 3.000
Personen, Turmhöhe 72 Meter.

Die vier Gewölbegürtel, welche auf mächtigen Wandpfeilern ruhen, teilen
die Kirche in vier Joche. In das erste Joch beim Haupteingang ist die
Empore mit der Orgel eingestellt. Der Altarraum ist von einem Gurtbogen
vom Kirchenschiff getrennt und schließt halbkreisförmig. Das große
einschiffige und vierjochige Langhaus ist ringtonnengewölbt, der
eingezogene einjochige Chor besitzt einen 3/8-Schluss. Der gotische
Turm im südlichen Chorwinkel besitzt einen gedrehten achteckigen
Spitzhelm.
Die Bilder in der Kirche sind aufeinander abgestimmt und ergeben ein
theologisches Programm. Das 1. Joch (über der Musikempore) zeigt
Bildnisse der Propheten des Alten Bundes. Das 2. Joch hat als Thema
Glaube, das 3. Joch Hoffnung und das 4. Joch Liebe. Neben Motiven der
hl. Schrift und aus Heiligengeschichten finden sich auch sechs Szenen
aus dem Leben des hl. Nikolaus.

Am 18. Juli 1886 hatte die sog. Matthäus Mauracher’sche Orgelbauanstalt
in Salzburg und St. Florian, nämlich die Gebrüder Josef, Hans und
Matth. Mauracher (d. J.), den Auftrag für die Schaffung einer neuen
Orgel für die Pfarrkirche Ischl erhalten, die dann federführend von
Hans Mauracher (1847–1900) geschaffen, und Ende August 1887 fertig
aufgestellt war. Ein Jahr später, am 8. August 1888 wurde das
Instrument kollaudiert. Auf der teils mit Barkerhebeln, teils mit
pneumatischer Traktur versehenen Orgel hatte regelmäßig der österr.
Komponist Anton Bruckner gespielt, z. B. am 31. Juli 1890, bei der
Vermählung der mit ihm befreundeten Kaisertochter Marie Valerie mit
Franz Salvator.
Hans-Mauracher-Orgel (1887), mit 1910 erweitertem Prospekt

Die Kreuzwegstationen im Kircheninneren schuf der aus Meran stammende Bildhauer Sebastian Steiner im Jahr 1895.

Hinter dem Hochaltar sind drei
Glasmosaike, die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. Das Bild über
dem Hochaltar ist dem hl. Nikolaus gewidmet. Das Werk wurde 1850 von
Erzherzog Ludwig in Auftrag gegeben. Am 16. September 1878 wurde mit
der Errichtung des neuen Hochaltars nach einem Entwurf des Architekten
Michel begonnen. Der weiße Sandstein ist aus Ungarn, die Mensa aus
Marmor von der Ischler Burgruine Wildenstein. Für den kostbaren
Tabernakel soll Herzog Philipp la Notiere Ferrari maßgeblich gespendet
haben. Die beiden silbernen Tabernakeltüren wurden von einem Ischler
Goldschmied geliefert. Die weißen Füllungen am Hochaltar sind aus
ägyptischen Marmor und ein Geschenk des jüngsten Kaiserbruders
Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich. Das Material für die Ischler
Kirche und für die Wiener Votivkirche wurden aus dem gleichen großen
ägyptischen Block entnommen.


Kleine Schulchronik der Mittelschule 1 in der Kaiser-Franz-Josef-Straße
1899 "Knabenbürgerschule" in Ischl (3 Schuljahre)
1906 Grundsteinlegung des neuen Bürgerschulgebäudes
1908 Eröffnung der "Kaiser Franz Josef-Knabenbürgerschule Bad Ischl“
1927 Einführung der Hauptschule (4 Schuljahre). Umbenennung in "Knaben - Hauptschule Bad Ischl"
1977 Umbenennung der Schule in "Hauptschule 1 Bad Ischl" - Einführung der Koedukation
2009 Einführung der Mittelschule - Umbenennung in "Johann-Nestroy Schule"

Lehár Theater an der Kreuzung Kaiser Franz Josef Straße mit dem Kreuzplatz
Heute ist das Gebäude Kino und Spielstätte für unterschiedliche
künstlerische Darbietungen. Geplant wurde das Gebäude vom
Salinen-Architekten Franz Ferdinand Edangler im Jahr 1827, also in der
Frühzeit des Kurortes. Das Theater wurde im damals herrschenden
Empirestil geplant und erhielt 1882 noch ein separates Stiegenhaus für
die kaiserliche Familie. Das Haus wurde gerne die „kleine Burg“
genannt, traten doch Größen wie Johann Nestroy, Alexander Girardi oder
Katharina Schratt auf. 1940 wurde das Gebäude anlässlich des 70.
Geburtstages von Meister Lehár in Lehártheater umbenannt. Es diente
lange Zeit nur als Kino, wurde aber in den letzten Jahren wieder durch
viele Veranstaltungen neu belebt.
Anmerkung zur Inschrift über dem Eingang: Das Haus war nie k.u.k.
Hoftheater. Es gehörte nach dem Bau zunächst einer Aktiengesellschaft
von Ischler Bürgern, ab 1848 war es im Gemeindeeigentum. Es gab aber
eine Hofloge!

Helmut Berger Denkmal am Kreuzplatz, vor dem Lehártheater
Der Schauspieler Helmut Berger wurde am 29. Mai 1944 in Bad Ischl
geboren, hat aber nie hier gelebt. Weltruhm erlangte er mit dem von
Luchino Visconti zum Teil in Bad Ischl gedrehten Film "Ludwig II." mit
Romy Schneider im Jahre 1972. Anlässlich seines 75. Geburtstages am 29.
Mai 2019 wurde ihm von der Stadt Bad Ischl das Kulturehrenzeichen
verliehen. Dies überreichte ihm Bürgermeister Hannes Heide vor dem neu
errichteten Denkmal. Berger dankte mit den Worten: "Tausend Dank der
Stadt Bad Ischl. Ich bin sehr stolz, dass ich hier geboren bin."
Am 18. Mai 2023 verstarb der Schauspieler in Salzburg. Das Denkmal
zeigt die Büste Bergers als Ludwig II., gefertigt von Alexander Hanel.
Die Büste aus weißem Marmor befindet sich auf einem grauen
Granitsockel. Die Inschrift lautet: Helmut Berger geboren in Bad Ischl
Internationaler Schauspieler als Ludwig II.
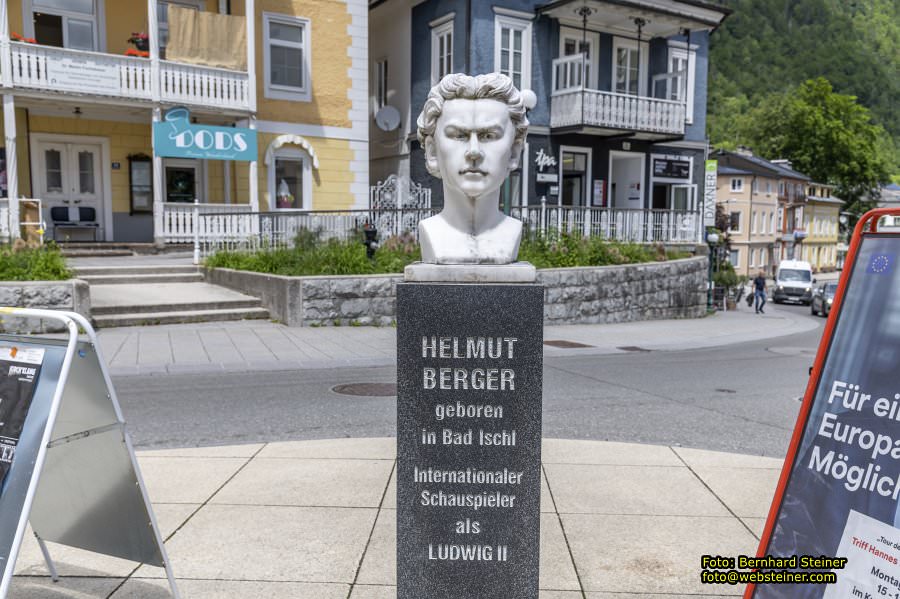
2001 brachte der LIONS Club Bad Ischl anlässlich seines 40. Geburtstags
unter dem Motto „Löwensafari“ 40 Löwen im Stadtgebiet zur Aufstellung.
Sponsoren aus der Wirtschaft hatten die Patenschaft für die einzelnen
Löwen übernommen, der Erlös der Kampagne kam Bedürftigen zugute.
Lebensgroße Figur eines (männlichen) Löwen aus Kunststoff
(Polyesterhülle, ausgeschäumt), in Farben bzw. mit Logo des jeweiligen
Sponsors versehen.

Uhr mit Glockenspiel am Kreuzplatz, bei Nr. 6 bei der Einmündung des Schutzenbichls
Eines der jüngsten Wahrzeichen des Stadtzentrums bildet diese Uhr, die
mit ihrem Glockenspiel Aufsehen erregt. Sie wurde 1989 von den
Kreuzplatz-Kaufleuten (federführend Uhrmacher Harald Baumann)
errichtet. Die Uhr in Form einer überdimensionalen Taschenuhr – jedoch
beidseits mit Zifferblättern – sitzt auf einer Stahlsäule, auf der
unterhalb der Uhr die 12 Messingglocken des Glockenspiels frei
aufgehängt sind. Das elektronisch gesteuerte Glockenspiel mit zwei
saisonal unterschiedlichen Programmen populärer und meist
Ischl-bezüglicher Melodien (einschließlich der Kaiserhymne) erklingt
4-mal am Tag (10, 11, 16 und 17 Uhr).

Wirer-Denkmal im Kurpark - Dr.
Franz de Paula von Wirer war der große Gönner und Förderer Ischls und
gilt auch als der Gründer des Kurbetriebes. Die feierliche Enthüllung
des Denkmals fand am 18. Juli 1839 im Beisein Wirers statt. Die
Wirerstraße und die Wirerquellgasse erinnern ebenfalls an ihn und seine
großen Verdienste für die Stadt.
Dem Wiener Arzt Dr. Franz Wirer (1771 - 1844) verdankt Ischl seinen bis
heute andauernden Ruf als Kurort von Weltrang und „Kaiserstadt“. Nicht
nur war er selbst unter Einsatz hoher Summen seines Vermögens dauernd
um die Vervollkommnung der Kuranlagen und Verschönerung der ganzen
Gegend bemüht, sondern durch seine Kontakte zu den höchsten Wiener
Kreisen sorgte er auch für prominente Kurgäste, die ihrerseits auch
wieder als Förderer Ischls in Erscheinung traten. Sein Wirken für Ischl
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. So verordnete er (zusammen
mit ihrem Leibarzt Malfatti) Erzherzogin Sophie (siehe Franz-Karl
Brunnen und Denkstein auf der Esplanade) jene fruchtbarkeitsfördernden
Kuren, die die Geburt des „Salzprinzen“ Franz-Josef bewirkte und damit
die glanzvollste Periode der Ischler Geschichte einleitete.
Das monumentale Denkmal mitten in einer von Wirer gestifteten
Gartenanlage spiegelt diese Bedeutung wider, es wurde, wie die
Inschrift meldet, von der Gemeinde Ischl ihrem Wohltäter 1838 gesetzt
und 1839 enthüllt. Bezahlt hat es allerdings Wirer selbst. Geschaffen
haben es die Steinmetzmeister Doppler aus Salzburg, die Skulpturen
stammen von Josef Kähsmann (vgl. Rudolfsdenkmal im Rudolfspark). Das
Denkmal steht in der Hauptachse der gegenüberliegenden damaligen
Salinenverwaltung, zum erst viel später erbauten „Kurhaus“ gibt es
dagegen keinen Bezug. Der hohe 3-stufige Unterbau und Sockel besteht
aus Untersberger Marmor, darin befinden sich in Nischen lebensgroße
Gusseisen-Reliefs: an der Vorderseite die „Wohltätigkeit“ („Caritas“),
dargestellt als Brunnennymphe mit Kind, man beachte den Storch als
Fruchtbarkeitssymbol im Hintergrund, an der Rückseite die „Hygiea“ mit
der Äskulapschlange. Auf dem Postament die ebenfalls gusseiserne
Kolossalbüste Wirers. Auch hier waren die Eisenteile ursprünglich
„bronziert“ (dunkles Olivgrün, vgl. Rudolfsdenkmal).

Im Zentrum der Stadt, umgeben vom malerischen Kurpark, finden das ganze
Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Hinter der historischen
Fassade vom Kongress & Theaterhaus verbergen sich moderne Tagungsräumlichkeiten für Kongresse und Events, sowie ein Kegelbahnstüberl.

1872 kaufte die Marktgemeinde das Grundstück ("Pfifferling Gründe").
Architekt Hyazinth Michel plante für Ischl einen „Cursaal“, der 1875
eröffnet werden konnte. Der Kuppeldachstuhl und die 4 Türme geben dem
Haus seine besondere Note. Es sollte der „Vereinigungspunkt für die aus
allen Ländern zusammenströmenden Fremden“ werden. Ein
gesellschaftlicher Höhepunkt war das Galadiner zum 60.
Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef mit König Eduard VII. von
England am 12. August 1908. Später wurde das Gebäude „Kurhaus" genannt
– dieses wurde 1957 renoviert um dort Operettenvorstellungen bieten zu
können. 1961 gab es die ersten noch konzertanten Operettenaufführungen.
Während des Umbaues 1965 brach ein verheerender Brand aus, der den
Dachstuhl und die meisten Innenräume zerstörte. Das Haus wurde aber
wieder aufgebaut und konnte bereits 1966 wieder eröffnet werden. Da die
Operettenwochen sehr erfolgreich waren, wurde das Haus 1997-99 nochmals
umgebaut und erhielt den heutigen Theatersaal mit Bühne. Der Name
änderte sich in Kongress- und Theaterhaus, die Operettenwochen wurden zum Lehár Festival.

Habsburgs langes Sterben
Das Bild von der k.u.k. Monarchie befindet sich seit ihrem Zerfall 1918
im Spannungsfeld kontroversieller Deutungen. Die Verklärung des
Habsburgerreichs spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Frage nach
seinem Vermächtnis. Kaum wo treten die auseinanderklaffenden
Sichtweisen deutlicher zutage als in Bad Ischl, der kaiserlichen
Sommerresidenz und dem Ort der Kriegserklärung an Serbien.
Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit herrschen feudale Regenten
Europas über eine Vielzahl unterschiedlicher Regionen und Kulturen. Mit
der Zeit verfolgen die meisten Großmächte das Ziel, ein einheitliches
Herrschaftsgefüge zu schaffen. Auch wenn diese Staatswesen mehrere
Nationen vereinen, ist meist eine Gruppierung dominant. In der
Habsburgermonarchie sieht das anders aus: Trotz vieler Bemühungen um
eine homogene „Monarchia Austriaca" kann keines der Völker des Reichs
eine klare zahlenmäßige Überlegenheit für sich beanspruchen. In den
vielen Hundert Jahren ihres Bestehens ist die Monarchie intensiv damit
beschäftigt, ein inneres Gleichgewicht zwischen den verschiedenen
Nationalitäten herzustellen und zu erhalten.
Mit dem Machtantritt Maria Theresias gerät die Habsburgermonarchie in
jahrelange kriegerische Auseinandersetzungen. Die Monarchie kämpft
darum, sich als unteilbarer Gesamtstaat zu behaupten. Beim Ansturm
Napoleons löst sich 1806 das „Heilige Römische Reich" auf, das den
Habsburgern als Machtbasis gedient hat und dessen Kaiser sie
Jahrhunderte hindurch gewesen sind. Das von Franz II. ausgerufene
Kaisertum Österreich sieht sich neuen Machtverhältnissen gegenüber und
ist auf die Unterstützung anderer Staaten angewiesen. Die schwelenden
politischen und sozialen Gegensätze führen in der Folge zur Revolution
von 1848 und drohen, das Band zwischen den einzelnen Teilen des
Imperiums zu zerreißen. Der sogenannte Ausgleich mit Ungarn 1867, der
zur Entstehung von zwei weitgehend selbstständigen Reichshälften führt,
ruft die anderen Nationalitäten auf den Plan. Sie fordern ähnliche
Rechte. Der immer schwerer lenkbare Doppelstaat Österreich-Ungarn wirkt
wie eine Ehe auf Zeit.

Trotz aller Konflikte und Bedrohungen besteht die Habsburgermonarchie
erstaunlich lange. Die Menschen fühlen sich mit der Herrscherfamilie
verbunden und teilen deren tiefe Frömmigkeit. Die Mehrheit ist außerdem
davon überzeugt, aus dem Zusammenleben im Vielvölkerstaat politisch,
wirtschaftlich und kulturell einen Nutzen ziehen zu können. Reform- und
Ausgleichsversuche sorgen ungeachtet vorhandener politischer
Unstimmigkeiten auch für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine gedeihliche
Zukunft wird von außen bestärkt: Die Großmächte sehen in der
Donaumonarchie einen wichtigen Stabilisator für den Frieden in Europa.
Speziell in Großbritannien und den USA gibt es bis 1917/18
Entscheidungsträger, die das Habsburgerreich aufrechterhalten wollen.
Die Zeit um 1900 ist eine Periode voller Widersprüche. Während Technik,
Kultur und Wissenschaft boomen, leben Hunderttausende Menschen in den
Elendsquartieren der Großstädte oder wandern nach Übersee aus. Neue
Emanzipationsbewegungen wecken unter zahlreichen, bislang schlechter
gestellten Menschen Optimismus. Die Spitzen der Gesellschaft und
insbesondere der Adel neigen hingegen dazu, den Verlust der bisherigen
Ordnung und der „alten Welt" zu betrauern. Auseinandersetzungen
zwischen Gegnern und Befürwortern der als rasant empfundenen
Veränderungen verschärfen sich. Presse und Parteien stehen vielfach für
Liberalisierung und Demokratisierung, tragen aber auch zur Vertiefung
der Gräben und zur Verstärkung von Feindbildern bei. Nationalismus und
Antisemitismus befinden sich im Aufwind. Die Loyalität ganzer
Bevölkerungsgruppen steht zur Debatte. Die Zahl der Spionageprozesse
steigt.
Hochrangige Militärs und Diplomaten des Habsburgerreichs sehen den
Großmachtstatus der k.u.k. Monarchie zunehmend gefährdet. In den Jahren
vor 1914 ist Kaiser Franz Joseph I. mit verschiedenen Krisen
konfrontiert. Immer wieder werden gewaltsame Lösungen diskutiert. Als
der Neffe des Monarchen, Franz Ferdinand, und dessen Frau Sophie am 28.
Juni 1914 in Sarajewo einem Attentat zum Opfer fallen, soll Serbien als
vermeintlicher Drahtzieher zur Verantwortung gezogen werden. Ende Juli
unterzeichnet der Kaiser die Kriegserklärung. Komplexe Bündnissysteme
zwischen den europäischen Staaten und seit Jahren schwelende
internationale Konflikte entfachen einen Flächenbrand. Als Feinde
stehen einander die Mittelmächte (die k.u.k. Monarchie, Deutschland,
Bulgarien sowie das Osmanische Reich) und die Entente (Großbritannien,
Frankreich und Russland) gegenüber. Die Katastrophe eines Weltkriegs
zeichnet sich ab.
Dem Kriegsbeginn folgen Übergriffe auf die Bevölkerung. Zahllose
Menschen werden des Verrats verdächtigt, verhaftet oder ermordet.
Allein in den ersten Monaten der Kampfhandlungen fallen rund 4.000
Zivilisten in Serbien der Kriegsführung der k.u.k. Armee zum Opfer. In
Galizien, an der Grenze zu Russland, bezichtigt das Militär ganze
Volksgruppen der Zusammenarbeit mit dem Feind. Tausende werden in das
Innere der Monarchie verbracht, wo riesige Lagerstädte entstehen. Viele
Internierte sterben in diesen Lagern an Krankheiten und infolge
miserabler Lebensbedingungen. Der greise Franz Joseph kann das beklagte
unverhältnismäßige Vorgehen der Heeresführung nicht unterbinden - zu
mächtig sind die Befürworter eines harten Kurses geworden.
Mit Voranschreiten des Kriegs gelangt die Wirtschaft der Monarchie an
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Eine Versorgungskatastrophe ist
die Folge. Die Menschen sind mangelhaft ernährt und oft auf öffentliche
Ausspeisungen angewiesen. In den Flüchtlings- und
Kriegsgefangenenlagern ist die Lage besonders schlimm: Es fehlt
allgemein an materiellen Ressourcen und vor allem zu Beginn des Kriegs
auch an Unterkünften. Rasch greifen Seuchen um sich, die in den
Barackenstädten Tausende das Leben kosten. Unzählige sind noch dazu
Schikanen ausgesetzt. Jüdische Flüchtlinge werden zur Zielscheibe einer
antisemitischen Hetze. Allmählich wird klar, dass die k.u.k. Monarchie
den Herausforderungen des Abnutzungskriegs nicht länger gewachsen ist
und einer Niederlage entgegensieht. Doch trotz einiger Hungerrevolten
und Meutereien glauben viele noch bis weit in das Jahr 1918 hinein an
ihr Weiterbestehen.
Nach 68 Jahren auf dem Thron der Habsburgermonarchie stirbt Kaiser
Franz Joseph I. am 21. November 1916. Seine Nachfolge tritt der
politisch unerfahrene Karl I. an. Ihm gelingt es nicht, notwendige
Reformen durchzuführen und das Vertrauen der Nationalitäten
zurückzugewinnen, um das Reich zu retten. Die k.u.k. Monarchie befindet
sich noch dazu in weitgehender Abhängigkeit von Deutschland. Als 1918
die letzten Offensiven gegen die feindlichen Armeen scheitern, muss
Österreich-Ungarn Waffenstillstandsverhandlungen führen. Die Völker
verlassen das sinkende Schiff und wenden sich mit Zutun der
Siegermächte von der Monarchie ab. Innerhalb weniger Wochen formieren
sie sich zu neuen, unabhängigen Staaten. Am 12. November wird in Wien
die Republik Deutschösterreich ausgerufen, vier Tage darauf folgt
Ungarn.
Vieles, was die k.u.k. Monarchie ausmachte und prägte, überdauert ihren
Zerfall. Rechtssysteme und Handelsnetze, Sozial- und
Verwaltungsstrukturen bleiben bestehen. Der Abschied vom Reich fällt
den Menschen nicht selten schwer. Als Ersatz für das untergegangene
Imperium schlagen manche eine Donauföderation vor. Vor allem in
Österreich aber wünscht die Mehrheit einen Anschluss an Deutschland.
Die Suche nach Sündenböcken für militärische Niederlagen,
wirtschaftliches Elend und politische Radikalisierung mündet außerdem
in einen gesteigerten Antisemitismus, der zur Zerstörung der jüdischen
Alltags- und Lebenswelt und schließlich zum Holocaust führt. Ab 1945
flüchten sich viele, nach Jahren des Grauens, in die Nostalgie.
Zahlreiche Filme und Bücher romantisieren die Kaiserzeit, die Welt von
gestern vor 1914. Bis heute hält diese Geschichtsverklärung an. Dennoch
rücken, wenn auch verspätet, die Schattenseiten des „alten Reichs"
vermehrt ins Zentrum vieler Betrachtungen.

Lehár-Denkmal im Kurpark
Der Operettenkomponist Franz Lehár (1870-1948) war nicht nur
wesentlicher Mitgestalter der „silbernen“ Operettenära, sondern auch
eine internationale Berühmtheit, die wesentlich zum Flair von Ischl in
der Zwischenkriegszeit beitrug. Schon 1912 hatte er in Ischl die später
nach ihm benannte Villa erworben, die er regelmäßig bewohnte und in der
er 1948 auch starb (heute Lehár-Museum). Das Denkmal wurde 1958
errichtet, die Büste musste 1980 aus urheberrechtlichen Gründen
ausgetauscht werden. Die jetzige Büste ist signiert: Franz Anton Coufal
1980, die ursprüngliche Büste stammte von Heinrich Zenz (Gmunden), das
Modell von Mario Petrucci. Polierter schwarzer Granitpfeiler, darauf
die Portraitbüste des Komponisten aus weißem Marmor.

Franz-Karl-Brunnen am Schröpferplatz zwischen Wirerstraße und „Hauptbrücke“ am Beginn der Pfarrgasse
Der Brunnen wurde 1877 als Gedenkbrunnen zum Jubiläum „Erzherzog
Franz-Karl 50 Jahre Kurgast in Ischl“ von Hans Greil, Direktor der
Hallstätter Fachschule, entworfen. Da Franz-Karl schon im
darauffolgenden Jahr starb (seine Gattin war schon 1872 gestorben)
wurde der Brunnen zum Denkmal für die Kaisereltern, die bekanntlich für
Ischl von größter Bedeutung waren, hatten doch die Kuren die Geburten
der so genannten „Salzprinzen“ Franz-Joseph (später Kaiser),
Ferdinand-Maximilian (später Kaiser von Mexiko, siehe Maxquelle in der
Maxquellgasse) und Karl-Ludwig zur Folge. 1879 begonnen, wurde der
Brunnen 1881 vollendet und enthüllt. Steinmetzarbeit vermutlich von der
Linzer Dombauhütte (das Steinmaterial war eine Spende von Bischof
Rudigier vom Linzer Dombau), die Bronzeteile wurden vom Wiener
Bildhauer Josef Lax modelliert und von der K.u.K. Kunst-Erzgießerei
Wien gegossen.
Neugotische Brunnenanlage aus Sandstein über dreieckigem Grundriss:
über einem Stufensockel mit Dreipassgrundriss ein Aufbau mit 3
sechseckigen Brunnenbecken (bemerkenswert die als zweischwänzige
Drachen gestalteten Wasserspeier), darüber ein hoher dreiseitiger
Fialturm mit Ziergiebeln und Türmchen, an ihm 2 Nischen
(Widmungsinschriften in Deutsch und Latein) und ein Bronzerelief mit
den Portraits von Franz-Karl und Sophie sowie den Wappenschildern von
Bayern, Ungarn und Österreich. An den Turmecken (auf Säulen aus
Traunsee-Marmor) 3 Bronzestatuen: Bergmann, Jäger, Fischer – die
„Urberufe“ des Salzkammerguts.

Lehár Villa - Die Villa des berühmten Operettenkomponisten
Die Villa des Operettenkomponisten Franz Lehár (* 30. April 1870; † 24.
Oktober 1948) am Lehár-Kai ist immer einen Besuch wert. Lehár kommt
erstmals 1901, damals Militärkapellmeister, nach Bad Ischl. Ein oder
zwei Jahre danach lernt er auch seine spätere Frau Sophie kennen, die
er aber erst 1924 heiratete. 1912 kauft Lehár die Villa an der Traun
von der Herzogin von Sabran . Die Sommer verbringt das Ehepaar in ihrem
geliebten Haus in Ischl. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten, wie
Künstler, Librettisten und Verleger gehen hier ein und aus. Lehár
fühlte sich in seiner Villa an der Traun und in Bad Ischl stets wohl
und meinte: "....in Ischl habe ich immer die besten Ideen..." 46 Jahre
bleibt er Ischl treu und hier in Ischl in seiner Villa komponierte und
vollendete er Meisterwerke, wie u.a. Paganini, Der Zarewitsch, Das Land
des Lächelns und Giuditta. Im Oktober 1948 erhielt er die
Ehrenbürgerschaft von Bad Ischl und starb kurz darauf. Sein Grab
befindet sich auf dem Friedhof in Bad Ischl. In seinem Testament
hinterließ Lehár die Villa der Stadt Bad Ischl mit der Auflage, dass
das Haus ausschließlich dem Zweck eines Franz Lehár Museums zu dienen
hat.

St. Johannes-Nepomuk auf der Hauptbrücke, Westseitig in Brückenmitte
Beim Hochwasser von 1897 wurde die „Hauptbrücke“ zerstört, wobei auch
eine um 1867 angebrachte hölzerne Statue des „Brückenheiligen“ St.
Johannes-Nepomuk zugrunde ging, die auf der Brücke stand. Für die neue,
1900 eröffnete Eisenbrücke spendete 1899 Amalie Drouot aus Linz, ein
langjähriger Sommergast und möglicherweise verwandt mit der Ischler
Familie Vockenhuber, eine Gußeisenstatue des Heiligen. Zuletzt
restauriert 2008 vom „Ischler Heimatverein“.
Polychrom gefaßte Gusseisenplastik des Hl. Johann-Nepomuk mit den
typischen Attributen Kreuz und Sternennimbus. Am Sockel die
Widmungsinschrift von Amalie Drouot sowie das Logo des Ischler
„Lions-Club“, der die Restaurierung 2008 gesponsert hat.

Statue der „Hoffnung“ - Am Beginn der Esplanade neben „Hahnbaum“ bzw. „Hauptbrücke“
Die Statue der „Hoffnung“ (es
gibt auch anderen Deutungen wie Hygiea und Fortuna, der Name „Hoffnung“
stammt von Wirer selbst) mit einem zeitlos gültigen Spruch am Postament
ließ Dr. Wirer 1841 am (damals) oberen Ende der Esplanade (in der
Gegend des heutigen „Café Zauner“) als Blickfang und Fluchtpunkt der
Allee aufstellen. 1909 wurde die Skulptur an ihren jetzigen Standort am
Beginn der Allee versetzt, wobei sie auch restauriert wurde.
Auf einem massiven Sockelquader (mit Inschrift von 1909) erhebt sich
ein hohes Piedestal aus (wahrscheinlich) Schwarzensee-Marmor mit der
nicht ganz lebensgroßen Zinkgussstatue einer Frau in antikischem
Gewand, in der Rechten hält sie einen Schreibgriffel, in der Linken
eine (Welt-) Kugel. Ursprünglich dürfte die Statue bronziert
(schwarzgrün) gewesen sein. Auf dem Piedestal der oft zitierte Spruch,
der wohl von Wirer selbst stammt, da er eine Vorliebe für derlei
lehrreiche Sprüche hatte und viele selbst verfasste. Er lautet: „Man
nennt als größtes Glück auf Erden Gesund zu sein. Ich sage nein! Ein
größeres ist Gesund zu werden. 1841“

Die Traun ist ein 153 km langer rechter Nebenfluss der Donau in
Oberösterreich (Österreich). Der mittlere Abfluss beträgt 135 m³/s, sie
entwässert den überwiegenden Teil des Salzkammerguts. Östlich der Traun
erstreckt sich das Traunviertel bis zur Enns.

Im Sommer 2001 fand die größte PR-Aktion für Lions in Österreich statt.
In Bad Ischl stehen 40 kunstvoll bemalte Löwen in der Stadt unter dem
Motto „In Bad Ischl sind die Löwen los!"

Nepomuk-Brunnen am Kreuzplatz
Dieser schöne Brunnen hatte einen hölzernen Vorläufer von 1830. Dieser
war nach seinem Stifter, dem damaligen oö. Landespräsidenten benannt:
„Ugarte-Brunnen“. Nachdem dessen Brunnbecken erneuerungsbedürftig
geworden war, erbaute der Ischler Maurermeister Karl Drexler 1846-47
den jetzt noch vorhandenen Brunnen. Für die Finanzierung wurden Teile
der damals ausbezahlten (!) Kriegskosten-Entschädigung für die
Kriegsjahre 1813-14 verwendet. 1874 kam es beim Brunnen zu Änderungen
am Standort und Unterbau.
Auf einem zweistufigen Podest steht das achteckige Becken aus grauem
Pötschenkalk, dessen Ecken durch Pilastervorlagen aus rosa Stein
akzentuiert sind. In Beckenmitte ein Postament mit Marktwappen und
Jahreszahl 1847, auf dem eine steinerne St.-Johannes-Nepomuk-Statue von
hoher Qualität thront. Diese barocke Steinplastik stand vorher in einer
Wandnische am Turm des 1842 durch das nachmalige „Hotel Elisabeth“
ersetzten alten Verwesamtes an der Traunbrücke. Im 2. Weltkrieg ging
der metallene Heiligenschein verloren, die beiden Wasserspeier wurden
bei der letzten Restaurierung 2000 neu angefertigt.

Die Kaiservilla, ehem. Villa Eltz
Erbaut wurde dieses geschichtsträchtige Gebäude von Dr. J.A.Eltz, einem
Wiener Notar, im Jahre 1834. Später kaufte der Ischler Salinenarzt Dr.
Mastalier diese Villa. Fürst Metternich verbrachte 1843 hier im Haus
seinen Urlaub. Erzherzogin Sophie kaufte die Villa vom Dr. Mastalier
und so wurde diese Villa auch zum Sommerurlaub der kaiserlichen Familie
genutzt, aber auch umgebaut und vergrößert. So entstanden in dieser
Zeit auch die klassizistischen Elemente und die heutige Form. 1854
schenkte Sophie die Villa ihrem Sohn Franz Joseph und Elisabeth zur
Hochzeit.
So wurde Ischl zum geliebten Sommersitz der kaiserlichen Familie, Franz
Joseph hatte hier sein Jagdrevier, die Kaiserin liebte ihre
Spaziergänge und die Berge. Viele Jahre hindurch war Ischl "Zentrum der
Welt" während der Sommermonate und hier wurde Geschichte geschrieben.
Am 28. Juli 1914 unterzeichnete Kaiser Franz Joseph die Kriegserklärung
an Serbien und das Manifest "An meine Völker" hier in Ischl. Am 30.
Juli reiste Franz Joseph von Ischl ab und kam nicht wieder. Erzherzogin
Marie Valerie erhielt den Besitz und heute lebt die Familie
Habsburg-Lothringen in der Kaiser-Villa, die öffentlich zu besichtigen
ist.

Skulpturengruppe „Halali“ („Der Loser“) im Kaiserpark gegenüber der Kaiservilla
Die volkstümliche Bezeichnung ist keineswegs englisch, sondern bedeutet
in der Salzkammergut-Mundart so viel wie‚ "Der Lauschende, der
(Hin-)Horchende". Die Plastik soll um 1880 entstanden sein und war ein
Geschenk von Königin Victoria von England an die hundeliebende Kaiserin
Elisabeth. 1888 stand sie schon am jetzigen Platz. Die auf einem
Steinsockel montierte Figurengruppe eines Hundeführers mit zwei
Jagdhunden, aus patiniertem Stahlguss gefertigt und mit Val d’Osne
(Gießerei, nahe Paris) und A[lfred] Jacquemart (der Künstler, ein
berühmter französischer Bildhauer) bezeichnet, steht wie der Brunnen in
der Hauptachse der Kaiservilla. An einem der Hunde an der Flanke ein
Kreuz, angeblich, weil dieser „Modell stehend“ während der Arbeit an
der Gruppe tot umgefallen ist. Von dieser Gruppe existieren mehrere
Abgüsse: in Sydney, in Los Angeles (ehem. in Frankreich) und in
Karlsruhe (verm. zerstört).

Bereits der Zutritt in den Kaiserpark ist kostenpflichtig, den Preis
für die Kaiservilla empfinde ich als übertrieben teuer. Ein
Besuch ist hierbei ausschließlich mit einer Führung möglich und es gilt
ein Fotografierverbot. Da hier gleich drei Gegenargumente zu meiner
persönlichen Einstellung schlagend werden, verzichte ich aus
Überzeugung auf einen Visitation.

CHRONOLOGIE der wichtigsten historischen Ereignisse 1830-1916
1830 18-8 Geburt Franz Joseph's, Sohn des Erzherzog Franz Karl u der Erzherzogin Sophie, Prinzessin v. Bayern.
1835 Tod Kaiser Franz I. von Österreich, sein Sohn wird als Ferdinand I. nachfolgender österreichischer Kaiser.
1848 revolutionäre Bewegung in
Wien, die durch Fürst Windisch-Graetz niedergeschlagen wird. Abdankung
Kaiser Ferdinand I., sowie seines Bruders Franz Carl auf den
österreichischen Kaiserthron.
1848 2-12 Franz Joseph tritt als 18 jähriger die Regierung an.
1849 Revolution in Ungarn (Kosuth): Österreich schlägt mit russischer Hilfe den Aufstand nieder.
1849 Schlachten von Custozza u. Novara: Österreichische Siege gegen Italien (König Albert von Sardinien)
1854 24-4 Hochzeit Kaiser Franz Joseph mit Elisabeth, Herzogin in Bayern.
1854-56 Krimkrieg: Westmächte England, Frankreich und Österreich im Kampf gegen Russland.
1856 Der Friede von Paris beendet den Krimkrieg, Russland verliert u.a. die Schutzherrschaft über die Donaufürstentümer.
1859 Italienischer
Einigungskrieg Sardinien u Frankreich besiegen Österreich in den
Schlachten bei Magenta u. Solferino, Friede von Zürich: Osterreich
tritt die Lombardei an Kaiser Napoleon III v. Frankreich ab, der dieses
Land an Sardinien abgibt.
1860 Volksaufstände in Toscana, Modena, Parma und Romagna führen zur Vereinigung mit Sardinien.
1861 Viktor Emanuel II. v. Savoyen wird König von Italien.
1863 Fürstentag zu Frankfurt:
Kaiser Franz Joseph versucht vergeblich eine Einigung Deutschlands im
großdeutschen Sinn, die von Österreich vorgeschlagene Reform der
deutschen Bundesverfassung wird von Preußen abgelehnt.
1864 Gemeinsamer preußisch-Österreichischer Feldzug gegen Dänemark, Niederlage der Dänen.
1864 30-10 Friede zu Wien: Dänemark tritt die Herzogtümer Lauenburg, Schleswig u. Holstein an Preußen und Österreich ab.
1865 14-8 Gasteiner Vertrag: Österreich übernimmt die Verwaltung in Holstein, Preußen in Schleswig, Lauenburg fällt an Preußen.
1866 15-6 Krieg Preußen gegen Österreich, Hannover und die deutschen Südstaaten.
1866 3-7 Österreichische Niederlage bei Königgraetz.
1866 26-7 Waffenstillstand von Nikolsburg: Preußen verzichtet auf eine Vernichtung Österreichs.
1866 23-8 Friede zu Prag:
Auflösung des Deutschen Bundes, Österreich scheidet somit aus dem Reich
aus und anerkennt die Neugestaltung Deutschlands.
1866 3-10 Friede zu Wien: zwischen Österreich u. Italien: Österreich verliert Venetien.
1867 Gründung des Norddeutschen Bundes.
1867 19-6 Erschießung Kaiser Maximilian von Mexico, (jüngerer Bruder Kaiser Franz Joseph) zu Queretaro.
1867 21-12 Ausgleich mit
Ungarn: Ungarn wird mit seinen Kronländern als besondere Reichshälfte
anerkannt (Cis- u. Transleithanien) in Personalunion mit Österreich
wobei es einen eigenen Reichstag und ein eigenes Ministerium erhielt.
Gemeinsam bleiben Heer, Finanzen und Außenpolitik.
1870 19-7 Frankreich erklärt
Preußen den Krieg, die Süddeutschen Staaten erfüllen ihre
Bündnisverpflichtung gegen Preußen, Österreich bleibt neutral (wegen
der russischen Gefahr)
1870 1/2-9 französische Niederlage bei Sedan. Gefangennahme Kaiser Napoleon III.
1871 18-1 Deutsche
Kaiserproklamation: Wilhelm I. wird erster deutscher Kaiser. Die
deutsche Einheit wird somit im kleindeutschen Sinne zum Abschluß
gebracht.
1871 26-2 Friedenspräliminarien zu Versailles: Frankreich tritt das Elsaß u. Teile von Lothringen mit Metz an Deutschland ab.
1871 10-5 Friede zu Frankfurt: Bestätigung der Abmachungen von Versailles.
1873 9-1 Napoleon. stirbt in Chislehurst bei London.
1873 22-10 Dreikaiser Abkommen
(Deutschland, Österreich, Russland) Freundschaftsvertrag Kaiser Wilhelm
I., Kaiser Franz Joseph, Zar Alexander II. zur Aufrechterhaltung des
Friedens.
1878 Berliner Kongress:
Abwendung, des drohenden Krieges zwischen England u Russland,
Österreich nimmt Bosnien u. die Herzegowina vorläufig in Verwaltung.
1879 7-10 Schließung eines Zweibundes: Österreich u das Deutsche Reich verbunden sich gegen einen russischen Angriff.
1882 20-5 Italien schließt sich dem Zweibund von 1879 an, ab nun Dreibund.
1888 9-3 Tod Kaiser Wilhelm I., Nachfolger Kaiser Friedrich Ⅲ. für 99 Tage.
1888 15-6 Wilhelm II. wird als 29 jähriger deutscher Kaiser.
1889 30-1 Selbstmord Kronprinz Rudolf von Österreich (einziger Sohn Kaiser Franz Joseph) in Mayerling.
1898 10-9 Ermordung Kaiserin Elisabeth von Österreich in Genf.
1908 Begegnung König Eduard
VII. von England mit Kaiser Franz Joseph in Ischl. Ein Versuch
Österreich von Deutschland zu trennen, mißlingt.
1908 5-10 Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich.
1912 Erster Balkankrieg Bulgarien, Serbien, Montenegro u. Griechenland gegen Türkei. Niederlage der Friedenskonferenz London.
1913 7/11-7 Zweiter Balkankrieg auf Grund von Unstimmigkeiten über die Verteilung der Beute. Serbien,
Griechenland u. Rumänien gegen Bulgarien. Frieden zu Bukarest und Konstantinopel.
1914 28-6 Ermordung des
österreichischen Thronfolgerpaares Franz Ferdinand (Neffe von Kaiser
Franz Joseph) in Sarajewo durch serbische Nationalisten.
1914 28-7 Osterreich-Ungarn erklärt den Krieg an Serbien. Unterzeichnung des Völkermanifestes durch
Kaiser Franz Joseph in Ischl. Ausbruch des 1. Weltkrieges.
1916 21-11 Kaiser Franz Joseph stirbt zu Schönbrunn im 87. Lebensjahre.

Springbrunnen im Kaiserpark direkt vor der „Kaiservilla“
Der den villennahen Parkteil bestimmende Springbrunnen ergänzte erst
relativ spät, nämlich 1881, das Park-Ensemble und wurde vom bekannten
Bildhauer der Ringstraßenära Viktor Tilgner geschaffen. Vorher befand
sich an seiner Stelle ein ovales Blumenbeet, dann ein großer
Kandelaber. Das flache, annähernd ovale Becken liegt in der Hauptachse
der „Kaiservilla“ und wird durch eine größere und zwei kleinere
Marmor-Gruppen von Putti mit Fischen, zwischen denen Wasserstrahlen
emporschießen, belebt.

Die berühmten blauen Kugeln (Teil der „Zodiac Heads“ Serie) von
Ai Weiwei, die im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 im
Kaiserpark der Kaiservilla in Bad Ischl installiert wurden. Die
knallblauen Tierkreis-Köpfe („Zodiac Heads“) entstanden ursprünglich
als Nachbildungen von kaiserlichen chinesischen Tierkreiszeichen –
bekannt sind sie auch aus Pekings Kaiserpalast. Von 13. Juni bis 27.
Oktober 2024 waren sie als Teil der Ausstellung „Transcending Borders –
Dialog mit der Hallstattkultur“ im öffentlichen Park vor der
Kaiservilla zu sehen. Mein Besuch war eine Woche vor Beginn.

Themengarten „... und doch so fern" - Die Sehnsucht der Möwe
Der Themengarten „... und doch so fern" ist inspiriert von den
zahlreichen Reisen von Kaiserin Elisabeth. Angetrieben von einer
unbestimmten Sehnsucht war Sisi oft monatelang unterwegs, bereiste ganz
Europa und Nordafrika. Ihre erste längere Reise führte sie aus
Gesundheitsgründen im Winter 1860 nach Madeira. Viel Zeit verbrachte
Sisi auch auf Schloss Gödöllö und die griechische Insel Korfu wurde zu
einem ihrer Lieblingsorte. Während ihrer Reisen versuchte Sisi,
sich ihre Einsamkeit mit Gedichten von der Seele zu schreiben: „Eine
Möwe bin ich von keinem Land, Meine Heimat nenne ich keinen Strand,
Mich bindet nicht Ort und nicht Stelle; Ich fliege von Welle zu Welle."
Die Inhalte des Themengartens: Drei bepflanzte Inseln mit Bezug zu
Madeira, Korfu und Gödöllő, das Plätschern des Wassers, die Möwen als
Symbol für die Sehnsucht nach der Ferne, und eine Collage aus Bildern
und Texten von Kaiserin Elisabeth. Im Sisipark findet sich mit dem
Themengarten „So nah ..." eine Entsprechung, die über Sisis Liebe zur
heimischen Bergwelt und ihre Leidenschaft, das Reiten erzählt.

Museum Marmorschlössl im Kaiserpark gelegen, etwa 10 Gehminuten von der Kaiservilla entfernt
Zum Haus: Kaiserin Elisabeth ließ die Villa 1856 an Stelle der
„Jausenstation in der Schmalnau“ im Tudor-Stil erbauen. Ein Hauch von
„Neuschwanstein“ weht durch das Haus. Dieses ist aus rötlichem Marmor
erbaut und drohte nach dem 2. Weltkrieg zu verfallen. Das Land
Oberösterreich sanierte das Schlösschen und brachte darin das
Photomuseum unter.

Wenige Tage nach meinem Besuch fand die 'Ausstellung Ai Weiwei' statt. Bei meinem Ausflug war das Gebäude allerdings gesperrt.

Erzherzogin Sophie erwarb die Biedermeiervilla vom Notar Eltz als
Hochzeitsgeschenk für Franz Josef und Elisabeth. Der Umbau im
neoklassizistischen Stil erfolgte durch Antonio Legrenzi. Zwei
Seitenflügel wurden angebaut, sodass der Grundriss nun ein großes „E“
darstellt. Den Park gestaltete Hofgärtner Franz Rauch. Kaiser Franz
Josef bewohnte die Villa fast jeden Sommer bis zum Jahre 1914. In
diesem Jahr hielt er sich das letzte Mal in Ischl auf. Die Einrichtung
der kaiserlichen Sommervilla ist im Original erhalten geblieben, die
Räumlichkeiten können besichtigt werden.

Verlobungspavillon - Die Gloriette
..Auf halber Höhe des rechten Parkhanges verbirgt sich nach einem
leichten Aufstieg die Gloriette. Die in Achteckform erbaute zarte,
reichlich verzierte Eisenkonstruktion, auch türkischer Gartenpavillon
genannt, war der Verlobungspavillon der jüngsten Tochter des
Kaiserpaares. Es war Franz Rauch, der erste kaiserlichen Hofgärtner,
der für Folgendes verantwortlich war: Die Vollendung der Villa, die
Erbauung von Verwaltungsgebäuden, Park und Gartenanlagen, Pavillons im
Park, Kaiserin Elisabeths Cottage und die Wasserleitung, die vom
Gebirge jenseits des Jainzenberges in die Villa verlegt wurde.
Sämtliche Betriebsgebäude und auch die Pavillons im Park waren um ca.
1859 in vollem Einsatz.
Der Verlobungspavillon, eine leichte Eisenkonstruktion im maurischen
Stil, erinnert an die Hochzeit der jüngsten Kaisertochter Marie Valerie
mit, Erzherzog Franz Salvator im Jahre 1890, die in Ischl gefeiert
wurde. Die gemeinsamen Wanderungen mit ihrer Mutter Kaiserin Elisabeth,
ließen in Marie Valerie eine tiefe Zuneigung zu Ischl, zur Kajservilla
und zum Kaiserpark entstehen. Ihre prächtige Hochzeit fand in der
Ischler Pfarrkirche statt und schließlich war sie es, die das Ischler
Erbe antrat und an ihre Nachkommen weitergeben konnte. Der Park und das
Marmorschlössl waren ein Zufluchtsort für die Kaiserin, die lange
Spaziergänge unternahm, um von den Pavillons aus den Rundblick auf die
Berge und den Dachsteingletscher zu genießen.

Evangelische Friedenskirche in der Bahnhofstraße 5
Im Jahr 1875 wurde der ehemalige k.k. Kornstadel angekauft und im Laufe
der folgenden sechs Jahre zu einem Schul- und Pfarrhaus sowie zur
Kirche (im neugotischen Stil) umgebaut. Die Weihe zur evang.
Pfarrkirche erfolgte am 1. Juli 1881 durch Superintendent Jakob Ernst
Koch - fast genau 100 Jahre nach dem Toleranzpatent von Josef II.

Aus der Geschichte der evangelischen Pfarre (AB) Bad Ischl
Schon bald nach Beginn der Reformation finden wir Luthers Lehre auch im
Salzkammergut. 1533 erhält Goisern in Christian Dayer seinen ersten
evangelischen Pfarrer. Ischler Bürgerinventare weisen den Besitz
evangelischer Bücher nach und 1583 ist mit Martin Waldner ein
lutherischer Pastor bezeugt. Im Ischler Marktrichter Joachim Schwarzl
(um 1600) gewinnen die Evangelischen des Ischllandes eine markante
Führergestalt.
1602 kommt es zur sogenannten "Ischler Rebellion" an der sich die
gesamte Bevölkerung des Ischllandes beteiligt, um einer zwangsweisen
Rekatholisierung entgegen zu steuern. Diese wird aber durch Truppen des
Erzbischofs Wolf Dietrich niedergeschlagen und die Gegenreformation
gewinnt im ganzen Lande an Boden. In der Stille der Berghöfe und bei
den Salzarbeitern werden aber evangelische Bücher weiterhin in geheimen
Zusammenkünften gelesen.
1731 melden sich 131 Lutheraner aus der Herrschaft Wildenstein.
Zahlreiche Familien müssen im 18. Jahrhundert um ihres Glaubens willen
auswandern. Diese Transmigranten werden nach Siebenbürgen verschafft
und dort sesshaft.
1781 erläßt Kaiser Josef II. das Toleranzpatent und ermöglicht neues
evangelisches Leben. In Ischl bekennen sich 41 Personen zur
Augsburgischen Confession und werden in die evangelische Pfarre Goisern
eingemeindet.
1859 kommt die Großherzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin mit
Großherzog Friedrich Franz II. zu einem Kuraufenthalt nach Ischl. Durch
sie wird der Großherzog in den folgenden Jahren zum großen Förderer der
kleinen evangelischen Gemeinde.
1861 wird in Reiterndorf Nr. 77 ein Schulhaus angekauft. Es dient
zugleich als Bethaus, Lehrerwohnung und Unterkunft für die
"Saisonprediger" aus Mecklenburg.
1875 kann der "Salinenkornstadel" um 15.000 Gulden erworben werden.
Durch namhafte Spenden vieler privater Gönner, sowie der kaiserlichen
Majestäten aus Österreich und Deutschland erfolgt der Umbau zu Kirche,
Schule und Pfarrhaus.
1881 Kirchweihfest und Glockenweihe durch Superintendent Jakob Franz
Koch III. aus Wallern. Die evangelische Pfarrgemeinde ist inzwischen
auf 300 Personen angewachsen.
Am 5. Oktober 1902 wird Ischl zur selbstständigen Pfarrgemeinde
erhoben. Zum Gemeindegebiet gehören auch die Evangelischen der
Ortsgemeinden Strobl, St. Wolfgang und St. Gilgen.
1938 Auflösung der evangelischen Privatschule durch die politische Behörde.
1945 Bedingt durch das Kriegsende ist das Salzkammergut mit
Flüchtlingen restlos überfüllt. Dadurch ein starkes Anwachsen der
evangelischen Gemeinde Bad Ischl.
1959 Weihe des Friedenskirchleins in St. Wolfgang.
1979 Erstmals wird eine zweite Pfarrstelle in Bad Ischl genehmigt und durch Pfarrerin Heidi Lieberich besetzt.
Im Jubiläumsjahr 2002 zählt die evangelische Pfarrgemeinde Bad Ischl
1354 Seelen und wird von den beiden Pfarrern Erhard Lieberknecht und
Dankfried Kirsch betreut.

SALZLICHTKREUZ - Botschaft von Jesus
Joh.8,12: „Ich bin das Licht der Welt".
Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis (in der
Gottesferne) umherirren, sondern das Licht des Lebens haben (schon
jetzt in dieser Welt und im besonderen dann in aller Ewigkeit in der
Nähe der Gottesliebe). Und weiter spricht Jesus zu seinen Jüngern und
Nachfolgern ab Matth. 5,13: „Ihr seid das Salz der Erde --, ihr seid
das Licht der Welt --, und später „Stellt euer Licht nicht unter den
Eimer, sondern lasst es leuchten"-- und weiter: „Habt immer Salz
dabei!" Heute wissen wir: Ohne Sonnenlicht kann die Natur nicht sein.
Jesus sagt: Ohne meinem Licht kann der Mensch nicht leben! Schon gar
nicht in alle Ewigkeit. Und was hat es mit dem Salz auf sich? Heute
wissen wir: Salz ist die gute Würze unserer Speisen; Salz konserviert
und macht Speisen lange lagerbar; Salz ist lebensnotwendig für Mensch
und Tier. Jesus wusste das schon vor rund 2000 Jahren. Ihr, meine
Freunde, seid die Würze der Menschheit, ihr seid die Erhalter meines
Wortes, ihr seid unentbehrlich für alle Menschen!

EVANGELISCHE FRIEDENSKIRCHE
Ehem. k.k. Kornmagazin umgebaut z. Kirche u. Schule, Kirchw. 17.7.1881
Unterstützung durch Friedr. Franz Ⅱ. Großherzg. v. Mecklenburg


Die ÖBB 698.01 ist eine 1941
von Henschel hergestellte ehemalige deutsche Bn2t-Heeresfeldbahnlok,
die als Musterlok für die Heeresfeldbahn gebaut wurde. Der 160 PS
starke Zweikuppler basierte technisch auf der „Helfmann“-Type von
Henschel und hatte Elemente anderer HF-Lokomotiven verbaut, blieb
jedoch genau so wie die im selben Jahr gebaute ÖBB 898.01 ein
Einzelstück. Sie wurde aufgrund ihrer niedrigen Höchstgeschwindigkeit
von lediglich 25 km/h vor allem in St. Pölten Alpenbahnhof im
Verschubdienst eingesetzt. Seit 2017 steht sie vor dem Bahnhof Bad
Ischl unter Dach, zusammen mit einem originalen zweiachsigen
Personenwagen der SKGLB von 1893. Laut einer Plakette auf dem Zylinder
wurde die heute im Besitz des Technischen Museum Wien stehende Maschine
im Jahr 1991 restauriert.

„Atemluft“ von Xenia Hausner am Bahnhofplatz
Die Skulptur der Künstlerin Xenia Hausner wurde im Rahmen der
„Kulturhauptstadt 2024“ Anfang Mai 2024 auf dem Bahnhofplatz
aufgestellt. Über einer Frauenbüste aus silbrig glänzendem Material
(Aluminium poliert) liegt wie eine schwere Last eine „Flasche mit
Atemluft“. Hausner will mit diesem Kunstwerk die gesellschaftlichen und
existentiellen Probleme unserer Zeit aufzeigen. Sie weist eindringlich
auf unsere schwindenden Ressourcen hin. Xenia Hausner, Tochter des
österreichischen Malers Rudolf Hausner, wurde 1951 in Wien geboren, ist
international anerkannte Künstlerin und als Malerin und Bühnenbildnerin
bekannt. Ihre Werke hängen in den führenden Museen der Welt. Sie ist
mit dem Salzkammergut eng verbunden. Mit „Atemluft“ hat sie erstmals
eine Skulptur geschaffen.

Der Bahnhof wurde anlässlich
der Errichtung der Kronprinz Rudolf Bahn 1877 eröffnet (Attnang
Puchheim nach Stainach-Irdning). Er ist im Stile des Historismus
errichtet und hatte wegen der Sommeraufenthalte Kaiser Franz Josefs in
Ischl besondere Bedeutung. Ab 1894 verkehrte auch die
Salzkammergutlokalbahn von hier nach Salzburg. Es war eine
Schmalspurbahn, die 1957 eingestellt wurde. Heute fahren von diesem
Bahnhof auch viele Busse in verschiedenste Richtungen und verbinden
Ischl mit dem gesamten Salzkammergut.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag, kann sich gerne dieses Video antun: