web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Burgmuseum Archeo Norico
Deutschlandsberg, August 2024
Archäologie, Kelten, Mittelalter und vieles mehr -
erlebbar im Burgmuseum Archeo Norico im Herzen der Burg
Deutschlandsberg. Acht spannende Ausstellungen sowie die romanische
Kernburg mit Zisterne und Rundweg laden zum Verweilen ein. Zum
krönenden Abschluss bietet der Burgturm einen einzigartigem
Panoramablick über das Schilcherland!
Auf einem Ausläufer der Koralpe erhebt sich auf einem felsigen
Geländesporn die Burg Deutschlandsberg. Nachweise für eine frühe
Besiedlung des späteren Burgareals liegen mit archäologischen Funden
aus der Kupferzeit und der späten Steinzeit vor. Auch aus der
keltischen Latèneperiode und der römischen Kaiserzeit stammen Funde,
die belegen, dass der Berg seit langem besiedelt wurde. Im Mittelalter
bildete die Burg den Verwaltungsmittelpunkt für große Landbesitzungen
in der Region, die dem Erzbistum Salzburg unterstanden.
Die erste urkundliche Nennung eines Friedrich von Lonsperg als Burggraf
wird in das Jahr 1153 datiert. Möglicherweise gehört in diese Zeit
bereits der erste steinerne Turm, der am höchsten Punkt des Areals
erbaut wurde. Während er auf drei Seiten durch die steilen Abhänge zur
Laßnitz gut geschützt war, befand sich an seiner Ostseite ein
natürlicher Graben. Wenig später wurde eine erste Ringmauer erbaut, die
den Turm umgab und wohl auch bereits einen ersten Palas (einen
repräsentativen Saalbau) einschloss. Groß angelegte Um- und Ausbauten
stammen aus der Gotik, wie beispielsweise der um das Jahr 1300 erbaute
mächtige Wohntum mit seinen Nebengebäuden. Der Renaissance, also dem
ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhundert, gehören der heutige
Hoteltrakt (Kuenburgtrakt) sowie der sog. Rittersaal (das heutige
Burgrestaurant) an. Der alte romanische Hofbereich hingegen wurde in
der Neuzeit nicht mehr genutzt. Erst durch die archäologischen
Grabungen sowie die darauffolgenden Rekonstruktionsarbeiten und
Erschließungsmaßnahmen der vergangenen Jahre konnte dieser Bereich
wieder genutzt und in die Kernburg integriert werden.

Das Burgmuseum ArcheoNorico beherbergt eine bedeutende Sammlung
archäologischer Funde aus der Steiermark und Kärnten. Fundobjekte,
anhand derer die über 6500-jährige Besiedelungsgeschichte der Region
fassbar und erlebbar wird, bilden den Hauptbestandteil der
Schausammlung, die sich in den renovierten Räumlichkeiten der Kernburg
befindet. Funde aus der keltischen Latèneperiode, aber auch
kaiserzeitlicher Schmuck sowie die Funde von neuzeitlichem Waldglas
können dort besichtigt werden. Kern der Sammlung bildet die
Gebrüder-Steffan-Stiftung für Vor- und Frühgeschichte, die mit dem Ziel
eingerichtet wurde, bedeuten de archäologische Funde der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Erzbischöflich-salzburgische Burg
Der älteste Teil der Burg war der siebeneckige Turm am höchsten Punkt
des Felsens. Unmittelbar östlich davon lag ein erster Graben, der eine
wir- kungsvolle Befestigung darstellte. Später wurden eine Kapelle und
ein erster Saalbau errichtet und ein neuer Burggraben (der sogenannte
Halsgraben, der auch heute noch besteht) angelegt. Im 14. Jahrhundert
fanden größere Baumaßnahmen statt, bei denen der große gotische Tor-
bzw. Wohnturm, der Palas, ein sog. Gadenbau sowie Wirtschaftgebäude
erbaut wurden. Östlich der Kernburg wurde ab dem späten 16. Jh. der
sog. Kuenburgtrakt, durch den eine Verbindung mit einem älteren
Rundturm geschaffen wurde, angebaut.

Burg Landsberg
Die erste urkundliche Nennung der Burg Landsberg stammt aus dem Jahr
1153, als ein Friedrich von Lonsperg als Ministeriale (örtlicher
Verwalter) der Salzburger Erzbischöfe genannt wird. Die Burg bildete
das Zentrum der weststeirischen Besitzungen des Erzbistums.
Archäologische Reste bezeugen aber eine viel ältere Nutzung des Areals.
So wurden Funde aus der Jungsteinzeit (5. Jahrtausend v. Chr.), der
Kupferzeit, aber auch der späten Eisenzeit, der Zeit der Kelten,
gemacht. Aus der römischen Kaiserzeit stammen Funde, die darauf
hinweisen, dass sich auch in dieser Epoche eine Siedlung an dieser gut
zu verteidigenden Stelle befand.
Eine Burg war im Mittelalter ein befestigter Ort. Mit „befestigt" ist
gemeint, dass man diesen Platz im Krieg sehr gut ver- teidigen konnte.
Dafür sorgten unter anderem auch die hohen Mauern und Gräben die jede
Festung umgaben. Burgen waren ursprünglich aus Holz gebaut. Viele
liegen an höher gelegenen Stellen, da man so einen besseren Überblick
über das Land hatte und Feinde schon von Weitem sah. Auch die Burg
Deutschlandsberg steht wie ihr seht auf einem Hügel. In der Burg lebte
der Burgherr und seine Familie. Besonders bequem war dieses Leben
allerdings nicht, denn es war kalt, dunkel und meist sehr unhygienisch.
Die einzigen beheizbaren Räume waren kleine Stuben auch „Kemenaten"
genannt. Die restliche Burg war vor allem im Winter geradezu
unerträglich kalt. Burgherren gehörten meist zum Adel oder zum Klerus.
Der Klerus ließ seine Burgen und die dazugehörigen Ländereien jedoch
oft von adeligen Burgverwaltern, soge- nannten „Ministerialen",
betreuen, die auch für deren Verteidigung verantwortlich waren. Unsere
Burg war beispielsweise Jahrhunderte lang im Besitz der Erzbischöfe von
Salzburg und wurde vom Ministerialengeschlecht der „Lonsberger"
verwaltet. Eine Burg zu erobern war damals eine wahre Mammutaufgabe,
denn ihre Mauern waren meist mehrere Meter dick. So benutzte man u. a.
Katapulte um diese zu beschädigen oder auch um Tierkadaver hinter die
Mauern zu schießen und so Seuchen und Krankheiten hineinzubekommen.
Auch gab es Rammböcke mit denen man versuchte die ultimative
Schwachstelle der Burg, die Zugbrücke, einzuschlagen. Am sichersten war
es für die Angreifer jedoch die Anlage durch monatelange Belagerung
auszuhungern, was jedoch einiges an Geduld erforderte. Als die ersten
Schusswaffen und Kano- nen erfunden wurde endete das Zeitalter der
Ritter und Burgen. Gegen diese Art von Waffen konnte keine noch so
dicke Mauer und auch keine Rüstung mehr bestehen. Viele Burgen wurden
deshalb nach dem Mittelalter abgebaut oder sie wur- den so umgebaut,
sodass man darin besser wohnen und arbeiten konnte. Um viele Burgen
kümmerte sich aber niemand mehr und sie wurden zu Ruinen. Auch unsere
Burg verfiel zur Ruine wurde allerdings in den letzten Jahren nach und
nach aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt.

Die ArchäoRegion Südweststeiermark
In der Region, die von der Koralpe bis ins Leibnitzer Becken reicht,
befinden sich zahlreiche archäologische Stätten. Menschen der
Steinzeit, der Bronze- und Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit und des
Mittelalters lebten hier und prägten die Region. Das archäologische
Erbe umfasst ihre Spuren die Überreste von Siedlungen, Gräbern,
Heiligtümern, Verkehrswegen und vieles mehr. Für Archäologie,
Denkmalpflege und Museen ist es wichtig, die Spuren zu sammeln, zu
bewahren und zu erforschen. Das Wissen um die vergangenen Kulturen und
deren Wandel wird in den Museen der ArchäoRegion Südweststeiermark
vermittelt.
Die Wiedererrichtung einer mittelalterlichen Burg
Die Kernburg wurde im Laufe der Zeit baufällig und war im 19.
Jahrhundert schon so desolat, dass sie kaum bewohnbar war. Als der
Einsturz des polygonalen Turmes drohte und dadurch eine Gefahr für den
bereits bestehenden Weg durch die Klause bestand, wurde der Turm im
Jahr 1876 gezielt gesprengt. Mit dem Erwerb der Burgruine durch die
Stadtgemeinde Deutschlandsberg begann im Jahr 1932 die Renovierung und
der Wiederaufbau der Burg. Als letzte Etappe konnten im Rahmen eines
von der EU geförderten LEADER-Projektes der polygonale Turm, die
Brunnenstube sowie das Dach des gotischen Wohnturms wiedererrichtet
werden.

Handfeuerwaffenentwicklung
(Hinterlader- und Repetiergewehre, 2. Hälfte 19. Jhd.)
1.) Deutsches Infanteriegewehr M 88, System Mannlicher, gezogener
Hinterlader mit Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5
Patronen im Mittelschaft, Kaliber 7,9 mm, Fertigung Amberg.
2.) Russisches Repetiergewehr M 1891 (gebaut 1892) System
Mossin-Nagant, gezogener Hinterlader mit Geradezug- Drehwarzenverschluß
und Kastenmagazin für 5 Patronen im Mittelschaft, Kaliber 7,65 mm,
aufgepflanztes Nadelbajonett.
3.) Französisches Repetiergewehr Chatellerault M 1892, gezogener
Hinterlader mit Zylinder-Drehkolbenverschluß, Kastenmagazin für 3
Patronen im Mittelschaft. Dazu französisches Nadelbajonett mit
Aluminiumgriff.
4.) Norwegisches Repetiergewehr M 1894 System Krag-Jorgensen, gezogener
Hinterlader mit Zylinder-Drehkolbenverschluß, Seitenmagazin am
Mittelschaft, Kaliber 6,5 mm.
5.) Österreichisches Repetiergewehr M 1895, System Mannlicher,
gezogener Hinterlader (4 Züge mit Rechtsdrall) mit
Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5 Patronen im
Mittelschaft, Kaliber 8 mm, Waffenfabrik Steyr. Aufgepflanztes
Messerbajonett M 1895 für Repetiergewehre System Mannlicher.
5.A.) Ladestreifen für System Mannlicher, M 1895, 5 Zentralfeuerpatronen, Kaliber 8 mm.
6.) Österreichischer Repetierstutzen M 1895, System Mannlicher,
gezogener Hinterlader (4 Züge mit Rechtsdrall) mit
Geradezug-Drehwarzenverschluß und Kastenmagazin für 5 Patronen im
Mittelschaft, Kaliber 8 mm. Fertigung in Budapest.

36.) K.u.K. Offizierskartusche (Behälter für Zentralfeuerpatronen), an
den Seitenflächen mit Waffen- und Kanonendarstellungen verziert, um
1910.
35.) Leibriemen aus Leder der K.u.K. Armee mit Messingschließe (kaiserlicher Doppeladler).

Faustfeuerwaffenentwicklung (17. - 19. Jhd.)
27.) Deutscher Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, kannelierter
Zylinder, 6-schüssig, runder glatter Lauf, Suhler-Fertigung, 1882.
28.) Französischer Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, 6-schüssig,
gezogener, an der Mündung runder Lauf, bronzierte Metallteile,
Fertigung St. Etienne, 1874.
29.) Französischer Armeetrommelrevolver, Zentralfeuer, 6-schüssig,
achtkantiger gezogener Lauf, brünierte und bronzierte Metallteile,
Fertigung St. Etienne, Ende 19. Jhd.

Blankwaffenentwicklung (19.-20. Jhd., erste Modellwaffen)

21.) Prunktablett aus Silber
Auch nach dem Ende des 30-jährigen Krieges waren Darstellungen von
Schlachten und der Kriegskunst immer sehr beliebt. Man denke z. B. an
die Türkenfeldzüge und die Verherrlichung Prinz Eugens von Savoyen. Die
vorliegende kunstvolle Treibarbeit in Hochreliefform ist nach 1650
entstanden und trägt noch stark die Züge des 30-jährigen Krieges.
Steirische Privatsammlung.

Folterschandmaske aus Eisen mit im Innenteil montierten Zungenstabilisierungsblech

Kelch aus Gold mit hohlem Standfuß. Kuppa mit mehreren ovalen
Medaillons (Personen in Brustbilddarstellung) dekoriert.
Früh-Hochmittelalter, 8.-13. Jh.

In Reliefformen geblasene und gepresste Gläser
Seit Erfindung der Glasmacherpfeife in den letzten Jahrzehnten vor
Christi Geburt kennt man Gläser mit plastischen Verzierungen. Die
Muster waren in eine Holzform vertieft eingeschnitten und übertrugen
sich beim Einblasen der heißen Glasmasse als Relief auf die
Gefäßwandung. Um 1815/20 setzte in Amerika die Erzeugung von
Gebrauchsgläsern mit geometrischen Reliefmustern ein, die Vorbilder
dazu fand man in geschliffenen Gläsern aus England und Irland. Dazu
verwendete man keine Holzformen mehr, die zu schnell ausgebrannt wären,
um für die Massenfabrikation geeignet zu sein, sondern dreiteilige
Metallformen. 1827 hatte man das Verfahren so weit mechanisiert, dass
die Gläser in der Metallform gepresst werden konnten. Für diesen
Prozess wurde eine zähflüssige Glasblase in die Form gegeben und mit
einem Stempel gegen die Innenwand der Form gepresst, wobei auch die
feinsten Muster scharfkantig herauskamen. Allerdings konnten nur solche
Gegenständę gepresst werden, deren Hohlraum zylindrisch war oder sich
nach oben verbreiterte, um den Stempel wieder herausziehen zu können,
also Becher, Pokale, Kännchen und Vasen. Keinen Beschränkungen unterlag
das Pressen von Tellern, Platten, aller Arten von Schalen mit und ohne
Deckel und massiver Gegenstände wie Tür- und Möbelknöpfe,
Kerzenleuchter sowie Füßen von Pokalen, Schalen und Dosen. Bei der
Auswahl der erhabenen Muster waren die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Alle Schliffmuster konnten in einem Arbeitsgang gepresst werden, dazu
die kompliziertesten Ornamente, die in Handarbeit nicht hätten
hergestellt werden können, und alle nur erdenklichen figürlichen Motive.
Die außerordentliche Billigkeit der in Massen produzierten Pressgläser
machte reich verziertes Glas zum ersten Mal für breite
Bevölkerungsschichten erschwinglich, die sich geschliffene Ware nicht
hätten leisten können. In Österreich gab es mehrere Hütten, die neben
geschliffenem auch gepresstes Glas erzeugten. Eine der ersten
Glashütten war die des Benedikt Vivat in Langerswald (Bachern, heute
Slowenien), die auf der Wiener Ausstellung 1835 gepresste Trinkgläser
zeigte. In der Steiermark zählte das in verzierte Formen eingeblasene
Glas in der Zeitphase ab 1840 zu den geläufigen Erzeugnissen der
Glaswerkstätten der Koralpe und des Bacherns. Im Musterbuch von 1869
der Glasfabrik Ferdinandstal-Staritsch bei Eibiswald sind Produkte aus
Pressglas wie beispielsweise Teller, Kerzenleuchter und Salzbehältnisse
angeführt. Die Glasbläser fertigten aus Becherformen auch beliebte
Taschenflaschen für Schnaps, so genannte Tschuttera, für den lokalen
Vertrieb. Im Böhmerwald begann man ebenfalls schon 1836 in der
Adolphshütte bei Winterberg mit der Produktion von in Reliefformen
geblasenen Gläsern, die mit „erhabenen arabeskenhaften Verzierungen"
dekoriert waren.

Die Waldglashütten des Mittelalters und der Neuzeit
Im Mittelalter waren Glasgefäße begehrte und äußerst selten vorkommende
Gegenstände, die vermutlich nicht lokal, sondern in überregionalen
Produktionszentren hergestellt wurden. Erste schriftliche Nachrichten
zu Waldglashütten in der Steiermark betreffen bereits das 13. Jhd.
Archäologisches Fundmaterial aus heimischen Burganlagen, zumeist
Fragmente verschieden geformter und verzierter Gläser, stellt neben
urkundlichen Nennungen die einzige sichere Quelle zur Glasproduktion
dieses Zeitalters dar. Eine große Anzahl von Waldglashütten war in der
heutigen Steiermark (Region Soboth/Koralpe und Salla) und auch in
benachbarten Gebieten des heutigen Sloweniens (z. B. Region Bachern)
seit dem 16. Jhd. in Betrieb. So wissen wir beispielsweise über
insgesamt sieben Glashütten Bescheid, deren Betriebe über kurze oder
längere Zeit auf der Koralpe angesiedelt waren.
Riesige zusammenhängende Waldflächen, die im Besitz des Adels und der
Klöster standen, überzogen große Gebiete der Steiermark. Von besonderem
Interesse für die Grundeigentümer waren Waldungen im Mittelgebirge, die
durch den Bau einer Glashütte optimal genutzt werden konnten. Die
Glashütten lagen als geschlossene eigenständige Betriebe aufgrund der
Feuergefahr außerhalb der Dorfsiedlungen oder Güter. In den
Waldglashütten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jhds. wurden
neben einfachen, für den täglichen Gebrauch bestimmten Hohlglaswaren
(Trinkgeschirr, Glasbehälter, Flaschen usw.), auch Tafelglas
(Fensterscheiben) und Luxusgüter wie Spiegel und aufwendig geschliffene
und bemalte Gläser hergestellt. Der Niedergang der letzten
Waldglashütten der Koralpe, insbesondere in den Jahren um 1870-1880,
war unter anderem eine Folge des an den Waldungen betriebenen Raubbaues
und der immer schwieriger werdenden Absatzsituation. Die zumeist
herrschaftlichen Grundbesitzer bzw. Betreiber der Glashütten legten
wenig Wert auf die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlschläge,
wodurch um die Glashütten fortan neue landwirtschaftliche Flächen
entstanden. Zur Versorgung einer Glashütte war auch ein großes
wirtschaftliches Umfeld notwendig, das aus einer betriebseigenen
Meierei, Brauerei und Sennerei bestehen konnte.

Glas und Kohle Das Zeitalter der Industrialisierung
Nachdem im ausgehenden 18. Jhd. der Holzmangel immer eklatanter wurde,
machte ein vom Kaiserhof erteiltes Privileg den Glashüttenbetreibern
die Verwendung von Steinkohle lukrativ. Eine der ersten Glashütten die
auf Holzfeuerung verzichtete und ihre Öfen mit Kohle beheizte, war die
Agneshütte (1794) in der ehemaligen Untersteiermark, heute
Liboje/Slowenien. Bald darauf wurde in der Glashütte Oberdorf/Bärnbach
begonnen mit Kohle zu heizen. Dieser Prozess führte schlussendlich zur
Einstellung der letzten noch mit Holz feuernden Glashütten der Soboth
in der Weststeiermark, die bereits ab dem beginnenden 19. Jhd. von neu
errichteten Hütten im Raum Eibiswald sukzessive verdrängt wurden.
Die wirtschaftlichen Ursachen für diese Entwicklung lagen nicht nur in
den reichen Glanzkohlenvorkommen des Eibiswalder Reviers, sondern auch
in der damals optimalen Verkehrslage, die durch die Anbindung der
Weststeiermark an das Schienennetz der
Graz-Köflacher-Eisenbahngesellschaft gegeben war. So verwundert es auch
nicht, dass die Wieser Glasfabriken nächst dem infrastrukturell
bedeutenden Bahnhof erbaut wurden. Viele der neu errichteten Glashütten
im Raum Eibiswald dehnten sich unmittelbar um die Kohleschächte aus,
wie beispielsweise die Glashütten in Ferdinandstal/ Staritsch und
Vordersdorf. Damit war ein neues Zeitalter angebrochen. Dampfmaschinen
lösten die alten Wasserräder ab, Glasfacharbeiter und Gewerkschaften
bildeten sich heraus und Glas wurde zum Massenprodukt. Die glanzvolle
Zeit der Glasmacher in den Wieser und Eibiswalder Hütten endete in der
Weltwirtschaftskrise der Zwanziger Jahre des 20. Jhds. Nacheinander
mussten die Glashütten ihren Betrieb einstellen, und heute erinnern nur
noch wenige, in der Bevölkerung zumeist vergessene Gebäude an diese
einst glanzvolle alte Zeit.

Prunkvolle Trinkgarnitur mit Schenkkanne und 6 Trinkgläsern.
Versilbertes Tablett mit Widmung: "In dankbarer Würdigung der
unvergänglichen Verdienste des Herrn Anton Stiegler um den Obst- und
Weinbau, zur bleibenden Erinnerung von den Weinbautreibenden Marburgs
und Umgebung", datiert Marburg, 4. März 1899.
Reicher Mattschliffdekor mit Ranken, Sternen und Girlanden.
Steiermark, um 1899. Glashütte Josefsthal (Josipdol), Slowenien.

Steinschlosspistole (Scherzgefäß) mit geripptem Körper und plastisch geformter Batterie und Abzugsbügel. 1. H. 18. Jh.
Trinkstiefel (Scherzgefäß), Details aus gerippten Glassträngen. Steiermark, 2. Hälfte 18. Jhd.

Schnapshund (Scherzgefäß) aus brauner Glasmasse. Schräg gerippter Körper, Details zangengeformt. 1. Hälfte 18. Jhd.

Erzherzog-Johann-Pokal in Römerform aus Uranglas.
Oberteil mit Reliefdekor (formgeblasen), Schaft aufwendig geschliffen.
Palmettendekor, dazwischen steirisches Wappen mit Aufschrift
„Steyermark", 1840 mit landwirtschaftlichen Geräten, Profilbüste
Erzherzog Johann, Aufschrift „E. Herzog Johan. B.", landwirtschaftliche
Geräte, Aufschrift „Glasfab. D.B.V. K.K. Priv.“. Steiermark, Benedikt
Vivat, Glashütte Langerswald / Bachern (heute Slowenien), 1840.

Die Glasherstellung
Auch die wichtigsten Rohstoffe zur Glasproduktion, wie Quarz und
Kalk/Marmor sowie vor allem Holz, waren zumeist in unmittelbarer Nähe
zu den Waldglashütten in ausreichenden Ressourcen vorhanden. So
entstanden in ursprünglichen Waldgebieten in einer Seehöhe von
1000-1300 Metern kleine Siedlungen und Rodungsinseln, die von Familien
bewohnt wurden, deren Überleben durch die Glasproduktion gesichert war.
Für die Feuerung der Öfen und insbesondere für die Pottaschegewinnung
waren enorme Holzmengen nötig. War das Holz verbraucht, zog die
Glashütte zum nächsten Ort weiter. Viele der mitunter enormen
Rodungsinseln im Urwald um die Glashütten wurden forthin von der
Landwirtschaft weiter kultiviert.
In einigen Gegenden wurde das Befeuern der Glasöfen mit Holz schon im
ausgehenden 18. Jhd. untersagt. In einer Verordnung Kaiserin Maria
Theresias von 1754 wird beispielsweise festgehalten, dass „Glas und
andere Holz verzehrende Betriebe bloss in Gegenden angelegt werden
dürfen, wo Holz im Überfluss ist". Holz wurde beim Glasschmelzen in
großer Menge benötigt, nicht nur, um die Hafenöfen zu feuern, sondern
vor allem, um aus der Holzasche die Pottasche auszulaugen, die als
Flussmittel die Schmelztemperatur des Quarzes herabsetzt. Je nach Art
und Beschaffenheit des Glasgemenges waren ein bis drei Festmeter Holz
notwendig um 1 kg Glas zu erzeugen, wobei 3 - 5% für das Heizen der
Öfen aufgingen, der verbleibende Rest entfiel auf die
Pottaschegewinnung.

Das Hohlglas
Hohlglas ist das „Glas" schlechthin: man versteht darunter Trinkgläser,
Flaschen und unterschiedlichste Glasbehälter. Das wichtigste Werkzeug
zur Hohlglasproduktion ist die Glasmacherpfeife, die bereits seit dem
ausgehenden 1. Jhd. v. Chr. im östlichen Mittelmeerraum bekannt war.
Mit Hilfe der Pfeife formt der Glasmacher heißes, zähflüssiges Glas zu
den unterschiedlichsten Produkten. Die ältesten Glasmacherpfeifen
dürften kurze Keramikrohre gewesen sein, die im Laufe ihrer Entwicklung
von dünnen, langen Metallrohren verdrängt wurden. Glasmacherpfeifen
sind an einem Ende mit einem Mundstück und am anderen Ende mit einer
Verdickung, dem „Nabel" versehen. Unterhalb des Mundstückes isoliert
ein Holzmantel die Pfeife gegen Hitze. Der Glasmacher wärmt das Ende
der Pfeife im Ofen an und entnimmt mit dem Nabel eine genau bemessene
Menge zähflüssiges Glas aus dem Ofen. Eingeblasene Luft bildet im Glas
einen Hohlraum, den der Glasbläser weiter formt und vergrößert. In
dieser Art und Weise werden alle Hohlgläser, unter Zuhilfenahme von
Formen aus Holz oder Metall, hergestellt.
Zu den häufigsten Produkten der Glashütten zählen neben
unterschiedlichsten Hohlglasformen vor allem Flaschen, die in einem
gängigen Spektrum hergestellt wurden. Bis um 1900 fertigten die
Glasmacher Flaschen unter Verwendung einfacher Werkzeuge völlig von
Hand. In der Zeit des „Ausarbeitens" an den Hafen erzeugten zwei bis
drei Glasmacher etwa 650 Stück Glasflaschen in durchschnittlicher
Größe, wozu wöchentlich drei Schmelzen notwendig waren. Der Boden der
Flaschen mit dem Ansatz des Hefteisens (Abriss) war üblicherweise stark
hochgestochen, um einen Standring zu erzeugen.

Was ist Glas?
Unter Glas (von germanisch glasa „das Glänzende, Schimmernde") versteht
man einen amorphen nicht kristallinen Feststoff. Materialien, die man
im Alltagsleben als Glas bezeichnet (zum Beispiel Trink- und
Fenstergläser) sind nur ein Ausschnitt aus der Vielfalt der Gläser.
Glas ist eine amorphe, das heißt im Wesentlichen nicht kristalline
Substanz. Gewöhnlich wird Glas durch Schmelzen erzeugt. Thermodynamisch
wird Glas als gefrorene, unterkühlte Flüssigkeit bezeichnet. Diese
Definition gilt für alle Substanzen, die geschmolzen und entsprechend
schnell abgekühlt werden. Das erstarrende Glas ist zu schnell fest, um
noch eine Kristallbildung zu erlauben. Der Transformationsbereich, das
ist der Übergangsbereich zwischen Schmelze und Feststoff, liegt bei
vielen Glasarten um 600° C. Trotz des nicht definierten Schmelzpunktes
ist Glas ein Festkörper. Auch wenn es sich unter langzeitiger
Krafteinwirkung verformte, dürfte man es nicht als flüssig bezeichnen.
Die langsame Verformung unter einer konstanten Kraft tritt auch in
kristallinen Festkörpern auf und wird als Kriechen bezeichnet. Berichte
von fließenden Kirchenfenstern lassen sich nicht bestätigen und die
Idee des flüssigen Glases scheint auf eine Falschübersetzung
zurückzugehen.
Die im allgemeinen Sprachgebrauch kennzeichnende Eigenschaft von Glas
ist die Durchsichtigkeit. Die optischen Eigenschaften sind so
vielfältig, wie die Anzahl der Gläser. Neben klaren Gläsern, die in
einem breiten Band für Licht durchlässig sind, kann man durch Zugabe
von speziellen Materialien zur Schmelze die Durchlässigkeit blockieren.
Die bekannteste Steuerung der Durchlässigkeit ist die Färbung der
Glasmasse. Andererseits gibt es undurchsichtiges Glas, das schon
aufgrund seiner Hauptkomponenten oder der Zugabe von Trübungsmitteln
lichtundurchlässig ist. Gebrauchsglas hat eine Dichte von 2,5 g/cm³.
Die mechanischen Eigenschaften variieren sehr stark. Die
Zerbrechlichkeit von Glas ist sprichwörtlich. Die Bruchfestigkeit wird
stark von der Qualität der Oberfläche bestimmt. Glas ist weitgehend
resistent gegen Chemikalien. Eine Ausnahme ist Flusssäure, sie löst das
Siliziumoxid und wandelt es um. Im Allgemeinen hat Glas einen hohen
elektrischen Widerstand.

Prunkvolle Bowlegarnitur (bestehend aus Bowletopf mit Deckel und
Glasschöpfer auf Tablett, dazu sechs Fußgläser mit Deckel). Dekore in
Hochschliff (so genannter „Laufender Hund"), Schäl- und Steindlschliff
sowie Kugelschliff. Meisterhafte Arbeit aus der Glashütte St. Vinzenz,
um 1850.

Gläsener Dachziegel (Bieberschwanzform) Verwendung als Lichtziegel in
der Dacheindeckung. Herkunft: sogennantes „Hohenwarthaus" am Hauptplatz
von Celje (Cilli), Slowenien. Glashütte Jurklošter (Gairach). A. 19. Jh.

Ohrgehänge aus Gold mit symmetrischer Durchbruchsarbeit, zentraler
Glasperle und drei Anhängern mit zentraler Scheibe und Glasperle.
Spätantik, 4.-5. Jh.

Herkulesfigur aus Marmor
Herkules dargestellt mit den Attributen Keule und Löwenfell in den Händen. 2. Jh. n. Chr.


KELTISCHER MÜNZSCHATZFUND - Königreich Norikum
Größter bisher erhaltener norischer Münzschatzfund (Kultdepot)
Österreichs, bestehend aus insgesamt 427 Stück keltischen
(westnorischen und zwei ostnorischen) Großsilbermünzen (sog.
Tetradrachmen), Kleinsilbermünzen und einer römischen Bronzemünze (As,
Claudius, 41-54 п. Chr.) Die Mehrzahl der Münztypen kann dem Typ СОРО
(u.a. auch mit venetischer Legende) zugeordnet werden. Die ältesten
Gepräge zeigen bisher unbekannte venetische Legenden (Runen), wie z. B.
die Namenszüge CAVISO, COPO und BOIOCAVA. Einzelne Stücke gehören den
Typen, TINCO, Kugelreiter, Warasdin B, COCO und CAV(A) (bisher völlig
unbekannte Typen) an. Einige Münzen werden durch ein charakteristisches
Torquesohr bzw. einen profilierten Helm charakterisiert (ebenfalls
unbekannte Typen). Die Münzen waren ursprünglich in einem
Metallgefäß aus Bronze vergraben. Das Münzspektrum lässt auf ein
mehrphasiges, über 300 Jahre andauerndes, Münzopfer an einem heiligen
Ort schließen.
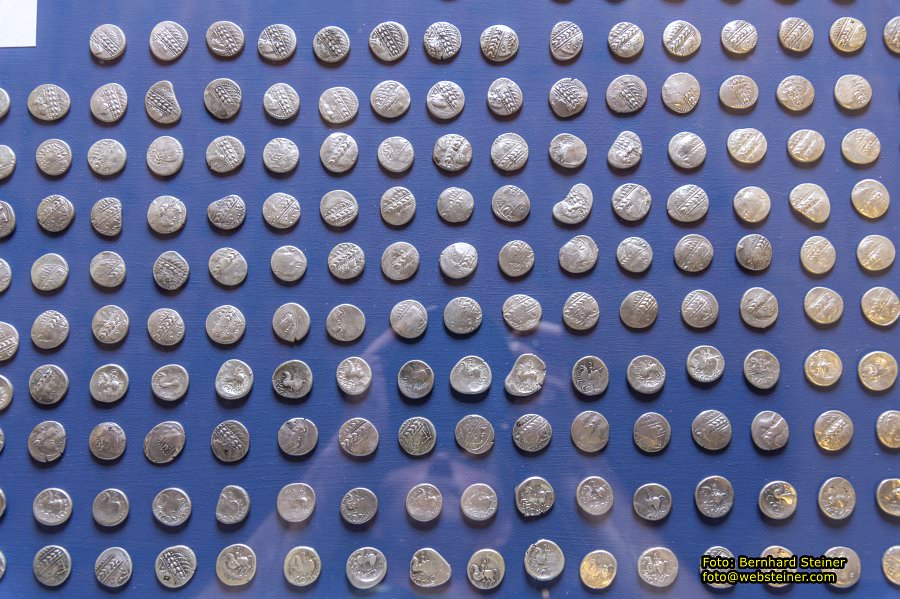
Schatzfund mit keltischem Hals- und Ringschmuck sowie Münzen.
Drei unterschiedlich gestaltete Halsreifen aus Gold (sogenannte Torques-Statussymbole eines Fürsten).
Drei Fingerringe aus Golddraht, ein Golddrahtfragment sowie ein filigraner Golddraht.
Münzen: 12 Goldmünzen (Statere und Teilstück) sowie drei Silbermünzen (Drachme und Quinare).
Gesamtgewicht des Hortfundes: ca. 1350 Gramm.
Frühe Latènezeit (Keltenzeit), 4.-3. Jh. v. Chr.

Frühkeltische Waffenfunde
Latènekultur, 4. Jhd. v. Chr. Weststeirisches Gebirgsschlachtfeld
1-3 Prunkvolle Lanzenspitzen aus Eisen (Standartenspitzen) mit
besonders breiten Blättern und dreieckigem Mittelgrad. Kräftige
Kampfspuren (abgebrochene Spitzen, Einhiebe und Stauchungen an den
Schneiden).
4 Pilumartige Wurflanze aus Eisen. Runde Tülle, achtkantiges
Schaftstück, blattförmige Spitze mit dachförmigem Mittelgrad. Durch
Einhieb antik stark verbogen.

Reliefplatte aus feinkörnigem Marmor mit versammelter Personengruppe um Tisch. Provinzialrömisch, 3. Jh.

Vollsilberspiegel (Prunkspiegel) mit Darstellung einer
gleichgeschlechtlichen Erotikszene im Medaillon auf der Rückseite. Das
Bett (Kline) ist durch Vergoldungen hervorgehoben. Römisch (frühe
Kaiserzeit), ca. 50-80 n. Chr.

Zylindrische Deckeldese (Pyxis) aus Bein mit Darstellung des dionysischen Reigens. Römisch, 2. Jh.

Maskenhelm (Paradehelm) aus Silber mit partiellen Vergoldungen (Typ
Nijmegen-Kops-Plateau). Die Helmkalotte war ursprünglich aus Eisen.
Helme dieser Form wurden von der Kavallerie bei Zeremonien,
Triumphzügen sowie im Kampf verwendet. Gesamtgewicht: 1040 Gramm. Frühe
römische Kaiserzeit, 1. Hälfte 1. Jh.

Druiden
Die Druiden genossen in der keltischen Gesellschaft hohes Ansehen - als
Denker, Richter, Wahrsager, Astronomen und Gottesmittler.
Glaube und Mythos: Die Druiden vollzogen die Opferhandlungen. Geopfert
werden neben Schmuck, Keramik, Münzen und Nahrungsmitteln auch Tiere
und Menschen. Bei einigen der von antiken Autoren beschriebenen
Menschenopfer könnte es sich aber ebenso um falsch verstandene
Initiations-, Fruchtbarkeits- und Reinigungsrituale gehandelt haben.
Auch für die Archäologen ist es oft schwierig zwischen Beisetzung,
Opferung und Hinrichtung zu unterscheiden.
„Ferner gibt es Philosophen, die der Götterlehre kundig sind und in
sehr hohem Ansehen stehen; man nennt sie Druiden. Auch hat man
Wahrsager, denen man ebenfalls viel Ehre erweist. Sie sagen aus dem
Vogelflug und aus der Opferschau die Zukunft voraus und haben das ganze
Volk in ihrer Gewalt.... Es ist bei den Galliern gebräuchlich, dass sie
kein Opfer ohne einen ihrer Weisen verrichten. Denn sie sagen, man
dürfe den Göttern die Dankopfer nur durch diejenigen bringen lassen,
die mit ihrem Wesen vertraut seien und, so zu sagen, ihre Sprache
verstehen; und durch eben dieselben glauben sie erbitten zu müssen, was
sie sich wünschen."
Diodorus Siculus 5,31
„Die (Druiden) versehen den Gottesdienst, besorgen die Opfer für den
Staat und für Privatleute und legen die heiligen Satzungen aus. Eine
Menge von jungen Leuten kommt zu ihnen, um Unterricht zu empfangen, und
sie genießen überhaupt bei den Galliern ein hohes Ansehen. Denn fast
bei allen Zwistigkeiten, sie mögen nun Staatsangelegenheiten oder
Privatvorfälle betreffen, entscheiden sie. Hat jemand gefehlt, ist ein
Mord geschehen, ist etwa über Erbschaft und Gemarkung ein Streit
entstanden, so fällen sie das Urteil, setzen Strafen und Belohnungen
fest."
Cäsar. „Der Gallische Krieg", 6.13
* * *
Kalender und Feiertage der Kelten
Irische Quellen lassen vermuten, daß die Kelten jährlich vier
Hauptfeiertage begingen, die offenbar alle mit Fruchtbarkeit und dem
Wechsel der Jahreszeit zu tun hatten. In diesen Festtagen spiegelt sich
aber nicht nur der Jahreszyklus der Bauern und Hirten, sondern auch das
politische und religiöse Gemeinschaftsleben in Irland wider. So tagte
zum Beispiel die Jahresversammlung von „Ulaid" (Ulster) an den Tagen
vor und nach dem „Samhain".
1. Februar: Imbolc
Soll mit der Stillzeit der Mutterschafe zusammenhängen. In Irland der
Göttin Brigid geweiht, einer Muttergottheit und Patronin der
Gebährenden.
1. Mai: Beltain
„Gutes Feuer", gilt der Sonnenwärme, die fruchtbare Ernten und Herden
hervorbringt. Ob das Fest auch außerhalb Irlands begangen wurde, wissen
wir nicht mit Sicherheit, aber es stand möglicherweise in Zusammenhang
mit dem in Gallien verehrten Sonnengott Belenos.
1. August: Lughnasa
Erntefest zu Ehren des Gottes Lugh. An diesem Tag wurde in Lugdunum (Lyon), der „Festung des Lug", ein großes Fest gefeiert.
1. November: Samhain
Dieses wichtigste der vier Feste bezeichnete möglicherweise den Beginn
des keltischen Jahres. Zu Samhain, das an der Wende vom Oktober zum
November begangen wurde, fielen die Grenzen zum Jenseits - eine
Vorstellung, die bis heute im amerikanischen Gruselkarneval „Halloween
Eve" (31. Oktober) mit spukt.

Keltische Siedlung am Burgberg
Mehrere Funde aus der sog. Latèneperiode bezeugen die Existenz einer
Siedlung in der Zeit der Kelten. Eine Silbermünze mit der Prägung
COP-POV, dem Prägeherren eines norischen Stammes, der die Münze
herstellte, gehört zu den prominentesten Funden. Auch Keramik sowie ein
eiserner Schlüssel wurden gefunden. Die Siedlung dieser Zeit dürfte
sich vom sog. Tanzboden, etwa 300 m nordöstlich der mittelalterlichen
Kernburg, bis zum Areal der Burg erstreckt haben. Flachlandsiedlungen
dieser Zeitstellung lagen in Freidorf an der Laßnitz, aber auch in
Hörbing und Leibenfeld. Ob es sich dabei um mehrere Gehöfte oder um
eine zusammengehörige Siedlung handelte, ist noch unsicher.
* * *
Keltische Votivstatuette aus Bronze eines segnenden Priesters. Der
Priester trägt einen Kegelhut sowie aufwendig dargestellten Hals-, Arm-
und Gürtelschmuck. 5. Jhd. v. Chr.

KULTWAGEN VON STRETTWEG - Ein Prunkstück hallstattzeitlicher Bronzekunst.
1851 in Strettweg bei Judenburg in einem Großgrabhügel gefunden,
besticht er durch seine geheimnisvolle Konstruktion verbunden mit einem
unvergesslichen Figurenreichtum (Hirsch- Opferzug, bewacht von
Kriegern, zentrale weibliche Gottheit). Bezüglich seiner Verwendung hat
er zu zahlreichen Deutungen (magische, religiös-politische Zwecke oder
Tafelgerät) Anlass gegeben.
Datierung: um 600 v. Chr. Maßstabgetreue Nachbildung (Rekonstruktion Nr. 2) in Bronze, L 43 x B 34 x H 45 cm
Original im Landesmuseum Joanneum Graz-Eggenberg

Im Mittelalter gab es ein eigenartiges Gesellschaftssystem. Die
Menschen waren damals nämlich streng in Klassen einge- teilt. Diese
Klassen wurden „Stände" genannt und es gab genau drei davon. Diese
waren im Ansehen nicht gleichgestellt und hatten verschiedene Pflichten
und Rechte.
(1) KLERUS: Darunter versteht man die Kirche und ihre Mitarbeiter, wie
Bischöfe und Mönche. Das Mittelalter war stark vom Glauben an die
katholische Kirche geprägt und diese hatte sehr viel Macht. Die Aufgabe
dieser Klasse bestand darin das Leben der Menschen im Sinne der
christlichen Lehren zu steuern. Die Kirche stellte also viele Regeln
für das alltägliche Leben auf, an die sich alle halten mussten.
(2) ADEL: Hierhin gehörten u. a. Fürsten, Grafen und Ritter. Sie waren
typischerweise auf Burgen anzutreffen, die sie sowohl als Heim als auch
Residenz nutzten. Ihre Aufgabe war es das Volk und den Klerus vor
Feinden zu schützen. Der Adel stellte Streitkräfte und zog in den
Krieg. Kinder dieses Standes hatten einen guten Zugang zu Bildung und
waren daher auch für andere Laufbahnen geeignet.
(3) BAUERN: Sie bilden die größte Gruppe und ermöglichen das Leben der
anderen beiden Stände durch ihre Arbeit. Sie bewirtschafteten die
Felder und produzierten Lebensmittel, Sie waren meist sehr arm, da sie
einen Großteil ihrer Ernte an den Adel und den Klerus abgeben mussten.
Ihre Kinder durften nicht zur Schule und mussten schon ab ca. 6 Jahren
aktiv am Bauernhof mitarbeiten.
Zwischen den Ständen gab es nahezu unüberwindbare Grenzen. So war Adel
beispielsweise ein Geburtsrecht d.h. waren die Eltern von Adel, waren
es auch die Kinder. Vom Adel in den Klerus konnte hingegen sehr wohl
gewechselt werden. Da ein Herrscher mit mehreren Söhnen, nur einen
Nachfolger brauchte, schlugen die anderen nämlich meist eine Laufbahn
als Ritter oder Geistlicher ein. Überhaupt keine Wechselmöglichkeit gab
es für die Bauern. Sie konnten weder Lesen noch Schreiben und
verstanden kein Latein. Alles Fähigkeiten die ein Angestellter der
Kirche beherrschen musste.

Die Ausgrabungen im romanischen Hof
In den Jahren 2015-2017 wurde der romanische Hof westlich des
polygonalen Bergfrieds archäologisch untersucht. Dieser Bereich
innerhalb der mittelalterlichen Ringmauer wurde wohl bereits im späten
15. Jahrhundert aufgegeben und nur mehr für die Deponierung von
Abfällen genutzt. Dementsprechend reich waren die archäologischen
Funde, die aus einem Zeitraum vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit
reichen. Eine hier gefundene gotische Ofenkachel zeigt einen Löwen.
Dass es sich dabei um einen Panther, das steirische Wappentier,
handelt, ist angesichts der Konflikte des Erzbistums Salzburg, zu
dessen Besitz die Burg Landsberg zählte, mit dem steirischen
Landesfürsten und den Landesständen, eher unwahrscheinlich.
* * *
Heiliger Laurentius
Gemälde des Heiligen Laurentius, Öl auf Leinwand, vergoldeter Rahmen. Originalinventar der Burgkapelle.
Datierung: 18. Jh

Vollständiger prunkvoller Speise- und Trinkgeschirrsatz (Festmahlgeschirr) aus Silber eines römischen Ehepaares.
Römisch-republikanisch, ca. 40 v. bis 15 n. Chr. Geburt.
Bestehend aus:
2 Skyphoi (Trinkbecher für Wein) mit paarigen Henkeln
2 Saucieren in Becherform und 2 Schalen
2 Speiseteller und 1 Vorlegeteller
1 Weinsieb und 1 Weinschöpfer sowie 2 Speiselöffel


Frühe Hallstattkultur 750 - 650 v. Chr. Geb.
308-318. Inventar eines Hügelgrabes. Bestattung vermutlich in einem Leichenbrandbehälter aus organischem Material.
308. Großes Keramikkegelhalsgefäß mit vier kreisförmigen,
gegenüberstehenden in Kannelurtechnik hergestellten Spiralverzierungen
sowie kreisförmigen Eindrücken (Dellen) auf den Unterteilen der vier
gegenständigen Schulter-Halsansatzknuppen. Leichenfeuermerkmale auf dem
ganzen Gefäß.
309. Großes Keramikkegelhalsgefäß mit vier gegenständig auf der
Schulter angebrachten Krummstabverzierungselementen und vier
gegenüberstehenden Schulter-Halsansatzknuppen. Starke Feuermerkmale auf
dem ganzen Gefäß.
310. Keramikkegelhalsgefäß mit vier gegenständigen
Schulter-Halsansatzknuppen an deren Unterteil je Knuppe ein
Fingereindruck (Delle) angebracht ist. Von Knuppe zu Knuppe zieht sich
in einem flachen Bogen ein Girlandenmuster in Kannelurtechnik.
312. Schwarze Keramikeinzugfußschale mit relativ breitem und hohem
Standfuß Dichte geometrische Verzierung auf Schalen- und
Standfußaußenseite, mit Hilfe eines Punktierrädchens hergestelltes
Strichbündeldekor (Art von Rädchenkerben), das ursprünglich weiß mit
Kalk in- krustiert war, Inkrustierung nur stellenweise erhalten, sonst
offensichtlich vom Leichenfeuer ausgeglüht
313. Keramikfußschale mit vierfacher Randzipfelung, facettierter
Schulter und ausladendem Rand. Der Innenteil ist durch Strichbündel bis
zum Bodenansatz verziert. Unter jedem Randzipfel befindet sich auf der
Gefäßschulter eine vertikal-längliche Knuppe. Niedriger konischer
Standfuß.
314. Vermutlich Henkelschalenfragment, Keramik mit zylindrischem
Kragenhals und scharf umgebrochenem Schulterknick. Unterteil
halbkugelig (Schöpfgefäß).
315. Keramikfragment, vermutlich von einer Schale mit spitzer
Knuppenleiste und reicher horizontaler Leistenzier. Umenfelderzeitlich
(aus Hügelauffschüttung).
316. Kleiner Kupfer- oder Messingring fragmentiert.
317. Bruchstück einer Manganeisenknolle
318. Bruchstück einer Manganeisenknolle.
319. Weitere Keramikfragmente aus der Hügelaufschüttung Umenfelderzeitlich. Ha. B.

Im Zuge der Neueröffnung des Gewölberaumes im romanischen Rittersaal
der Burg Deutschlandsberg zeigt das Burgmuseum Deutschlandsberg eine
interessante Schau zu Depot- oder Weihefunden aus dem 14. - 12. Jhd. v.
Chr., der sog. Spätbronze- bzw. frühen Urnenfelderzeit.
Die Ausstellung umfasst ca. 600 Objekte aus Bronze und Gold (7
Weihefundkomplexe), die anhand von weiteren ausgewählten Siedlungs- und
Grabfunden aus der Süd- und Weststeiermark in einen zeitlichen Kontext
gestellt werden. Die chronologisch aufgebaute Ausstellung beginnt mit
den ältesten bisher in der Weststeiermark belegbaren Siedlungsfunden
aus der Jungsteinzeit (Mittelneolithikum, ca. Mitte 5. Jahrtausend v.
Chr.), den Abschluss bildet Fundmaterial der Bronze- und
Urnenfelderzeit (Ende 3. Jahrtausend v. Chr. - 10. Jhd. v. Chr.).
Unter dem Begriff „Weihefunde" werden Opfergüter wie z.B. Waffen,
Werkzeuge und Schmuckobjekte aus Bronze und Edelmetall zusammengefasst,
die in einer Menge von bis zu 230 Objekten an einem heiligen Ort
niedergelegt wurden. Die bisher in der Steiermark aufgefundenen Hort-
bzw. Weihefunde der genannten Zeitspanne werden insbesondere dadurch
charakterisiert, als das den Göttern von der Bevölkerung offenbar nach
vorgegebenen Besitz- und Vermögensverhältnissen vom kleinsten, nur
wenige Gramm wiegenden Metallfragment bis zu vollständigen Objekten
höchster Wertschätzung geopfert wurde. In einigen Fällen errichtete die
bronzezeitliche Bevölkerung sogar trocken gemauerte Steinaltäre mit
zentralen Opferschächten, in deren Inneren die wertvollen Weihegaben
über längere Zeiträume hinweg kontinuierlich deponiert wurden. Diese
Opferstellen stehen zumeist in engem Zusammenhang mit steilen
Felswänden und Höhlen, die als Eingang in die Unterwelt angesehen
wurden.
Die bisher spektakulärsten und wissenschaftlich bedeutendsten Hortfunde
(Weihefunde) wurden zum Großteil in Mittelgebirgslage angetroffen,
insbesondere an von der Natur vorgegebenen, hoch aufragenden besonderen
Felsformationen.
Dazu zählen Felsüberhänge (Abris), Spalten, Klüfte und Höhlen sowie
besonders geformte Felsplateaus. Für die Auswahl eines geeigneten
Platzes der oben beschriebenen Heiligtümer mussten offenbar mehrere
topographische Bedingungen von der Natur vorgegeben sein. Nach
mehrjährigen geomantischen und esoterischen Überprüfungen konnten zudem
insbesondere an den Opferplätzen starke Kraftlinien und Kreuzungspunkte
verschiedenster geomantischer Grundlage angetroffen werden. Die
vorgeschichtlichen heiligen Plätze, heidnischen Ursprungs, wurden meist
durch lange Zeiten hindurch von der ansässigen Bevölkerung bis weit in
die Neuzeit verehrt. Oft erinnern noch mystische Sagen
(Drachenüberlieferungen) an die ur- und frühgeschichtlichen Kultplätze.
Auch spätere christliche Heiligtümer wurden gezielt an alten, immer
wieder aufgesuchten Orten der besonderen Kraft errichtet. Diese
Opferzeremonien aus vorkeltischer Zeit leben durchaus bis in unsere
heutige Zeit in Form von Messopfern (Geldspenden) weiter: Zusätzlich zu
den oben angeführten stationären Heiligtümern existierten diffizile
Opferriten, beispielsweise an wichtigen Handelswegen (z. B.
Salzhandelsroute im Koppental, Ausseerland), an Quellen, Flüssen, Seen
und Mooren (Wassergott). Insbesondere wurden Waffen (Schwerter und
Beile) und Schmuckgegenstände in den Tiefen der Gewässer versenkt,
beispielsweise ein steirisches bronzenes Griffzungenschwert. Auch der
prähistorische und antike Totenkult verlangte umfangreiche „Opfergaben"
der Gesellschaft in Form einer gewissen Auswahl des persönlichen
Besitzes der Verstorbenen und Angehörigen im Sinne einer
Grabausstattung.

Bronzezeitlicher Kompositpanzer.
Die über 533 Stück spitzkegelig profilierten Stachelscheiben aus Bronze
waren gemeinsam mit den beiden großen Brustpanzerscheiben auf einem
einzigartig vollständigem Lederpanzer (Koller) montiert. Außerdem
befand sich im Kultdepot neben einem kugeligem und einem
brotleibförmigem Idol aus Ton noch ein Reibstein. Mittlere-späte
Bronzezeit, 14.-13. Jhd. v. Chr.

Folter war im Mittelalter keine Strafe und die Kammern dienten auch
nicht in erster Linie zum Töten. Meist nutzte man sie im Zuge eines
Strafverfahrens zur Erzwingung von Geständnissen. Dieses Vorgehen ist
heute natürlich verboten und ein Geständnis das unter Folter gemacht
wurde gilt als ungültig. Auf das Geständnis folgte dann natürlich meist
die Strafe die der Schwere des Vergehens angepasst war. So wurde einem
Dieb beispielsweise meist die Hand abgeschlagen mit der er gestohlen
hatte. Schwerere Verbrechen verlangten wiederum die Todesstrafe. Diese
konnte sehr unterschiedlich ausfallen, war jedoch immer ein
öffentliches Ereignis. Sie fanden am zentralen Platz eines Dorfes oder
einer Stadt statt und man ging dorthin um sich zu unterhalten. Denn die
Bauern und Handwerker waren meist sehr arm und ihr Tag bestand fast
ausschließlich aus Arbeit. So war dieses Spektakel eine willkommene
Abwechslung. Man gab sich daher auch große Mühe Hinrichtungen möglichst
spektakulär aussehen zu lassen und diese sehr lange hinzuziehen. So kam
es das sich verurteilte Straftäter oftmals die „Köpfung" wünschten, da
man dabei keine Schmerzen leiden musste und sie schnell vorbei war.

Der älteste Teil der Burg Deutschlandsberg (die sogenannte Kernburg)
bestand ursprünglich aus einem mehreckigen (polygonalen) Turm, der
Ringmauer, einem Palas sowie einer Kapelle, die den innersten
Burggraben an seinem Ende begrenzte. Dieser ursprünglich zentrale Teil
der romanischen Kernburg dürfte im Hochmittelalter, in der Zeit des
Salzburger Erzbischofs Konrad I. um die Mitte des 12. Jahrhunderts
errichtet worden sein. Der unregelmäßig siebeneckige Grundriss des
Turmes folgte dabei dem natürlichen Burgfelsen, der den inneren Burghof
um etwa 4 m Höhe überragte. Als vorerst letzte Etappe der
archäologischen und bauhistorischen Erforschung der Burg erfolgten in
den Jahren 2015 bis 2017 Untersuchungen im romanischen Hof und dem
Wirtschaftstrakt im Süden der Kernburg. Die dort gemachten Funde wie
Keramik, Knochen oder unterschiedliche Kleinfunde aus Metall beleuchten
die Baugeschichte und geben einen Einblick in das Leben auf der
mittelalterlichen Burg Deutschlandsberg.
Eckdaten
um 4300-3300 v. Chr. Erste sesshafte Bauern der Jungsteinzeit und der
Kupferzeit (sog. Lasinja-Kultur) errichten eine Niederlassung am
Burgberg.
1000 v. Chr.-500 n. Chr. Urnenfelderzeitliche, keltische (latènezeitliche) und römische Funde belegen eine Besiedelung des
10./11. Jh. Die ersten noch aus Holz bestehenden Teile einer Befestigung im Bereich des Burgfelsens werden erbaut.
1153 Friedrich von Lonsperg als Ministeriale des Erzbistums Salzburg
wird in einer Urkunde genannt (die Lonsperger waren ein
Ministerialiengeschlecht aus dem Chiemgau, welches an der Kolonisation
der Weststeiermark maßgeblich beteiligt gewesen sein dürfte und die
Burg als Belohnung für ihre treuen Dienste erhielt).
12. Jh. Die erste aus Stein bestehende Burg wird gebaut: Am höchsten
Punkt wird ein mehreckiger (polygonaler) Bergfried errichtet, weiters
vermutlich auch eine erste Kapelle sowie eine Ringmauer. Die
Bautätigkeit könnte bereits in der Zeit von Erzbischof Konrad I.
(Bischof der Jahre 1106-1147) eingesetzt haben.
1291/92 Deutschlandsberger Bund: Der Salzburger Erzbischof Konrad IV.
verbündet sich mit mehreren steirischen Adeligen gegen den
Landesfürsten Herzog Albrecht I. Dieser Privilegienstreit, welcher fast
zu militärischen Auseinandersetzungen führte, konnte schlussendlich
durch diplomatisches Geschick gelöst werden.
14. Jh. Monumentaler Ausbau der Burg: Die Kernburg erhielt mit der
Errichtung von Wohnturm, Gadenbau und Palas eine neue und bis heute
prägende Erscheinungsform.
1479-1490 Baumkircherfehde, Türkeneinfall und Ungarneinfälle unter
Matthias Corvinus. Die Ungarn besetzten mehrere Salzburgische Festungen
und hielten diese bis zum Tode von Matthias Corvinus, danach konnte der
Kaiser die Gebiete zurückerobern und kam somit in den Besitz der
Salzburgischen Festungen.
15. Jh. Der romanische Hof westlich des polygonalen Turms wird
aufgegeben und lediglich für die Ablagerung von Schutt und Abfällen
genutzt,
1481 Hans von Lonsperg, der letzte der Familie, die über zehn
Generationen die Burg und ihre zugehörigen Besitzungen innehatten,
verstirbt.
1494 Das Erzbistum Salzburg kann nach zähen Verhandlungen den Großtell seiner Besitzungen zurückholen.
1535 Es kommt zu einem Vertrag, in welchem das Erzbistum wichtige Rechtsprivilegien einbüßte.
1595 Die Burg wird von Erzbischof Wolf-Dietrich von Raitenau an Hans
Jakob von Kuenburg. einen langjährigen Getreuen des Erzbistums
veräußert.
1600 Unter Hans Jakob von Khuenburg kommt es zu einem massiven Ausbau
der Burg. Die gesamte Vorburg wird errichtet sowie Veränderungen im
Bereich der Kernburg durchgeführt.
1608 Errichtung einer Kapelle, die dem Hl. Rupert geweiht war. (die aus
Stuck gefertigte Altardekoration wurde bel den Ausgrabungen in
Versturzlage gefunden).
1635 Die Herrschaft Landsberg wird wieder dem Erzbistum einverleibt.
Sie verblieb in Salzburger Besitz bis zur Säkularisierung des
Erzbistums im Jahr 1803.
1804 Übernahme durch den Staat.
1811 Graf Moritz von Fries übernimmt die Herrschaft Landsberg.
1820 Die Herrschaft geht an den Fürsten Liechtenstein.
1876 Partieller Abriss des runden Turms und Sprengung des polygonalen Turms durch den Fürsten Liechtenstein.
1932 Die Stadtgemeinde Deutschlandsberg kauft die Burg.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: