web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Dresden
Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, September 2024
Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen. Mit rund 570.000 Einwohnern ist die an der Elbe gelegene kreisfreie Stadt Dresden, nach Leipzig, die zweitgrößte sächsische Kommune und die zwölftgrößte Stadt Deutschlands.

Wie der Zufall so will, ist kurz vor meiner Anreise am 11. September
2024 um 6 Uhr früh die Carolabrücke eingestürzt. Auch für
morgensportliche Dresdner ein beliebtes Fotomotiv.

Das Sächsisches Ständehaus ist
ein ehemaliges Parlamentsgebäude am Schloßplatz in Dresden. Der
Neubarockbau wurde 1901 bis 1907 durch König Albert von Paul Wallot für
den Sächsischen Landtag geschaffen. Es ist heute Sitz des Landesamts
für Denkmalpflege Sachsen und des Oberlandesgerichts Dresden.

Denkmal „Friedrich August dem Gerechten“ beim Georgentor am Schlossplatz
Das Georgentor oder der
Georgenbau ist der ursprüngliche Stadtausgang von Dresden zur
Elbbrücke. Er liegt in der Inneren Altstadt am Schloßplatz zwischen dem
Residenzschloss und dem Stallhof. Dieser erste Renaissancebau in
Dresden wurde von Georg dem Bärtigen veranlasst, der das ehemalige
Stadttor zur damals einzigen Dresdner Elbbrücke von 1530 bis 1535 zum
Georgentor umbauen ließ. Der Bau besticht heute durch seine
repräsentative Fassade im monumentalen Neorenaissancestil.

Die Augustusbrücke ist eine
Brücke über die Elbe in Dresden und verbindet die historischen Kerne
der Altstadt und der Neustadt, die bis ins 16. Jahrhundert die
selbstständige Stadt Altendresden war. Ursprünglich war sie der größte
Brückenbau des deutschen Hochmittelalters sowie eines der größten
mittelalterlichen Verkehrsbauwerke Europas. Unter August dem Starken
wurde die Brücke durch Matthäus Daniel Pöppelmann grundlegend
umgestaltet und zwischen 1907 und 1910 durch einen Neubau von Hermann
Klette und Wilhelm Kreis ersetzt.
Augustusbrücke über die Elbe mit Altstadtensemble: Ständehaus,
Georgentor/Georgenbau, Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener
Hofkirche)

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK Dresden, auch
Kunsthochschule Dresden oder Kunstakademie Dresden genannt) wurde 1764
gegründet und ist damit eine der ältesten Kunsthochschulen
Deutschlands. An exponierter Stelle der Stadt, an der Brühlschen
Terrasse, gleich neben der Frauenkirche, steht die Kunstakademie,
eines der drei Gebäude der heutigen Hochschule für Bildende Künste
Dresden. Constantin Lipsius entwarf den Vierflügelbau, der 1887 bis
1894 im Stil des Historismus errichtet wurde. Wegen seiner
Monumentalität in der Stadt war er in dieser exponierten Lage
umstritten. In dem Gebäude, dessen Glaskuppel wegen ihrer Form auch als
Zitronenpresse bekannt ist, war neben der Kunstakademie das
Ausstellungsgebäude des Sächsischen Kunstvereins untergebracht, seit
2005 wird es von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Kunsthalle
genutzt.
Hochschule für Bildende Künste Dresden mit Brühlsche Terrasse

Als Goldener Reiter wird das
Reiterstandbild Augusts des Starken auf dem Neustädter Markt in Dresden
bezeichnet. Es befindet sich in der Mittelachse der Hauptstraße und der
Neustädter Wache. Der Goldene Reiter gilt als das bekannteste Denkmal
Dresdens und gehört zu den bedeutendsten Skulpturen des Dresdner
Barock. Die Statue zeigt August den Starken, Kurfürst von Sachsen und
König von Polen, als römischen Caesar mit Rüstung in nordöstlicher
Richtung zum polnischen Königreich auf einem courbettierenden Hengst
reitend.
Die Inschriften auf dem Sockel des Reiterstandbilds lauten:
„Friedrich August I. Herzog von Sachsen, Kurfürst und Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches, König von Polen. August II.“
Goldener Reiter - Berühmte, mit Blattgold belegte Statue von König August II. als römischer Caesar zu Pferde.

Die Fahnenmasten mit ihren Sockeln und Reliefs zeigen Kaiser Wilhelm I.
sowie den sächsischen König Albert. Errichtet wurden sie 1893 zum
Gedenken an den Besuch des Kaisers in Dresden auf der Hauptstraße.
Fahnenmasten in Gedenken an Kaiser Wilhelm I und König Albert säumen die Hauptstraße.

So bunt ist Dresden
Hier bei LOUISE - Haus für Kinder, Jugendliche und Familien - Malwina e.V. in der Louisenstraße 41

Kunsthofpassage Dresden - Komplex aus originell gestalteten Innenhöfen mit Cafés im Freien, Künstlerateliers und unabhängigen Boutiquen.
Der Hof der Elemente besteht aus einer blaufarbenen Fassade mit
Regenrohren (Element Wasser) und einer gelben Fassade mit Alublechen
(Element Licht) an der Westseite des Hofes. Geschaffen wurde die
Gestaltung von den Künstlern Annette Paul, Christoph Roßner und André
Tempel, die sich dabei in St. Petersburg „von der bizarren Architektur
der Fallrohre“ inspirieren ließen.

Die Kunsthofpassage ist eine Passage, bestehend aus fünf einzelnen
Höfen, in der Äußeren Neustadt in Dresden, beginnend im Haus Görlitzer
Straße 25, und die bis zur Alaunstraße 70 reicht. Dieser wurde nach
Plänen der Architekten MüllerMüller, Knerer und Lang, Heike Böttcher
und Meyer Bassin (alle Dresden) gestaltet und 2001 fertiggestellt.

Ausblick über Park Elbewiesen
Die Elbwiesen in Dresden bilden das Ufer der Elbe und ziehen sich, mit
Ausnahme der Brühlschen Terrasse und des davor gelegenen Terrassenufers
sowie der Neuen Terrasse am Landtag, quer durch die Stadt. Es ergibt
sich eine Gesamtlänge der Elbwiesen von etwa 30 Kilometern auf beiden
Flussseiten. Ihre Breite schwankt zwischen wenigen Metern unterhalb der
Elbschlösser, wo die Elbe dicht an den Elbhang heranrückt, und bis zu
400 Metern am gegenüberliegenden Ufer.

Das Lingnerschloss, eigentlich
Villa Stockhausen, ist das geografisch mittlere der drei Elbschlösser
in Dresden. An zentraler Stelle des ehemaligen Weltkulturerbes Dresdner
Elbtal (2004–2009) gelegen, bietet seine Terrasse einen imposanten
Ausblick auf einen großen Teil des Areals und es wurde als Sitz des
Welterbezentrums ausgewählt. Die Bezeichnung „Lingnerschloss“
(umgangssprachlich vergeben nach dem bekanntesten ehemaligen Eigentümer
und Bewohner des Gebäudes, Karl August Lingner, dem Erfinder des
Odol-Mundwassers) ist heute gebräuchlicher als der ursprüngliche Name
„Villa Stockhausen“.

Lingnerschloss Südseite
Die Villa wurde von 1850 bis 1853 im Auftrag des Prinzen Albrecht von
Preußen im Zusammenhang von dessen zweiter Eheschließung mit Rosalie
Gräfin von Hohenau geborene von Rauch auf einem der
Weinbergsgrundstücke erbaut, die zuvor seit 1803 im Besitz des
schottischen Adligen James Ogilvy, 7. Earl of Findlater gewesen waren.
Sie war als Wohnsitz für Friedrich Ludwig Albert Freiherr von
Stockhausen-Immenhausen (1810–1855) bestimmt, Sohn von Johann Karl
Friedrich Ludwig von Stockhausen und Kammerherr des Prinzen. Bis zur
Fertigstellung seines eigenen Anwesens, des benachbarten Schlosses
Albrechtsberg, wohnte der Prinz selbst in dem Gebäude. Landbaumeister Adolph Lohse war der Architekt des klassizistischen
Baus. Er gestaltete auch die Innenräume. Um das Schloss wurde ein Park
angelegt. Auch ein Weinberg gehörte zum Areal.

Lingners Weingarten an der Elbe und Park Elbewiesen
Die Dresdner Elbhänge sind ein
kulturlandschaftlicher Raum in Dresden. Sie bilden den nordöstlichen
Rand des Elbtalkessels. Lange Zeit waren sie auch die Stadtgrenze
Dresdens und markieren seit der Eingemeindung weiterer Flächen oberhalb
der Hänge einen Übergang von dicht besiedelten Stadtteilen zu den
ländlichen Ortschaften Dresdens.

Schloss Eckberg ist eines der
drei Elbschlösser und befindet sich am rechten Elbhang in Dresden, etwa
3 Kilometer elbaufwärts vom Stadtzentrum entfernt. Westlich von Schloss
Eckberg befindet sich das Lingnerschloss und neben diesem das Schloss
Albrechtsberg.

Sonnenanbeter Skulptur am Schloss Eckberg
Diese Bronzeplastik eines Sonnenanbeters steht auf der Terrasse von
Schloss Eckberg und blickt von dort in das Elbtal hinab. Das Kunstwerk
wurde von Sascha Schneider (1870-1927) geschaffen.

Schloss Eckberg von Südosten
Das Schloss Eckberg entstand
von 1859 bis 1861 im Auftrag des Großkaufmanns Johann Daniel Souchay,
so dass es damals im Volksmund Villa Souchay genannt wurde. Souchay
verwendete einen Teil seines großen Vermögens, das er im Textilhandel
in Manchester erworben hatte, für Wohltätigkeitsstiftungen in Loschwitz
und erwarb sich um die Entwicklung dieses Ortes große Verdienste. Mit
dem Erwerb des Loschwitzer Weinberges Eckberg entschied sich Souchay im
Jahr 1859, seinen Lebensmittelpunkt in das Dresdner Elbtal zu verlegen.
In seinem Auftrag errichtete der Semper-Schüler Christian Friedrich
Arnold an Stelle des 1675 auf dem Eckberg errichteten Klengelschen
Landhauses den reich gegliederten neugotischen Schlossbau. Ihm sollen
dabei etliche Landsitze und Landschaftsparks (Tudorstil) als Vorbild
gedient haben. Mit der Gestaltung seines 15 Hektar großen
Landschaftsgartens betraute Johann Daniel Souchay den preußischen
Obergärtner Hermann Sigismund Neumann, der einige Jahre zuvor für die
Anlage der Gärten im benachbarten Schloss Albrechtsberg und Villa
Stockhausen (Lingnerschloss) nach Dresden geholt worden war.
Gleichzeitig mit dem Schloss entstanden an der Bautzner Straße
zahlreiche Nebengebäude, unter anderem Pferdeställe, Remise,
Gärtnerhaus und ein großes neugotisches Gewächshaus.

Das Schloss Albrechtsberg in
Dresden, gelegentlich auch Albrechtsschloss genannt, ist eines der drei
Elbschlösser am rechten Elbufer im Stadtbezirk Loschwitz. Es wurde
zwischen 1850 und 1854 von Adolf Lohse erbaut für Prinz Albrecht von
Preußen (1809–1872), den jüngsten Bruder der preußischen Könige
Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. (ab 1871 auch deutscher Kaiser).
Der spätklassizistische Bau in der Tradition Karl Friedrich Schinkels
ist das repräsentativste der drei Elbschlösser. 1925 wurde es von den
Grafen von Hohenau, den Nachkommen und Erben des Prinzen Albrecht aus
dessen zweiter Ehe, an die Stadt Dresden verkauft. Die Zerstörungen
Dresdens 1945 betrafen das Schloss nicht. Nach zwischenzeitlicher
Nutzung durch die SMAD-Verwaltung in Dresden sowie als Hotel wurde es
bis 1990 Pionierpalast. Seit 1990 wieder an die Stadt Dresden
rückübertragen dient es heute vorwiegend kulturell-künstlerischer
Nutzung.

Bereits 1850 hatte Prinz Albrecht auf Vermittlung der Ehefrau seines
Kammerherren, Leutnant Albert von Stockhausen, den Findlater’schen
Weinberg von der Mordgrundbrücke bis zur Saloppe in Dresden gekauft.
Auf den Grundmauern des abgebrochenen Kaffeehauses sollte nunmehr ein
angemessenes Prinzenschloss entstehen. Es sollte ein preußisches
Schloss werden, so die Idee, am Bau waren ausschließlich preußische
Architekten und Bauleute (mit Ausnahme der Fundamentgründung)
beteiligt, auch das Material dafür wurde aus Preußen beschafft. Als
Architekt wurde der Berliner Schinkelschüler und Landbaumeister Adolph
Lohse gewonnen.

Schloss Albrechtsberg Südseite
Der spätklassizistische Bau Adolf Lohses (1807–1867), eines Schülers
Schinkels, hatte die Belvedere-Planungen für Potsdam (Schloss) und die
Villa d’Este bei Rom (Terrassen) zum Vorbild. Das Schloss wirkt „wie
ein Exot in der überwiegend barocken Architekturlandschaft Dresdens“.
„Es liegt die Vermutung nahe, dass die ursprüngliche Idee zum
Albrechtsberg-Komplex auf Entwürfe des Königs Friedrich Wilhelm IV. für
das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg bei Potsdam … zurückzuführen
ist."

Brunnen „Stille Wasser“ (1894; Robert Diez) am Albertplatz
Stille Wasser und Stürmische Wogen ist eine Zwillingsbrunnenanlage auf
dem Albertplatz in Dresden. Sie wurde von 1883 bis 1894 von Robert Diez
geschaffen und steht unter Denkmalschutz.
Das runde Granitbecken hat einen Durchmesser von 18 Metern. In ihm
befindet sich eine im Durchmesser 7,20 Meter große Steinschale, in der
sich wiederum die Brunnenplastik auf erhöhtem Sockel befindet. Über
kurzem Schaft erhebt sich mittig in rund fünf Metern Höhe wiederum eine
Brunnenschale, die einen Durchmesser von rund fünf Metern hat. Der
Schaft ist mit figürlichem, überlebensgroßem Schmuck versehen, den Diez
„in edelstem Wahlnaturalismus geschaffen“ hat. Auch die Unterseite der
oberen Brunnenschale trägt reichen künstlerischen Schmuck. Die Brunnen
bestehen aus Bronze, die mit grüner Patina überzogen wurden. Das
Brunnenbecken wurde aus Granit gefertigt.
Stille Wasser zeigt elf überlebensgroße Figuren. Die Figuren sind in vier Gruppen unterteilt (im Uhrzeigersinn):
Loreley mit Leier
Perle und Nymphe – eine Nymphe
trägt als Perle des Meeres ein junges Mädchen aus dem Wasser empor,
eine Nymphe mit Lilie sitzt dabei
Meerweib und Nixe (Najadengruppe) – ein Meerweib scherzt mit einem Nixen
Wasserrose und schlafender
Knabe (Gruppe des Schlafes) – eine schlafende Nymphe wird von einem
Mädchen (als Libelle) und einem Jungen (als Schmetterling) umgarnt, zu
ihren Füßen ein schlafender Knabe
Ergänzt werden die Gruppen, die „ungezwungen miteinander in Beziehung“
stehen, durch Putten sowie (langsame) Wassertiere, wie zum Beispiel
Schildkröten, Frösche und kleine Fische.

Brunnen „Stürmische Wogen" (1894; Robert Diez) am Albertplatz
Beide Brunnen bieten ein vielfältiges Wasserspiel. Aus der obersten
Wasserschale steigt eine Fontäne rund zwei Meter in die Höhe – in den
Zeiten der Inbetriebnahme war die Fontäne mit rund sieben Metern
deutlich höher[4] – und ergießt sich in die Wasserschale. Von ihr läuft
das Wasser in die mittlere Brunnenschale, wobei die Figurengruppen am
Schaft in einen Wasserschleier eingehüllt werden bzw. wie hinter einem
Wasservorhang liegen. Vom Rand des Hauptbeckens gehen zudem 56 in
gleichmäßigem Abstand voneinander liegende Wasserstrahlen in das
mittlere Becken. „Die Wirkung war überraschend schön“, so schrieben
Zeitungen anlässlich der Brunneneinweihung.[16] Andere Blätter wiesen
auf den großen Wasserverbrauch der Brunnen hin, der in der Stunde bis
zu 250 Kubikmeter betrage
Auch der Brunnen Stürmische Wogen besteht aus verschiedenen Figurengruppen (im Uhrzeigersinn):
Sturmgruppe – Sturm mit Schlangenpeitsche rast auf seinem Ross über das Meer
Tritonengruppe – Kampf von Tritonen gegen Seeungeheuer (Geheul der Brandung)
Kampf zweier Fischmenschen um einen Seestern, der als junger Knabe von den Wogen emporgetragen wird
Stechergruppe – ein Nixe attackiert mit einer spitzen Muschel einen Wels
Ergänzt werden die Gruppen mit kleinen Details, darunter flüchtenden Echsen.

An der Stelle des Albert-Denkmals steht am Schloßplatz in Dresden seit
dem 29. Mai 2008 eine Skulptur von Ernst Rietschel, die den König Friedrich August I. „den Gerechten“
in sitzender Haltung zeigt. Das in der Kunst- und Glockengießerei
Lauchhammer gegossene Denkmal wurde 1843 im Zwinger aufgestellt und
geweiht, fand 1929 einen Platz am Japanischen Palais und erhielt auf
Bemühen der Stadt, der Sächsischen Akademie der Künste und privater
Förderer 2008 seinen neuen Aufstellungsort vor dem Ständehaus auf dem
Schloßplatz. Zur Weihe am 29. Mai 2008 wurde jene Weih-Hymne gesungen,
die Richard Wagner anlässlich der Denkmalsenthüllung 1843 komponiert
hatte.

Die ehemalige Katholische Hofkirche (heute offiziell Kathedrale Ss. Trinitatis)
in Dresden, mit dem Patrozinium der heiligsten Dreifaltigkeit
(Sanctissimae Trinitatis), ist die Kathedrale des Bistums
Dresden-Meißen und eine Stadtpfarrkirche Dresdens. Mit der
Wettinergruft beherbergt sie außerdem die historische Grabstätte der
Kurfürsten und Könige von Sachsen.
Die Hofkirche wurde unter Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen von
Gaetano Chiaveri von 1739 bis 1751 im Stil des Barock errichtet. Im
Jahr 1964 zur Konkathedrale erhoben, wurde sie 1980 durch die Verlegung
des Bischofssitzes von Bautzen nach Dresden zur Kathedrale des Bistums
Dresden-Meißen. Als ehemalige sächsische Hofkirche ist sie durch einen
Übergang über die Chiaverigasse mit dem Residenzschloss verbunden. Sie
steht am Altstädter Elbufer zwischen Schloss- und Theaterplatz. Ihre
Planung begann ein Jahrzehnt nach dem Baubeginn der evangelischen
Frauenkirche, die 300 Meter entfernt den Neumarkt prägt. Eigentümer des
Kirchgebäudes ist heute der Freistaat Sachsen. Von der Ausstattung sind
das monumentale Altargemälde von Anton Raphael Mengs, die barocke
Kanzel von Balthasar Permoser und die erhaltene Silbermann-Orgel
hervorzuheben.

Den Hochaltar schufen die
Gebrüder Aglio aus Marmor und vergoldeten Bronzeornamenten. Darüber
befindet sich das Altargemälde, 1752 bis 1761 vom Dresdner Hofmaler
Anton Raphael Mengs geschaffen, das die Himmelfahrt Jesu Christi
darstellt und mit 10 Metern Höhe und 4,50 Metern Breite beachtliche
Ausmaße besitzt. Das 1752 in Rom begonnene Gemälde kam 1765 nach
Dresden. Der Hofgaleriebildhauer Joseph Deibel gestaltete dessen Rahmen.
Das Bild ist in der Senkrechten gegliedert durch einen starken Kontrast
zwischen eher kühlen, dunklen Farben bei den beobachtenden
Jünger(inne)n sowie gelben, goldenen und weißen Schattierungen im die
Dreifaltigkeit symbolisierenden oberen Teil. Gott Vater, Geist (Taube
als hellster Punkt des Gemäldes) und Sohn bilden eine Achse. Während
Maria und die Jünger verehrend oder erregt nach oben sehen, ist die
Geste Johannes’ spannungsvoll (hier werden traditionell der Apostel und
Evangelist – Buch im linken Arm – identifiziert). Der Blick nach oben
und das Knien auf dem Boden kreuzen sich mit der ausgestreckten und
nach unten zeigenden Hand, als wollte Mengs daran erinnern, bei aller
Verherrlichung Christi den Bezug zur Erde, auf den Menschen Jesus,
nicht zu vergessen. Ein auf der Spitze stehendes Dreieck in der oberen
Bildhälfte korrespondiert mit einem durch die Jünger und Jesus
gebildeten Dreieck, dessen Basis durch den Arm Johannes’ markiert wird.
Das 4,20 Meter hohe Kruzifix sowie die sechs Silberleuchter sind eine
Arbeit des Augsburgers Joseph Ignaz Bauer.

In der Hofkirche befindet sich eine von Gottfried Silbermann
konzipierte Orgel, die von seinen Schülern fertig gebaut wurde. Sie ist
das späteste und zugleich einzige erhaltene der ehemals vier Werke des
Meisters in Dresden. Zwei Wochen nach Abschluss des Bauvertrags am 22.
Juli 1750 über den – nach Ermutigung Silbermanns durch den König – sehr
hohen Preis von 20 000 Talern übertrug der an Gicht schwer erkrankte
Silbermann die Bauleitung seinem Schüler und Mitarbeiter Zacharias
Hildebrandt.
Die Silbermann-Orgel umfasst 47
Register auf 3 Manualen und Pedal und hat etwa 3000 Pfeifen.
Ursprünglich waren 66 Register vorgesehen. Das Brustwerk befindet sich
über dem Spieltisch, darüber, über dem den gesamten Prospekt
durchziehenden Sims steht das Hauptwerk. Hinter dem oberen Teil der
Prospektpfeifen des Principal 16′ des Hauptwerks ist das Oberwerk
aufgestellt. Die Pedalregister befinden sich im hinteren Teil der
Orgel, hinter dem Hauptwerk.

Besonders erwähnenswert ist die geschnitzte Barockkanzel
von Balthasar Permoser, die bereits 1712 für die Alte Hofkirche im
Opernhaus geschaffen wurde und für die Johann Joseph Hackl, von dem
auch die Schnitzereien der Beichtstühle stammen, nach der
Translozierung in die Hofkirche 1748 den Schalldeckel schuf. Die
Schnitzwerke erhielten einen Anstrich aus weißem Alabasterlack.

Im linken Seitenschiff befindet sich der Märtyreraltar
mit den Urnen der drei Märtyrer Alois Andritzki, Bernhard Wensch und
Aloys Scholze, deren Asche am 5. Februar 2011 in einer Prozession vom
Alten Katholischen Friedhof hierher überführt wurde. Anschließend wurde
am 13. Juni desselben Jahres Alois Andritzki in einem Pontifikalamt vor
der Kathedrale seliggesprochen.

Bis 1918 diente das Gotteshaus als Hof- und Pfarrkirche zugleich. Beim
Luftangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 wurde es stark zerstört.
Bereits seit Juni 1945 feierte man in der Bennokapelle, später im
linken Seitenschiff die Heilige Messe. 1962 konnte das Hauptschiff
wieder genutzt werden. 1980 wurde die Hofkirche zur Kathedrale des
Bistums Dresden-Meißen erhoben.
Drei der prächtig gestalteten Eckkapellen wurden fast originalgetreu
restauriert. Eine Ausnahme bildet die Kapelle zum Gedächtnis der Opfer
im 2. Weltkrieg. Friedrich Press schuf dafür die Pieta, das Bild der
Schmerzensmutter Maria.


Die Bilder der Seitenaltäre „Josephs Traum“ und „Sieg der christlichen Religion“ stammen von Anton Raphael Mengs.


Die Gedächtniskapelle -
Ursprünglich war die Kapelle dem böhmischen Heiligen Johann Nepomuk
geweiht. Seit 1976 dient sie dem Gedächtnis der Opfer des
Bombenangriffs auf Dresden am 13. Februar 1945 und aller ungerechten
Gewalt. Der Dresdner Bildhauer Friedrich Press schuf mit dem Bild der
Schmerzensmutter Maria, die ihren toten Sohn auf dem Schoß hält, ein
beeindruckendes Mahnmal millionenfachen Leides. In den Händen hält
Maria die Trümmer des Krieges, die sich zu einer Dornenkrone
zusammensetzen. Die klaffende Herzwunde Jesu kündet von seiner Liebe,
die uns trotz Krieg und Hass von Schuld freispricht und Versöhnung
anbietet. Der frei im Raum stehende Blockaltar zeigt das brennende
Dresden. Beide Kunstwerke schuf Friedrich Press aus Meißner Porzellan.

Der Fürstenzug in Dresden ist
ein überlebensgroßes Bild eines Reiterzuges, aufgetragen auf rund
23.000 Fliesen aus Meißner Porzellan. Das 102 Meter lange, als größtes
Porzellanwandbild der Welt geltende Kunstwerk stellt die Ahnengalerie
der zwischen 1127 und 1873 in Sachsen herrschenden 34 Markgrafen,
Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Geschlecht des Fürstenhauses
Wettin dar. Rechnet man jedoch noch den am Schluss des Zuges reitenden
Prinzen Georg hinzu, der später auch König war, dann ergibt sich eine
Gesamtzahl von 35 Herrschern der Wettiner, die im Reiterzug zu sehen
sind.
Der Fürstenzug befindet sich in der Augustusstraße, unweit der
Frauenkirche, zwischen Georgentor auf der einen Seite und dem Johanneum
auf der anderen Seite. Hier wurde er in der heutigen Form im Jahre 1907
auf der Außenseite des Stallhofs vom Dresdner Residenzschloss
angebracht.

Der Fürstenzug von Markgraf Konrad dem Großen im 12. Jahrhundert (links) bis König Georg Anfang des 20. Jahrhunderts (rechts)
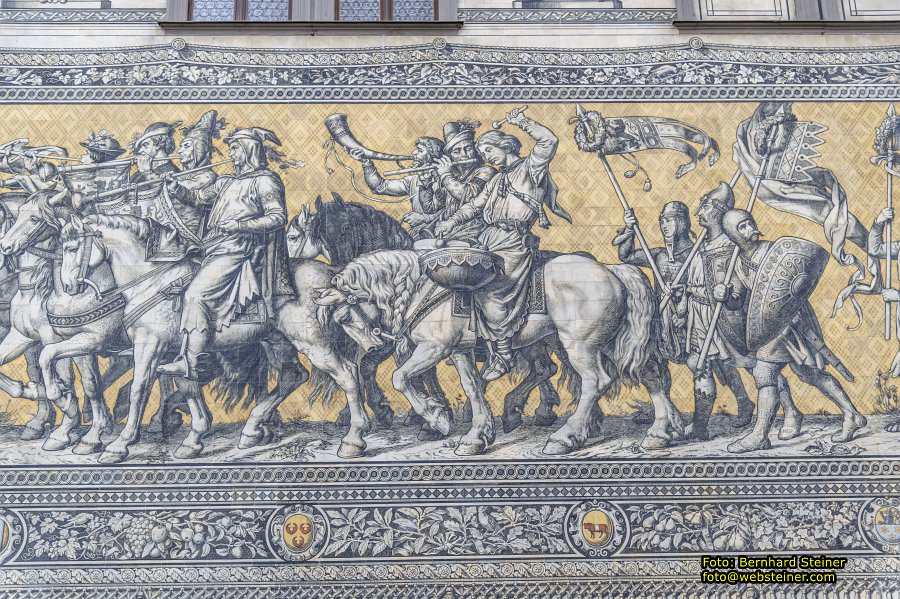
Die Frauenkirche (offiziell:
Kirche Unserer Lieben Frauen) ist ein evangelischer Sakralbau am
Neumarkt in Dresden. Der 91 Meter hohe Kuppelbau wurde 1726 bis 1743
durch den Rat der Stadt von George Bähr geschaffen. Nach der Zerstörung
1945 blieb die Frauenkirche eine Ruine, bevor sie 1993 bis 2005
wiederaufgebaut wurde. Sie gehört zu den bekanntesten
Sehenswürdigkeiten der Stadt und zu den bedeutendsten Bauwerken des
Barock.
Vor der Frauenkirche steht ein großes Martin-Luther-Standbild,
eine bronzene Skulptur von Adolf von Donndorf, die 1885 in der Dresdner
Kunstgießerei C. Albert Bierling gegossen und an dieser Stelle
aufgestellt wurde. Die Bronze fiel 1945 durch die Luftangriffe auf
Dresden um und wurde an selber Stelle wieder aufgestellt.
Frauenkirche Dresden - Im 2. Weltkrieg zerstörte und 2005 erneut geweihte Barockkirche

Altar und Orgel sind harmonisch
übereinander gesetzt und gehen optisch nahezu ineinander über. Der
eigentliche Altar von Johann Christian Feige, bzw. sein Kernstück, das
nach dem Krieg eingemauert wurde, wurde aus den Trümmern der alten
Frauenkirche geborgen und bewusst mit seinen Beschädigungen im Neubau
wiederverwendet. Er bildet in seiner optischen Rohheit einen Kontrast
zum sonst üppigen Dresdner Barock der Kirche und somit ein dauerhaftes
Mahnmal. In der größeren figürlichen Ebene des Altars sind neben der
zentralen Szene mit Jesus am Ölberg zwei Personen des Neuen und zwei
Personen des Alten Testamentes dargestellt: Ganz links Mose mit den
Gesetzestafeln, in der Mitte links Paulus mit Schwert und Buch, in der
Mitte rechts Philippus mit dem Kreuz und ganz rechts Moses Bruder Aaron
mit Brustpanzer und Weihrauchfass als Priester. Über Mose und Paulus
trägt ein Engel eine Kette aus Weizenähren und über Philippus und Aaron
ein weiterer Engel eine Kette aus Weintrauben. Zusammen stehen sie für
Brot und Wein bzw. Leib und Blut Christi und das Abendmahl. Links über
Jesus befinden sich ein großer und ein kleiner Engel. Rechts neben ihm
sind die schlafenden Jünger (farblos) dargestellt. Rechts über Jesus
ist Jerusalem zu erkennen. Direkt über Jesus ist ein Engel mit einem
Kreuz zu sehen – ein Hinweis auf die Art des kommenden Todes. Direkt
darüber und über allem thront das Auge Gottes, auch Auge der Vorsehung
genannt. Es ist, wie im Barock üblich, von Wolken umgeben. Darüber
wiederum schließt sich die Balustrade der Orgel an.
Gottfried Silbermann erbaute 1732 bis 1736 eine dreimanualige Orgel mit
43 Registern. Johann Sebastian Bach gab am 1. Dezember 1736 ein
zweistündiges Konzert auf der neuen Silbermann-Orgel und bedankte sich
damit für den ihm verliehenen Titel „Hofkompositeur“. Die Zerstörung
erfolgte bei Luftangriffe auf Dresden 1945.
Die neue Kern-Orgel von 2005 hat 4876 Pfeifen, 67 Register auf vier
Manualen und Pedal und wurde im September 2005 fertiggestellt. Im
oberen Teil des Orgelprospekts der Frauenkirche befinden sich die
beiden Posaunenengel des Bildhauers Quirin Roth, die den beiden
Dresdner Literaten Kurt Martens und Victor Klemperer gewidmet sind.

Am 13. April 2004 wurde der letzte Stein der Hauptkuppel der
Frauenkirche eingesetzt. Die Frauenkirche hat eine Länge von 50,02
Metern (West-Ost-Richtung) und eine Breite von 41,96 Metern
(Nord-Süd-Richtung). Ihre Gesamthöhe, einschließlich des Turmkreuzes,
beträgt 91,23 Meter. Im Innenraum reicht die Kuppeldecke bis zu einer
Höhe von 36,65 Meter. Die Kuppel ist, ohne den Kuppelanlauf und die
Laterne, 24 Meter hoch. Ihr Außendurchmesser beträgt 26,15 Meter, das
Kuppelmauerwerk ist zwischen 1,19 Meter und 1,75 Meter stark.
Die acht Gemälde in der Innenkuppel
wurden ursprünglich 1734 vom italienischen Theatermaler Giovanni
Battista Grone geschaffen. Sie stellten die Evangelisten Lukas,
Matthäus, Markus und Johannes sowie Bildnisse der christlichen Tugenden
Glaube, Hoffnung, Liebe und Barmherzigkeit dar. Ein erster
Rekonstruktionsversuch schlug fehl, der Evangelist Johannes geriet zu
bunt. Nach langem Auswahlverfahren bekam daraufhin der Maler Christoph
Wetzel den Auftrag, die Innenkuppelgemälde möglichst stilgetreu
wiederherzustellen. Als Vorlage für die acht Kuppelgemälde wurden
Aufnahmen des Historischen Farbdiaarchivs zur Wand- und Deckenmalerei
des Kunsthistorischen Zentralinstituts in München verwendet, die 1943
im Rahmen des „Führerauftrages Monumentalmalerei“ von der damals noch
intakten Frauenkirche erstellt worden waren.

Das Johanneum ist ein zwischen 1586 und 1888 errichtetes
Renaissancegebäude in Dresden. Es wurde ab dem 19. Jahrhundert nach
König Johann von Sachsen benannt und diente als Stallgebäude (Marstall)
ursprünglich der Unterbringung der kurfürstlichen Elite-Pferde und
ihrer Ausstattung. Als öffentlich zu besichtigendes Prunkgebäude war es
das erste Museum der Neuzeit. Es befindet sich am Neumarkt nahe der
Frauenkirche. An das Gebäude schließt sich der Stallhof, der einzige
noch original erhaltene Ringstechplatz Europas an, und der Lange Gang,
ein Verbindungsgang zum Schloss. Hinter dem Johanneum befand sich ab
1618 die erste Reithalle der Welt, die heute nicht mehr existiert.
Johanneum (1872-76; Karl Moritz Haenel)

Vor dem Hôtel de Saxe befindet sich ein weiteres Standbild zum Gedenken
an König Friedrich August II. Dieses wurde nach Entwürfen von Ernst
Hähnel um 1867 geschaffen.
Friedrich August II. (* 18. Mai 1797 in Weißensee, Kurfürstentum
Sachsen; † 9. August 1854 in Brennbichl in Tirol) aus dem Haus der
albertinischen Wettiner war von 1836 bis zu seinem Tode dritter König
von Sachsen.

Das Gottfried-Semper-Denkmal ist ein Denkmal in Dresden zum Gedächtnis
an den Architekten und Hochschullehrer Gottfried Semper (1803–1879),
als dessen bekanntestes und wichtigstes Werk in der sächsischen
Landeshauptstadt die nach ihm benannte Semperoper gilt. Das Denkmal
steht im Nordosten des Stadtteils Innere Altstadt auf der Brühlschen
Terrasse, einem Relikt der Dresdner Befestigungsanlagen. Direkt unter
ihm liegt der Eingang zum Museum Festung Dresden. Das
Gottfried-Semper-Denkmal befindet sich an der Straße Brühlscher Garten,
die nach der anliegenden gleichnamigen Grünfläche benannt ist.
Denkmal für Gottfried Semper (1892; Johannes Schilling)

Die Kunsthalle im Lipsius-Bau ist einer der Ausstellungsorte der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie befindet sich im als
Kunstakademie bekannten und kuppelgekrönten Lipsius-Bau an der
Brühlschen Terrasse, in dem auch die Hochschule für Bildende Künste
Dresden ihren Sitz hat. Dort liegt sie in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Albertinum in einem Flügel, der auch als Ausstellungsgebäude
Brühlsche Terrasse bezeichnet wird. Es ist ein Ort für
Sonderausstellungen, insbesondere für die Auseinandersetzung mit
zeitgenössischem Kunstschaffen.

Die 4,8 Meter hohe und 1,7 Tonnen schwere Fama (Pheme) auf der Spitze der Zitronenpresse.
Das Bauwerk Dresdner Kunstakademie wurde als unausgewogen und der
Dresdner Bautradition zuwider, der Fassadenschmuck als überladen und
die bald als Zitronenpresse verspottete Kuppel wegen ihrer
unmittelbaren Nachbarschaft zur Frauenkirche als störend kritisiert.

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) ist als
Kultusministerium eine Oberste Landesbehörde des Freistaates Sachsen
mit Sitz in der Landeshauptstadt Dresden. Es ist seit der Gründung des
Freistaates 1990 die oberste Schulbehörde. Das Ministerium befindet
sich im Westflügel des Gebäudes des Finanzministeriums am Carolaplatz 1
im Dresdner Regierungsviertel in der Inneren Neustadt.
Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Kunsthallenportal im Lipsius-Bau, von der Brühlschen Terrasse aus gesehen

Das Museum Festung Dresden, auch bekannt als Dresdner Kasematten, ist
ein 1992 eröffnetes Museum im erhaltenen Teil der Dresdner
Befestigungsanlagen am elbwärtigen Abschluss der Altstadt von Dresden.

Die Carolabrücke ist eine der
vier Elbbrücken in der Dresdner Innenstadt. Sie wird im Süden in der
Altstadt durch den Rathenauplatz und im Norden in der Inneren Neustadt
durch den Carolaplatz begrenzt. Am frühen Morgen des 11. September 2024
stürzte ein Teil der Brücke ein. Ein zur Ursache dieses Einsturzes in
Auftrag gegebenes Gutachten kommt zum Schluss, dass als Folgemaßnahme
die Brücke komplett abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden
muss.

Akademieportal der Kunstakademie (Dresden) mit Skulpturen der Bildenden Künste auf der Attika über dem Hauptportal

Die Augustusbrücke ist eine
Brücke über die Elbe in Dresden und verbindet die historischen Kerne
der Altstadt und der Neustadt. Die Firmen Philipp Holzmann und
Dyckerhoff & Widmann führten den Brückenbau von 1907 bis 1910 aus.
Das heutige Bauwerk besteht aus neun Bögen (statisch als
Dreigelenkbögen ausgelegt), von denen vier über Strompfeiler (bei
Normalwasserstand) getragen werden. Die Gesamtlänge des Bauwerks
beträgt etwa 390 Meter, die Bögen haben lichte Weiten von 17,6 bis 39,3
Meter. Die Breite der Brücke ist 18 Meter, in den Pfeilerkanzeln sind
es 25 Meter. An der Augustusbrücke wird sehr deutlich, wie stark sich
die Ufer am innerstädtischen Elbbogen unterscheiden. Auf Altstädter
Elbseite setzt die Brücke direkt am Prallhang an und führt bereits
unter dem dritten Bogen den Schiffsverkehr in der Fahrrinne. Im Norden
fällt das Ufer sehr flach ab, weshalb dort vier Bögen die Elbwiesen
überspannen.

Die Mattielli-Statuen auf der Hofkirche
Im Gegensatz zur inneren Ausstattung der Kirche ist das geistige
Programm des Kirchenäußeren erhalten geblieben. Der italienische
Bildhauer Lorenzo Mattielli (1688 - 1748) schuf in den Jahren 1738 bis
zu seinem Tod die 74 Heiligenstatuen und die vier allegorischen Figuren
Glaube, Hoffnung. Liebe und Gerechtigkeit am Turm, an den Fassaden und
auf den Balustraden. Vollendet wurde dieses gewaltige Werk von seinem
Sohn Francesco bis 1752 hauptsächlich mit den Statuen am Turm. Sie
bestimmen mit einer Größe von 3.50 Meter das äußere Bild der Hofkirche.
Als Material bediente sich Mattielli des Cottaer Sandsteins, der in der
Sächsischen Schweiz gebrochen wird.
Die Auswahl der Heiligen trafen Königin Maria Josepha, Gaetano Chiaveri
und vor allem Pater Ignaz Guarini, der Beichtvater des Königs. Neben
Aposteln und Kirchenvätern sind jene Frauen und Männer dargestellt, die
als Schutzpatrone für die sächsischen, habsburgischen, böhmischen und
polnischen Lande eine Bedeutung haben und im wettinischen Herrscherhaus
besonders verehrt wurden. Jeder der dargestellten Heiligen wurde in ein
bestimmtes Beziehungsfeld gesetzt, das heute nicht mehr in allen Teilen
erkennbar ist. Von den 78 Figuren wurden bei der Bombardierung der
Kirche am 13. Februar 1945 viele Statuen, vor allem der obersten
Attika, total zerstört oder bis zur Unkenntlichkeit beschädigt Die
Restaurierung bzw. Neuanfertigung vieler Figuren wurde im Jahr 2002
abgeschlossen.

Semperoper Dresden - Das ursprünglich 1841 errichtete Gebäude wurde 1869 nach einem Brand vom Originalarchitekten neu erbaut.
Die Semperoper in Dresden ist
die Spielstätte der Staatsoper Dresden, die als ehemalige königliche
Hofoper Sachsens eine lange geschichtliche Tradition hat. Die Oper
befindet sich am Theaterplatz im historischen Stadtkern von Dresden in
der Nähe der Elbe. Sie ist nach ihrem Architekten Gottfried Semper
benannt, der sie im Auftrag von König Johann 1871 bis 1878 im Stil der
Neurenaissance erbaute. Nach der Zerstörung 1945 wurde die Semperoper
1977 bis 1985 rekonstruiert.

Sein städtebaulich so wirkungsvoller Baukörper wird über dem
Hauptportal von einer bronzenen Panther-Quadriga mit Dionysos und
Ariadne von Johannes Schilling bekrönt. Die Westfassade der Hinterbühne
zieren das sächsische Wappen, die Figuren „Liebe“ und „Gerechtigkeit“
sowie eine Büste Gottfried Sempers. Neben dem Eingang stehen als
Statuen Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, in den
Seitennischen der Fassade William Shakespeare, Sophokles, Molière und
Euripides.

Der Wallpavillon ist der
bedeutendste Pavillon des Dresdner Zwingers. Das im Jahre 1715
errichtete Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg durch die Bombenangriffe
vom 13. und 14. Februar 1945 schwer beschädigt.
Mittelkartusche, links Venus und die Darstellung Augusts des Starken
als Paris mit polnischer Königskrone (Heermann), rechts Minerva und
Juno (Heermann), oben: Herkules (Permoser)

Der Zwinger ist ein höfischer
Orangerie-, Fest- und Sammlungsbau in Dresden, der nach einem früheren
Festungsteil benannt ist. Er wurde 1711 bis 1728 durch August den
Starken von Matthäus Daniel Pöppelmann und Balthasar Permoser
geschaffen. Mit dem Bau der Sempergalerie 1855 wandelte sich die offene
Dreiflügelanlage zur geschlossenen Vierflügelanlage. Nach der
Zerstörung 1945 wurde der Zwinger bis 1963 wiederaufgebaut und ist
seitdem Sitz des Mathematisch-Physikalischen Salons und der
Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Er gehört zu
den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und zu den bedeutendsten
Bauwerken des Barock.
Seit 2021 wird der Zwingerhof umfassend saniert. Durch zahlreiche
archäologische Funde verzögert sich die Bauzeit, die Ende 2024 enden
soll.

Zahlreiche Plastiken bevölkern die Außenansicht des Wallpavillons:
Hercules Saxonicus (Permoser), Prinz Paris mit drei Göttinnen
(Heermann), Vier Winde (Kirchner) sowie Juno und Jupiter (Thomae). Die
Originale befinden sich heute teilweise im Lapidarium.

Das Kronentor ist ein Pavillon
und neben dem Wallpavillon der bekannteste Teil und auf Abbildungen
häufig das Sinnbild des Dresdner Zwingers. Mit den zu beiden Seiten
anschließenden Langgalerien steht es mit seiner Front auf der alten
Festungsmauer; Tor und Galerien bilden zu ihr jedoch einen kleinen
Winkel. Das Kronentor ermöglichte über die Wallgrabenbrücke
ursprünglich den Zugang von außerhalb der Stadt durch die
Festungsmauer. Deswegen führte keine der Bedeutung des Baus
entsprechende Steinbrücke über den Zwingergraben zum Kronentor, sondern
nur ein schmaler hölzerner Steg, der im Falle eines Angriffs rasch
abzubauen gewesen wäre.

Der Glockenspielpavillon trägt
seinen Namen aufgrund des Glockenspiels aus Meissner Porzellan, welches
alle Viertelstunde gespielt wird. Er ist im Vergleich zum restlichen
Zwinger relativ jung, denn erst im Jahre 1728 wurde er hinzugefügt. Der
Bau wurde mehrmals beschädigt, so bei einem Brand 1849 und beim
Luftangriff 1945. Sein Reiz liegt an der Uhr in Richtung Zwingerhof,
die mit dem besonderen Glockenspiel ausgestattet ist. Neben den
Stundenschlagmelodien sind zusätzlich, je nach Jahreszeit zu
festgelegten Zeiten, weitere bekannte Melodien zu hören.

Ausblick vom Zwinger Deutscher Pavillon auf Grünes Gewölbe und Residenzschloss

Das ehemalige Fabrikgebäude der Zigarettenfabrik Yenidze
gehört zu den architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Dresden.
Es steht an der Weißeritzstraße am östlichen Rand der Friedrichstadt,
unweit des Kongresszentrums. Das von 1908 bis 1909 von Martin
Hammitzsch geplante Bauwerk hat eine Gesamthöhe von 62 Metern und wird
heute als Bürogebäude genutzt.

Als außergewöhnliches Baudenkmal wurde die Yenidze 1996 saniert; der
hintere Gebäudeteil wird seitdem für Büros benutzt. Im vorderen
„Kuppelteil“ befindet sich das Kuppelrestaurant mit dem höchsten
Biergarten Dresdens, der im Sommer geöffnet ist; das Restaurant selbst
hat ganzjährig und jeden Tag von Mittags an geöffnet. Darüber, direkt
unter der Kuppel, finden Veranstaltungen des Yenidze-Theaters statt.

Zwingergraben mit Meridianhaus, Mathematisch-Physikalischer Salon, Langgalerie, Kronentor und Wallgrabenbrücke

Die ursprüngliche Wallgrabenbrücke
verband ab 1718 die westlichen Dresdner Vorstädte (heutige Wilsdruffer
Vorstadt) außerhalb der Dresdner Befestigungsanlagen mit dem ab 1709
entstandenen Zwinger. Der Name Zwinger geht auf die im Mittelalter
übliche Bezeichnung für einen Festungsteil zwischen der äußeren und
inneren Festungsmauer zurück, obschon der Zwinger bereits bei Baubeginn
keine dem Namen entsprechende Funktion mehr erfüllte. Dabei führte die
Brücke über den vor der äußeren Festungsmauer gelegenen Stadtgraben
(Zwingergraben). Gesamtlänge 32 Meter, Breite 5,50 Meter

Gläserne Manufaktur | Home of ID. | Erlebnisfertigung
Gläserne Manufaktur von VW mit Führungen, interaktiven Exponaten und Testfahrten in Elektro-/Hybridfahrzeugen am Großen Garten

Der Mosaikbrunnen steht im
Großen Garten in Dresden-Altstadt. Er wurde anlässlich der
Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 1926 nach einem Entwurf von Hans
Poelzig und seiner Frau Marlene Moeschke-Poelzig im Stil des
Expressionismus bzw. des Art déco errichtet. Der Brunnen befindet sich
an seinem ursprünglichen Standort nahe der Hauptallee im südwestlichen
Teil des Großen Gartens auf einer Wegkreuzung. Diese ist nur mit hohen
Bäumen bepflanzt, der Brunnen ist also an dieser eher dunklen Stelle
das einzig Farbige. Seit der Brunnensanierung 2006/2007 gibt es rund um
den Brunnen Sitzbänke.
Die Form des Brunnens ist, passend zur Umgebung, nach dem Vorbild einer
Pflanze gestaltet. Drei stilisierte Blüten wachsen aus einer runden
Brunnenschale. Der ganze Brunnen ist mit rund einer halben Million
Mosaiksteinen in den Farben Erdbraun, Grau, Grün, Blau, Orange, Gelb
und Gold belegt. Der Brunnen zeigt eine expressionistische
Formensprache mit orientalischen Einflüssen. In Bezug auf die Fallhöhe
des Wassers und den Beckendurchmesser ist der Brunnen falsch
konstruiert, daher spritzt das Wasser über den Beckenrand.

Das Palais im Großen Garten,
auch bezeichnet als Sommer- oder Gartenpalais, ist ein ab 1679
errichtetes barockes Lustschloss in Dresden. Es befindet sich im Großen
Garten, einer weitläufigen Grünanlage am Rande des Stadtzentrums. Das
Palais gilt als erster bedeutender Profanbau in Sachsen, der nach dem
Dreißigjährigen Krieg errichtet wurde. Es ist außerdem eines der
frühesten Barockbauwerke im deutschsprachigen Raum und zählt zu den
kunst- und kulturhistorisch wichtigsten Gebäuden Dresdens. Es gilt als
„Auftakt“ zum Dresdner Barock.

Großer Garten Park - Ein gartenkünstlerisches Meisterwerk
Nicht weit vom Stadtzentrum Dresdens entfernt befindet sich der Große
Garten, der mit seiner derzeitigen Fläche von rund 200 ha die älteste
und größte Parkanlage der Stadt ist. Der erste Gartenplan, der 1676
durch den Hofgärtner Göttler entstand, sah bereits als Mittelpunkt der
Anlage ein Palais vor. Während im gleichen Jahr die ersten Felder für
den künftigen Park angekauft wurden, begann der Bau des Palais unter
der Planung des Oberlandesbaumeisters Starcke erst zwei Jahre später.
Er gilt als frühester barocker Palaisbau Dresdens und diente dem
Wettinischen Hof zunächst als Stätte für Spiele, Theater und Jagdessen.
Mit dem Jahr 1683 begann nach Plänen Karchers die Umgestaltung des
Gartens, die auch eine Ergänzung des Palaisbaus mit acht
Kavaliershäusern mit sich brachte. Parterre- und Boskettenanlagen
entstanden, 1715 wurden Palaisteich und Gartenparterre, in den
folgenden Jahren Remisen zur Fasanenaufzucht angelegt. Der barocke
Gartenplan wurde vermutlich 1719 abgeschlossen und bis zum Anfang des
19. Jahrhunderts beibehalten.
Unter dem Generalgouvernement des russischen Fürsten Repnin-Wolkonski
setzte man eine eigene Behörde für den während der Kämpfe 1813
verwüsteten Park ein. Der Garten wurde der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Der Gartenarchitekt Lenné entwarf im Rahmen einer
Gesamtgestaltungskonzeption Bürgerwiese und Zoologischen Garten,
weitere Ideen des Gartendirektors Bouché flossen ebenfalls ein. Die
barocke Grundstruktur blieb jedoch gewahrt, wenn auch einzelne Bereiche
großzügig umgeformt wurden. Die Eröffnung des Botanischen
Gartens sowie Gartenbauausstellungen verschafften dem Großen Garten im
19. und 20. Jahrhundert europaweite Resonanz. Bombenangriffe gegen Ende
des 2. Weltkrieges richteten in den Gartenanlagen, an Gebäuden und
Skulpturen erhebliche Schäden an. Aufwändige Restaurierungsarbeiten
lassen jedoch den alten Glanz in Teilen wiedererstehen. Neuerungen wie
Parkeisenbahn, Freilichtbühne und Puppentheater erhöhen die
Attraktivität des Naherholungsgebietes für Besucher aus Dresden und
Umgebung.

Die Semperoper am Theaterplatz in Dresden bei Nacht

Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche) und Residenzschloss

Als Bekrönung auf der Semperoper ist eine Quadriga
von Johannes Schilling zu sehen, die von vier Panthern gezogen sowie
von Ariadne und Dionysos geführt wird. Dieses beliebte Motiv haben sich
viele Künstler zu eigen gemacht, so auch der Komponist Richard Strauss,
der zahlreiche Opern unter seinem Freund Ernst von Schuch in Dresden
uraufführte. Seine Oper „Ariandne auf Naxos“ ist auch im Spielplan der
Semperoper zu finden.
Laut griechischer Mythologie war Ariadne die Tochter des kretischen
Königs Minos, der in seinem Palast im Kellerlabyrinth das sagenumwobene
Ungeheuer Minotaurus gefangen hielt. Ariadne half Theseus mit Hilfe
eines Knäuels, den roten Faden wiederzufinden und somit den Ausgang des
Labyrinths. So gelang es ihm, den Minotaurus zu töten und mit Ariadne
zu fliehen. Doch welch Pech: Theseus‘ seine Liebe zu Ariadne erlosch
und er setzte sie auf der Insel Naxos ab. Dort entdeckte Dionysos die
Schöne auf seiner Flucht vor den Sirenen und führte sie in seinem Wagen
zum Himmel, wo sie zur Göttin wurde.
Die Semperoper am Theaterplatz in Dresden bei Nacht

Altstädter Brückenkopf der Augustusbrücke am Schlossplatz mit
Georgentor und Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche)

Die Kunstakademie (links) ist ein Hochschul- und Ausstellungsgebäude an
der Brühlschen Terrasse in Dresden. Der Neurenaissancebau wurde 1887
bis 1893 durch König Albert von Constantin Lipsius für die Königliche
Akademie der Bildenden Künste und den Sächsischen Kunstverein
geschaffen. Sie ist heute Sitz der Hochschule für Bildende Künste
Dresden und der Kunsthalle der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Augustusbrücke am Schlossplatz mit Georgentor und Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche)

Bereits 1704 hatte August der Starke den Bildhauer Balthasar Permoser
beauftragt, den Entwurf eines „Pferd mit der darauf sitzenden Person,
so Eu.: Maj.: praesentieren soll, von mir verferttigen zu lassen“.
Ursprünglich waren Reiter und Ross feuervergoldet. Die Plastik wurde
1884 erstmals durch Constantin Lipsius restauriert. Außerdem vollendete
Lipsius 1885 den Sockel mit einer lateinischen Inschrift. 1956 wurde
das Reiterdenkmal im Rahmen der 750-Jahr-Feier Dresdens wieder
aufgestellt. Es wurde 1965 erneut mit Blattgold überzogen. Der Goldene
Reiter gilt als eines der Wahrzeichen Dresdens.

Die Augustusbrücke ist eine von
fünf Brücken im Innenstadtbereich Dresdens. Mehrere Linien der Dresdner
Straßenbahnen verlaufen über die Brücke. Südlich der Elbe befindet sich
der touristisch bedeutsame Theaterplatz und kurz dahinter der Postplatz
als wichtigster Straßenbahnkreuzungspunkt. Über die Augustusbrücke
fahren daher etwa im Zweiminutentakkt je Richtung Straßenbahnen der
Linien 3, 4, 7 und 9. Nach dem Wegfall der teileingestürzten
Carolabrücke trägt sie die Hauptlast der Straßenbahnen. Sie ist zudem
eine wichtige Verkehrsader für den Fuß- und Radverkehr.

Canaletto-Blick vom Königsufer

Sophienstraße am Theaterplatz mit Semperoper Dresden

Die Brühlsche Terrasse bzw.
Brühl-Terrasse ist ein architektonisches Ensemble und eine touristische
Sehenswürdigkeit in Dresden. Sie liegt im Stadtzentrum in der Altstadt
und erstreckt sich über etwa 500 Meter entlang der Elbe zwischen der
Augustusbrücke und der Carolabrücke. Die Brühlsche Terrasse wird auch
als Balkon Europas bezeichnet. Der Begriff wurde zu Beginn des 19.
Jahrhunderts geprägt und später vielfach in der Literatur verwendet.
Brühlsche Terrasse beim Ständehaus

Georgentor am Schlossplatz

Denkmal „Friedrich August dem Gerechten“ und Fürstenzug am Schlossplatz

Frauenkirche Dresden am Neumarkt

Die exakten Abmessungen des gesamten Wandbildes betragen – einer
zeitgenössischen Bauzeichnung zufolge – 101,9 m Länge und 10,51 m Höhe.
Da sich im oberen Teil des Frieses 18 Fenster befinden, beträgt die mit
Fliesen belegte Fläche lediglich 968 Quadratmeter. Die Abmessungen der
einzelnen Fliesen sind 20,5 cm × 20,5 cm. Bei einer fugenfreien
Verlegung sind damit ungefähr 23.000 Fliesen an der Wand angebracht,
wobei wegen der eingeschlossenen Fenster auch Teilstücke zum Einsatz
kamen.
Im Fürstenzug werden insgesamt
94 Personen dargestellt, davon reiten 45 Personen zu Pferd und 49
Personen gehen zu Fuß. Obwohl viele Personen anscheinend intensiv
miteinander kommunizieren, ist bei den Beteiligten der Mund
geschlossen. Der Künstler W. Walther überließ Gestik und Gestikulation
den Vorrang. Die einzige sichtbar sprechende Person ist der Köhler
Georg Schmidt, Retter des entführten Prinzen Albrecht im Altenburger
Prinzenraub, welcher als mittlere Person hinter Albrecht dem Beherzten
schreitet. Sechzehn Personen schauen aus dem Bild heraus und treten mit
dem Betrachter in direkten Blickkontakt. Neben den 45 Pferden gibt es
noch zwei Hunde und im Zierrahmen sind Vögel sowie Schmetterlinge zu
sehen.

Altmarkt und Kreuzkirche Dresden

Residenzschloss am Taschenberg

Schloßstraße mit Georgentor

Stallhof Dresden - Langer, für Spiele und Turniere genutzter Innenhof
des 16. Jh., der heute für seine Weihnachtsmärkte bekannt ist.

Das Wandbild "Der Weg der Roten Fahne"
ist seit 2001 Kulturdenkmal und ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Wenn
man es genau betrachtet kann man das eine oder andere gut darauf
erkennen (Karl Marx, Friedrich Engels, Ernst Thälmann, Soldaten der
Revolution, Arbeiter, Trauer um gefallene Genossen, die Fahne und
Verwirklichung der DDR und vieles mehr).
Das Wandbild nimmt die Westseite des Gebäudes ein. Es ist 30 Meter mal
10,5 Meter. 1968-1969 wurde es unter Leitung von Gerhard Bondzin
umgesetzt, von der Arbeitsgemeinschaft der Hochschule für Bildende
Künste in Dresden. Der Arbeitstitel lautete: „1849 – 1969: 120 Jahre
Kampf der revolutionären Kräfte der Stadt für Fortschritt und
Sozialismus“. Es besteht aus Farbglas auf Betonplatten, die
elektrostatisch beschichtet wurden – eine Technik, die bei einem
Wandbild dieser Größe erstmals angewendet wurde.
Wandbild am Kulturpalast

Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (Dresdener Hofkirche) - Berühmtes
von Gaetano Chiaveri im 18. Jh. entworfenes und nach dem Zweiten
Weltkrieg restauriertes Bauwerk.

DER CANALETTO-BLICK
Bernardo Bellotto (1722-1780), genannt Canaletto, war Hofmaler Augusts
III., dem Sohn und Thronfolger Augusts des Starken. Er schuf zwischen
1747 und 1758 eine Serie von 14 großformatigen Ansichten des barocken
Dresdens. Diese Stadtpanoramen prägten maßgeblich das Bild Dresdens in
der Welt und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Der Blick
auf das „Venedig an der Elbe" aus dieser Perspektive zeigt, wie die im
18. Jahrhundert entstandenen markanten Prachtbauten der Dresdner
Altstadt die Hofkirche und die Frauenkirche die Stadtsilhouette bis
heute prägen.

Ausblick vom der Terrasse des Felix Suiten Am Zwinger Dresden auf den Zwinger ohne Orangerie

Der Cholerabrunnen (auch
Gutschmid-Brunnen) ist ein neugotischer Brunnen. Er steht in Dresden an
der Sophienstraße, zwischen Zwinger und Taschenbergpalais. Er wurde von
Freiherr Eugen von Gutschmid finanziert, der so seine Dankbarkeit dafür
zeigen wollte, dass Dresden von der Cholera-Epidemie (1841/1842)
verschont geblieben war, die an Oder und Unterelbe ausgebrochen war und
auch Dresden bedroht hatte. Neben Gottfried Semper als Architekt
übernahmen Karl-Moritz Seelig den Entwurf, der am 15. Juli 1846
feierlich an die Stadt übergeben wurde.

Kreuzkirche Dresden -
Evangelische Kirche im Spätbarockstil mit 92 m hohem Turm und
Aussichtsplattform in 54 m Höhe. Hier heiratete am 21. Januar 1818 der
Maler Caspar David Friedrich.

Die Kreuzkirche ist als evangelische Hauptkirche Dresdens ein Ort der
Emeuerung und des Aufbruchs sowie mit Kreuzchor und Kreuzorganist
kirchenmusikalisches Zentrum der Stadt. Bereits vor der ersten
urkundlichen Erwähnung Dresdens im Jahre 1206 stand an dieser Stelle
eine Kapelle. Um 1215 wurde eine romanische Basilika errichtet und nach
dem Kaufmanns-, Markt- und Brückenheiligen St. Nikolaus St.
Nikolaikirche benannt. 1234 erhielt sie vom Markgrafen Heinrich einen
„Splitter vom Kreuz Christi". Die Reliquie wurde sehr verehrt und
gleichzeitig wurde um diese Zeit ein schwarzes Holzkreuz unerfindlicher
Herkunft aus der Elbe gezogen, so dass der Bischof von Meißen die
Kirche 1388 als Kirche zum heiligen Kreuz neu weihte.
Am 6. Juli 1539 fand hier der erste evangelische Abendmahlsgottesdienst
und damit die Einführung der Reformation im gesamten Herzogtum Sachsen
statt. Seitdem ist die Kreuzkirche evangelisch. Im Laufe ihrer
Geschichte wurde sie fünfmal zerstört bzw. brannte aus: 1491, 1669,
1760, 1897 und 1945. Der spätbarock-klassizistische Bau, 1766-1792
errichtet, ist in seiner äußeren Gestalt bis heute erhalten. 1894/95
erfolgte eine umfangreiche Innenerneuerung der Kirche, die aber bereits
am 16.2.1897 durch einen Brand im Dachstuhl restlos zerstört wurde. Nun erfolgte bis 1900 der innere
Wiederaufbau im Jugendstil, bis in der Nacht und den auf den 13.
Februar 1945 folgenden Tagen auch dieser ein Opfer der Zerstörung durch
den 2. Weltkrieg wurde. 10 Jahre später, am 13. Februar 1955, konnte
die Kreuzkirche, im Inneren bewusst gebrochen und unfertig belassen,
wieder geweiht werden. Seit 1976 erfolgt die schrittweise Beseitigung
der noch vorhandenen Schäden am gesamten Baukörper, der sich jetzt im
neuen Jahrtausend in eine umfangreiche Sanierung über vier
Bauabschnitte erstreckt.
In den 80er Jahren war die Kreuzkirche Treffpunkt von Friedens- und
Umweltgruppen. 1989 wurde sie zum Zentrum der friedlichen Revolution in
Dresden. Zur stillen Andacht und Besichtigung ist die Kirche in der
Regel täglich geöffnet, auch der Turm lädt zu Besteigung und
Besichtigung ein. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten können Sie den
Aushängen am Eingang entnehmen. Zu Gottesdiensten, Vespern, Metten und
Kirchenkonzerten singt in einer Tradition seit 1216 der Dresdner
Kreuzchor, ein weltweit anerkannter und geschätzter Knabenchor.
ALTAR von der Zerstörung verschont
KREUZIGUNGSGEMÄLDE VON ANTON DIETRICH MIT BRANDSPUREN VON 1945
BRONZERELIEF ZEIGT DAS 1. EVANG. ABENDMAHL IN SACHSEN AM 15.7.1539, LEUCHTER & KRUZIFIX VON 1900

ALTAR - Infolge der Brandwirkung musste er weitgehend abgetragen werden.
ALTARGEMÄLDE - „Golgatha", von
Professor Anton Dietrich 1900 gemalt, hatte durch die Brandeinwirkungen
im 2. Weltkrieg seine leuchtenden Farben verloren und wurde im Jahre
2001 restauriert.
PREDELLA - Ein Bronzerelief,
1900 von Professor Heinrich Epler geschaffen, stellt die erste
evangelische Abendmahlsfeier in der Kreuzkirche im Juli 1539 dar.
ORGEL - Sie wurde von der
Dresdner Orgelbaufirma Jehmlich gebaut, 1963 geweiht und 2005
grundlegend saniert. Sie hat 76 Register auf 4 Manualen und Pedal mit
6111 tönenden Pfeifen, mechanische Spiel- und elektrische
Registertraktur.
KIRCHENRAUM - Er wirkt in
seiner Größe und Proportion durch bewusste Schlichtheit. Mit ca. 3000
Sitzplätzen ist er der größte Kirchenraum der Stadt und fasst insgesamt
4000-5000 Menschen:
TAIZE-FENSTER - Es befindet
sich im rechten Seitenschiff und ist ein Geschenk von Roger Schutz und
den Brüdern von Taize aus dem Jahre 1980. Inhaltlich ist die Verklärung
Christi dargestellt und eine Inschrift lautet: „Wende dich im
Augenblick Gott zu und versöhne dich".
HEINRICH-SCHÜTZ-KAPELLE -
Kruzifix und Epitaphe stammen aus der Schützzeit. Heinrich Schütz
wirkte zwischen 1615-1672 als Hofkapellmeister in Dresden. Die
Reliefplatte und das farbige Glasfenster wurden von Prof. Rudolf
Mauersberger gestiftet. Er war als Kreuzkantor von 1930-1971 tätig.
Vorläufig befindet sich auch das Nagelkreuz aus Coventry noch an diesem
Ort.
NAGELKREUZ - Es wurde der
Kreuzkirche 1986 als ein Zeichen der Versöhnung aus der zerstörten
Kathedrale von Coventry überreicht. Die Kreuzkirche gehört damit zum
weltweiten Verband der Nagelkreuzgemeinschaften.
RAUM DER STILLE - Er befindet
sich links vom Altar (Nordsakristei) und ist ausgestaltet mit den
Bildern des Malers Heinz Quintscher zum Zyklus, „Lied der Kerze".
TURM - Bis zur Kreuzspitze hat
er eine Höhe von 92 Metern, der Umgang befindet sich in 54 Meter Höhe.
Der Turm ist in der Regel täglich geöffnet.
GELÄUT - Nach dem Kölner Dom
ist es mit einem Gesamtgewicht von 28,45 Tonnen das zweitgrößte Geläut
Deutschlands. Es wurde 1900 von der Firma Schilling in Apolda gegossen.
Die fünf Bronzeglocken sind auf die Töne E-G-A-H-D gestimmt.
TURMUHR - Sie wurde 1957 mit
einem Zifferblattdurchmesser von drei Metern gebaut. Im Jahre 2006
erfolgte die Erneuerung der Zifferblätter und Zeiger. Die Schlagglocken
(Seigerschellen) stammen aus dem Jahre1787.
HAUPTEINGANG - Zu sehen sind
eine Barock-Skulptur "Ecce homo" aus der Zeit der beiden Epitaphe, die
steinerne Abbildung des Brückensiegels (Grundlage für das
Kirchensiegel), sowie der in 13 Sprachen entbotene Friedensgruß auf
zwei gläsernen Tafeln. Im Gedenken an die ermordeten jüdischen Bürger
unsererStadt ist links vom Haupteingang eine Bronzetafel mit dem
abschließenden Text: „Wir bitten um Vergebung und Schalom" an der
Kirchenmauer angebracht.

KIRCHE unverändert seit 1792, URSPRÜNGL. DEM HL. NIKOLAUS GEWEIHT, 5 X
ABGEBRANNT UND WIEDERERRICHTET, EVANG. HAUPTKIRCHE SACHSENS, HEIMSTÄTTE
DES DRESDNER KREUZCHORES PLÄTZE FÜR ÜBER 3.000 PERSONEN
ORGEL Große Jehmlich-Orgel, AM 31.10.1963 GEWEIHT, 6.293 PFEIFEN, 80 REGISTER, 4 MANUALE, PEDAL


DIE SCHÜTZKAPELLE in der Kreuzkirche
Die zielstrebigen Aktivitäten von Kreuzkantor Rudolf Mauersberger für
den Wiederaufhau der Kreuzkirche umfussten auch die Konzeption und
Finanzierung der Schützkapelle. Sie diente der Aufführung der Kleinen geistlichen Konzerte
und Kompositionen in kleiner Besetzung. Aus den Trümmern der total
zerstörten Innenstadt wurden Erinnerungsstücke geborgen und bewahrt:
die Gedenktafein am Wohnhaus und Sterbehaus von Schütz sowie der
„Kinderfries" (jetzt wieder an den früheren Standorten. Das Fenster von
Helmar Helas aus Dresden (1914 1961) zeigt ohen die Alte Frauenkirche,
wo Schütz hegrahen wurde, links sein Sterbehaus in der Moritzstraße,
rechts sein Wohnhaus am Neumarkt (bis 1657, jetzt „Schutzresidenz"),
unten die Kreuzkirche zur Schütz-Zeit. In der Mitte steht, ein
persönliches Credo von Schütz, das er ans Ende der Auferstehungs-Historie (1623) setzte.
Das Porträt-Relief schuf nach alten Vorlagen der Bildhauer Otto Rast (1887-1970).
Das Positiv (Schütz-Orgel) erbaute nach der Disposition von Gerhard
Paulik die Orgelbaufirma Jehmlich, Dresden. Bei der Innensanierung der
Kreuzkirche (bis 2006) wurde sie entfernt. Ein Heizkörper und eine Bank
wurden installiert. Am 1. Juli 1955 wurde die Schützkapelle ihrer
Bestimmung übergeben, dem Tag des 25jährigen Dienstjubiläums von
Mauersberger als Kreuzkantor. Sie ist mit ihrem Inventar seine
persönliche Stiftung an die Kreuzkirche zum Gedächtnis an Heinrich
Schutz. An jedem Freitag wird hier mittags 12 Uhr seit 1986 das
Versöhnungsgebet von Coventy gebetel.

TURM Aussicht aus 54 m Höhe
92 M BIS ZUM TURMKREUZ, 259 STUFEN ZUR PLATTFORM, BIS 1950 MIT TÜRMERWOHNUNG, 2 STUNDENSCHELLEN VON 1790 IN DER TURMSPITZE

Ernst Julius Otto war ein bedeutender Musiker, der von 1828 bis 1875
den Dresdner Kreuzchor leitete. Das Denkmal für den 22. Evangelischen
Kreuzkantor auf dem neu gestalteten Platz zwischen Kreuzkirche und
neuem Hotel am Altmarkt wurde restauriert und neu gestaltet. Der
Künstler Niklas Klotz orientierte sich an den historischen Vorlagen von
Gustav Kietz (1824-1908) sowie den noch vorhandenen Gipsabgüssen und
fügte der ursprünglichen Gruppe als zeitgenössischen Kommentar eine
neue Figur hinzu. Diese Plastik hebt sich in Bearbeitung, Material und
Farbe von der historischen Figurengruppe ab und stellt damit diesen
aktuellen Zeitbezug her.
Denkmal für Kreuzkantor Ernst Julius Otto

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: