web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Krahuletz-Museum
Eggenburg, Oktober 2023
Das Krahuletz-Museum mit Sammlungen zur regionalen
Erdgeschichte, Archäologie, Volkskunde, Regional- und Stadtgeschichte
sowie einer Uhrensammlung befindet sich in der Stadt Eggenburg in
Niederösterreich.
Erleben Sie eine Milliarde Jahre Erdgeschichte:
Mineralien, Gesteine, Fossilien des „Eggenburger Meeres“, Archäologie:
„Vom Mammutjäger zur mittelalterlichen Stadt“, Uhren aus 3
Jahrhunderten, Bertha-von-Suttner-Raum, Matt & Glänzend, Glas und
Keramik. Sonderausstellung: „Unter dem Schutz des Heiligen Ambrosius –
Wachsziehen und Lebzelterei“

Das Krahuletz-Museum bietet mit seinen umfangreichen geologischen,
paläontologischen und archäologischen Sammlungen einen breit
gefächerten Zugang zur Natur- und Kulturgeschichte im nordwestlichen
Niederösterreich. Bei einem Rundgang im Untergeschoß lässt sich die
Entstehung und Entwicklung der Landschaft der Region miterleben. Im
ersten Obergeschoß befinden sich die umfangreiche Volkskundesammlung
sowie die Ausstellung „Uhren aus drei Jahrhunderten“. Das zweite
Obergeschoß beherbergt die archäologische Sammlung. Dem Besucher
eröffnen sich 30.000 Jahre Besiedlungs- und Kulturgeschichte im
nordwestlichen Niederösterreich.
Ein zeitgenössisches Ölbild im Krahuletz-Saal des Museums zeigt den
Junggesellen Krahuletz mit Geologenhammer und im Hintergrund die Stadt
Eggenburg

Johann Krahuletz (1848-1928) sammelte bereits als Kind ur- und
erdgeschichtliche Objekte auf den Äckern rund um Eggenburg, zunächst im
Auftrag des Schlossherrn von Stockern, Candid Ponz von Engelshofen
(gest. 1866). Der an Archäologie besonders interessierte Autodidakt
Krahuletz konnte eine international bekannte Sammlung zusammentragen.
Als Krahuletz Ende der 1890er Jahre seine Sammlung ins Ausland
verkaufen wollte, gründeten Eggenburger Bürger die
„Krahuletz-Gesellschaft", um die Sammlung in Eggenburg zu halten. Schon
1902 wurde das Krahuletz-Museum in Eggenburg eröffnet. 1925 wurde
Krahuletz zum Professor der Geologie ernannt.
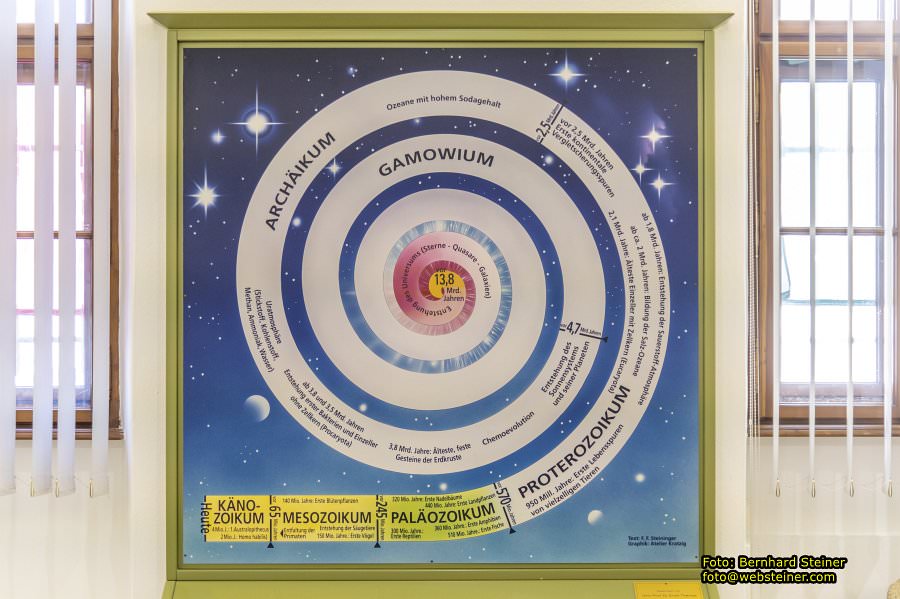
Krahuletz gelangen einige international bedeutende Funde, wie der eines
Schädels eines gavialartigen Krokodils (mit extrem langem Kiefer) sowie
eines Skeletts einer Seekuh, die vor 20 Millionen Jahren lebte. Seine
Sammlung präsentierte er 1889 erstmals der Öffentlichkeit, in einem
eigenen Raum der Bürgerschule Eggenburg. Dank der
Krahuletz-Gesellschaft konnte ein eigenes Museum errichtet werden, in
das die Sammlung 1902 übersiedelte. Es war der erste eigenständige
Museumsbau Niederösterreichs und war auch vollständig elektrifiziert -
früher als das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum in Wien.

Der Amethyst von Maissau
Seit etwa 1845 ist die Amethystfundstelle bei Maissau bekannt, aus der
Amethystader von Eggenburg wurden schon seit 200 Jahren Rohstücke für
die Herstellung von kunstgewerblichen Objekten geborgen. Mehrere
wissenschaftliche Grabungen der letzten Jahre erbrachten wichtige
Erkenntnisse über den Aufbau der Ader. Der Amethystgang verläuft
senkrecht durch den stark zerrütteten Maissauer Granit, wobei der
oberste Bereich in lose Brocken und Kristallfragmente aufgelöst wurde.
Einige dieser Bruchstücke wurden im Eggenburger Meer vor 20 Millionen
Jahren als Strandgerölle abgerundet.
Die kantigen Bruchstücke können auch durch Chalcedon zu einer
Amethystbreccie verkittet sein. Für den Maissauer Amethyst ist seine
Farbsequenz typisch, die von der Granitbasis mit Rauchquarz hell -
Rauchquarz dunkel - Milchquarz - Amethyst dunkel - Milchquarz dünn -
Amethyst hell - Milchquarz - Rauchquarz dünn - Milchquarz
(Kristallspitze) reichen kann. Die Kristalle selbst zeigen, ihre
Flächen betreffend, unterschiedlichste Ausbildung, Farbe und Ausbildung
ändert sich von Kluft zu Kluft. Die violette Färbung des Quarzes
Amethyst wird auf den Einbau von Eisen und Titan bzw. auf radioaktive
Bestrahlung und dadurch verursachte Baufehler im Kristallgitter
zurückgeführt.

Eine der großen Leidenschaften von Johann Krahuletz war die
Archäologie. Seine Funde aus der Umgebung Eggenburgs, vor allem von der
Siedlungsstätte Heidenstatt bei Limberg und dem Vitusberg bei
Eggenburg, spannen den zeitlichen Bogen von der Altsteinzeit (ab
300.000 v. Chr.) bis in das Frühmittelalter. Das bronzene „Zaumzeug von
Mödring" aus der Römerzeit (3. Jh. n. Chr.), das Krahuletz für das
Museum erwarb, hat Bezüge zu Südschweden und ist ein österreichweites
Unikat.

WALDVIERTEL – KRISTALLVIERTEL
Die steinerne Schatzkammer Österreichs - Gesteine und Mineralien des Waldviertels
Am Anfang war das Waldviertel
Die Geologie des Waldviertels offenbart die vierte Dimension, die Zeit,
wie keine andere Region und reicht weit in die Vergangenheit der Erde
zurück - ein Bild, das so alt ist, wie sonst nirgendwo in Österreich!
Das älteste Datum liefern uns wenige Zehntelmillimeter große Zirkone
aus Gesteinen bei Drosendorf. Das Alter dieser Zirkone beträgt 3,4
Milliarden Jahre. Dies ist der Nachweis, dass hier bereits
Krustengesteine vorhanden waren. Fast eine Milliarde Jahre jünger, rund
2,6 Milliarden Jahre alt, sind Zirkone aus dem Bíteš-Gneis bei
Mallersbach.
Als bisher ältestes Gestein in Österreich gilt jedoch der Dobra-Gneis
mit einem Alter von 1377 ± 10 Millionen Jahren. Er gehört zu einer der
ältesten Gesteinsfolgen des Waldviertels, der Biteš-Einheit. Diese ist
durch eine Gebirgsbildungs-Fuge von den darunter und darüber liegenden
Gesteinsfolgen getrennt.
Der Bau des Waldviertels
Die Waldviertler Gesteinfolgen gehören zwei großen Krustenteilen der
„Böhmischen Masse" an: Dem Moravikum und dem Moldanubikum. Bei der
Stapelung dieser Krustenteile entstand das „Variszische" Hochgebirge.

Beim Bau der Franz-Josefs-Bahn in den 1880er Jahren untersuchte
Krahuletz Baustellen, Kies- und Sandgruben, wo er zahlreiche Fossilien
fand. 1898 entdeckte er in den Sandgruben um Eggenburg zahlreiche
Knochen einer Seekuhart, die vor 20 Millionen Jahren lebte, als weite
Teile Niederösterreichs von einem subtropischen Meer bedeckt waren. Zu
Ehren Krahuletz' wurde diese Tierart Metaxytherium krahuletzi genannt.
Krahuletz' Fossilfunde begründeten die Bekanntheit seiner Sammlung und
sind bis heute ein Highlight des Museums.
Leichenfeld von Kühnring

Die Geschichte des Waldviertels
Vor 600 Millionen Jahren lagen alle Kontinente auf der Südhemisphäre
und bildeten einen einzigen „Superkontinent", der sich im Erdaltertum
ab 542 Millionen Jahren in einzelne größere und kleinere Krustenteile -
LAURASIA und GONDWANA - aufzugliedern begann. Auch die Erdkrustenteile
des Waldviertels entstanden vor ca. 3,4 Milliarden Jahren nahe dem
Südpol.
Plattentektonische Vorgänge bewegten die Krustenteile von N-Amerika,
Grönland, N-Europa und Sibirien kontinuierlich nach Norden. Um 360
Millionen Jahren vereinigten sich diese Krustenteilen und es entstand
der nördliche Großkontinent LAURASIA. Im Süden hatten sich die
Krustenteile von S-Amerika, Afrika, Antarktika, Indien, Australien und
Neuseeland zum Großkontinent GONDWANA vereinigt. Der zwischen diesen
Großkontinenten liegende „Rheische-Ozean" wurde ab 360 Millionen Jahren
zugeschoben und es entstand der Superkontinent PANGÄA. Dabei wurde das
„Variszische Gebirge", welches sich von Nordamerika über Westeuropa bis
in unserem Raum mit der „Böhmischen Masse" erstreckte, aufgefaltet.
Dieses Gebirge wurde dann ab 320 Millionen Jahren, dem oberen
Erdaltertum, bis heute bis in seinem inneren Kern abgetragen. Die
Hebung der Böhmischen Masse im Karbon um 320-300 Millionen Jahren ist
von Abkühlung, bruchtektonischer Zerlegung und Abtragung dieses
„Variszischen" Gebirges bis heute begleitet.
Im Oberen Jura, ab ca. 160 Millionen Jahren, zerteilte sich die PANGÄA erst in die Großkontinente LAURASIA
im Norden und GONDWANA im Süden und ab der Oberen Kreide, ab ca. 100
Millionen Jahren, bildeten sich die heutigen Ozeane und Kontinente. Für
die heutige Gestalt der Böhmischen Masse war die Klimaentwicklung im
Eozän vor ca. 40 Millionen Jahren hauptverantwortlich. Damals herrschte
ein tropisches Klima, das eine intensive Verwitterung bewirkte. Die bis
heute anhaltende Abtragung hat dieses Gebirge bis in die tiefsten
Krustenstockwerke freigelegt und erlaubt uns einen Blick ins Innere.
Und woher kommen die Mineralien des Waldviertels?
In dieser Ausstellung werden erstmals die Gesteine dieser alten Krustenteile vorgestellt. Erstmals wird gezeigt in
welchem Zusammenhang Gesteine und die in diesen entstandenen Mineralien
stehen. Mineralien stammen aber auch aus Pegmatit-Gängen, welche die
Gesteine durchschlagen. Viele Mineralien entstanden an den
Reibungsflächen der Gesteinspakete, als diese gestapelt wurden oder in
Sedimenten. Zum leichteren Verständnis sind die Mineralien mit den
entsprechenden Gesteinen in den Vitrinen nach diesen farbig
gekennzeichneten Gesteinseinheiten angeordnet. Unter den über 1500
Exponaten finden sich eine Vielzahl von den 380 Mineralienarten, die
derzeit im Waldviertel nachgewiesen wurden. Über 40 Privatsammler und
öffentliche Sammlungen haben ihre einmaligen, seltenen und schönen
Mineralstufen für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt. Ein Raum
ist den bearbeiteten Gesteinen und Mineralien gewidmet, die bisher noch
nie in dieser Pracht - klassisch geschliffen, als Carbochons, gemugelt,
als Kugeln, Schmuckstücke und Kunstobjekte - zu sehen waren.

Molasse-Zone / Älterer Schlier
Septarie (Konkretion mit Calcitauskleidung der Trockenrisse; natürlicher Bruch und poliert), Fundort: Kemmelbach


Bertha von Suttner - Friedensnobelpreis und Eggenburg
Nach ihrer Rückkehr aus dem Kaukasus 1885 war der Lebensmittelpunkt
Bertha von Suttners das Schloss Harmannsdorf etwa 8 Kilometer von
Eggenburg entfernt. Dort schrieb sie auch den Roman „Die Waffen
nieder", für den sie 1905 als erste Frau den Friedensnobelpreis
erhielt. Bertha von Suttner hatte auch Ihre Wahltante Katharina Büschel
in ihre Nähe, nach Eggenburg, geholt. Sie besuchte wöchentlich ihre
„Tante Lotti" bis zu deren Tod 1899. Aus Burgschleinitz, in der Nähe
Eggenburgs, stammte ihre treue Haushälterin Katharina Buchinger
(geborene Friedl).
Bis zum Tod ihres Gatten Arthur Gundaccar von Suttner 1902, wohnte
Bertha in Harmannsdorf. Nach der Versteigerung des Guts zog sie mit
Katharina Buchinger nach Wien in die Zedlitzgasse. Von ihren
Vortragsreisen schickte sie ihrer Haushälterin viele Briefe und
Postkarten. Am 21. Juni 1914 starb Bertha von Suttner. Eine Woche
später, am 28. Juni wurde der Thronfolger Erzherzog Ferdinand in
Sarajewo ermordet. Die Asche Bertha von Suttners wurde im Urnenhain in
Gotha beigesetzt.
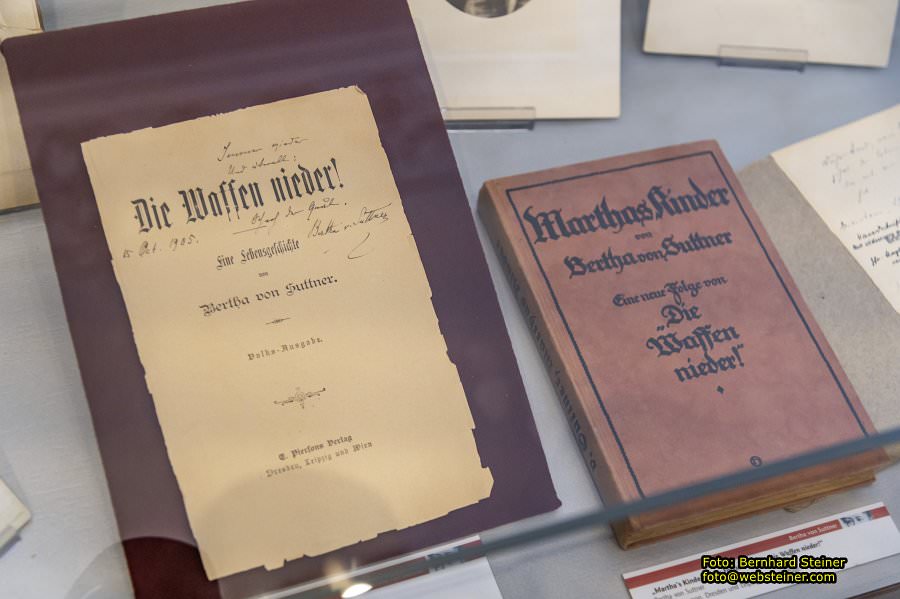
Röschitzer Bauernstube
Diese Bauernstube ist der einzige noch im Originalzustand erhaltene
Ausstellungsraum der ersten Museumsgestaltung. Ein großer Teil der
Einrichtung, einschließlich der Holzdecke von 1659, stammt aus Röschitz
so das Bett, der Tisch, die Bank, die Türe, das „Weinkastl", Kruzifix
und mehrere Kleingegenstände; der Ofen stammt aus Roggendorf, die
Stühle sind aus der Umgebung von Eggenburg. Die damaligen
Museumsverantwortlichen wollten bewusst nicht nur Objekte in Vitrinen
zeigen, sondern mit der Decke, dem Fußboden und den bleigefassten
Fenstern einen Gesamteindruck der früheren Lebensweise darstellen.
Heute würde man es Rauminstallation nennen. Diese Stube war Vorbild für
viele Heimatmuseen in Niederösterreich.
Kufenwiege - Mit Schnitzerei verziert, zwei Kartuschen mit Beschriftung: MARIA und IHS (Niederösterreich, 19. Jahrhundert)
Krapfenprügel (Niederösterreich, 19. Jahrhundert)
Zur Herstellung von sogenannten Prügelkrapfen wurde der Teig
schichtweise vor einem offenen Feuer und unter ständigem Drehen auf den
hölzernen Krapfenprügel aufgegossen.
Hinterglasbilder - Heilige Dreifaltigkeit / Maria Lactans / Mater Dolorosa (Nordösterreich/Böhmen, 18. Jahrhundert)

Eggenburg und die Farbe Rot
Viele Handwerkszweige waren mit der Textilproduktion befasst. Bauern
bestellten die Felder mit Pflanzen zur Gewinnung von Fasern (z. B.
Flachs) und Farbpigmenten (z.B. Krapp). Arbeiter und Handwerker
stellten daraus Gewebe her und färbten Fäden und Stoffe. Strickerinnen
vollendeten die Textilien. Die vorherrschende Farbe der Stickereien ist
Rot. Der rote Farbstoff Krapp (Rubia tinctorum, auch Färberröte oder
„Türkisch Rot" genannt) ist neben Indigo einer der ältesten
Pflanzenfarbstoffe. Der Anbau von Krapp im frühen 19. Jahrhundert ist
unter anderem in Kragran, im Pulkautal, Laa an der Thaya und Loosdorf
bezeugt, wurde aber um die Mitte des Jahrhunderts weitgehend
aufgegeben. Die Verbreitung chemisch hergestellter roter Farbstoffe
machte den Anbau von Krapp zunehmend unrentabel.
Woher kamen die „fleißigen Hände"?
Für so viel Alltagswäsche und Kleidung musste früh Sorge getragen
werden. Mit 13 bis 14 Jahren begannen die Mädchen mit der
Zusammenstellung ihrer Aussteuer, sollte diese doch bis zur Hochzeit
vollständig sein. Die Anfertigung erfolgte ursprünglich unter Anleitung
der Mutter. Für die Darstellungen wurden auf die in der Familie
gängigen Muster zurückgegriffen und je nach Bedarf weltliche oder
kirchliche Motive gestickt. In Kloster- und Mädchenschulen für „höhere
Töchter" gehörte das Erlernen dieser Fertigkeit zur Ausbildung, an
Industrieschulen für mittlere und ärmere Schichten war lediglich
Monogrammsticken zum Wäschekennzeichnen im Lehrplan. Je nach familiären
Vermögensverhältnissen wurde für den Eigenbedarf gestickt, aus
Vergnügen und Leidenschaft, aber auch aus Langeweile und um
gesellschaftlichen Konventionen zu genügen - oder für Geld. sDie
Stickerei war im Gegensatz zu anderen Kunsthandwerken nicht nur in
gewerblicher, sondern auch in privater Produktion möglich. Die hier
verwendeten Sticktechniken sind der heute noch beliebte und einfache
Kreuzstich und der Plattstich, der mehr an Übung bedarf.

Das Krahuletz-Museum präsentiert sein neuestes Highlight: das
maßstabgetreue Stadtmodell der Stadt Eggenburg, wie sie um 1590
ausgesehen hat. Der Erbauer dieses Modells, Mag. Alexander Korab
(Wien), nahm die neuesten archäologischen Ergebnisse sowie historische
Abbildungen zum Vorbild.

Eggenburg um 1590 - Maßstab 1:500 - Alexander Korab 2016

Bemalte Bauernmöbel aus einer Weinviertler Bauernmöbel-Werkstätte in Röschitz, NÖ
Erstmals ist es gelungen für Niederösterreich eine Tischlerwerkstatt,
aus dem Weinort Röschitz nachzuweisen, in der über Generationen bemalte
Bauernmöbel hergestellt wurden. Der älteste ausgestellte Kasten mit dem
Monogramm „M.B." ist aus dem Jahr 1797, ferner wird ein Kasten aus dem
Jahr 1805, ein weiterer mit Monogramm „E.Z." aus dem Jahr 1805 und der
jüngste mit dem Monogramm „E.K." aus dem Jahr 1836 gezeigt. An Hand der
Bemalung und Konstruktion kann die Entwicklung der Kasten vom 18. bis
ins 19. Jahrhundert nachvollzogen werden. Die Beschriftung der
Innenlade des Kastens von 1836 ermöglicht die Genialogie dieser
Tischlerwerkstätte zu verfolgen und die einzelnen Kastentypen ihren
Meistern zuzuordnen.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei in Maissau blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Das Fortleben dieser Tradition in den letzten
hundert Jahren verdankte sich mehreren Generationen der Familie Schmid,
die mit Martin Schmid, dem Enkelsohn des Geschäftsgründers, Lebzelter
und Bürgermeister in Personalunion stellte.
Die Ursprünge der Lebzelterei in Maissau
Die erste Erwähnung eines Lebzelters in den Maissauer Innungsbüchern
reicht in das Jahr 1642 zurück und steht in Zusammenhang mit einem
weiteren, inzwischen weitgehend ausgestorbenen niederösterreichischen
Wirtschaftszweig: dem Safrananbau. Zwischen dem 15. und dem 19.
Jahrhundert war der Anbau dieses Gewürzes im Wald- und Weinviertel weit
verbreitet, beliebt war be- sonders der in Maissau kultivierte
„Ravelbacher" Safran. Die für den Safran in die Stadtgemeinde am Rücken
des Manhartsbergs reisenden Gewürzhändler brachten die Zutaten für den
gewürzreichen Honigkuchen in die Region.
Dem ersten Maissauer Lebzelter folgten im 17. und 18. Jahrhundert mit
Wolf Huber, Josef Stinkhlhammer, Johann Wagner und der Lebzelterfamilie
Khielmanns wei- tere Meister dieses honigsüßen Gewerbes. Seit dem Jahr
1790 und vor allem im 19. Jahrhundert prägte die Lebzel- terei und
Wachszieherei der Familie Altmann mit ihrem Geschäft links vor dem
Stadttor" das Ortsbild Maissaus. Engelbert Altmann, dessen Stempel in
der Ausstellung zu sehen ist, verlegte im frühen 20. Jahrhundert sein
Fami- liengeschäft nach Perchtoldsdorf und machte die Bahn frei für die
Erfolgsgeschichte der Familie Schmid.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei Schmid
Im Jahr 1913 eröffnete der Lebzelter Josef Schmid mit seiner Gattin
Anna eine Wachszieherei, Lebzelterei und Greißlerei am Hauptplatz von
Maissau. Von den 12 Kindern des Ehepaares erlernte Sohn Alfons das
elterliche Gewerbe und eröffnete ge- meinsam mit seiner Frau Christa im
Jahr 1957, dem Geburtsjahr ihres Sohnes Martin, die
Konditorei-Lebzelterei Schmid in der Kremser Straße 20. Das Geschäft
mit den Wachswaren verblieb zunächst im elterlichen Betrieb am
Hauptplatz.
Als Martin Schmid gemeinsam mit seiner Frau Karin im Jahr 1983 das
Familiengeschäft übernahmt, war es in die Wiener Straße 8 übersiedelt,
der ursprüngliche Betrieb am Hauptplatz wurde bereits im Jahr 1972
geschlossen. Unter dem von 2000 bis 2010 auch als Bürgermeister die
Geschicke des Ortes prägenden Martin Schmid wurde die Konditorei zu
einem lokalen Fixstern und zog mit seinen süßen und wächsernen
Produkten Kundschaft aus ganz Niederösterreich an. Das Angebot reichte
von der Lemonitafel über die klassischen Bildzelten bis zur Altarkerze,
die ressourcenschonend ergänzt und in ihrer Lebenszeit verlängert
wurden.

Die Sammlung Schmid
Im Jahr 2021 gelangte als Folge des Ruhestandes von Martin und Karin
die Familiensammlung Schmid, bestehend aus Holzmo- deln, Wachsbildern,
Handwerkszeug und einer umfangreichen Kerzensammlung, als Dauerleihgabe
an das Krahuletz-Museum Eggenburg. Hier wurde der über 450 Stück
zählende Bestand dankbar entgegengenommen und bildet seitdem eine
wertvolle Ergänzung und Erweiterung der bestehenden regionalen Lebzeltersammlung.

Die Lebzelterei und Kerzenzieherei in Maissau weist eine lange
Tradition auf – die erste Erwähnung eines Lebzelters in den Maissauer
Innungsbüchern führt in das Jahr 1642 zurück. Die letzten hundert Jahre
wurden durch drei Generationen der Familie Schmid geprägt, der letzte
Maissauer Lebzelter und Kerzenzieher, Martin Schmid, war von 2000 bis
2010 auch Bürgermeister der kleinen Stadt. Der Familienschatz an altem
Handwerkszeug, Holzmodeln, Kerzen und Wachsgebilden gelangte im Jahr
2021 als Dauerleihgabe in die Sammlungen des Krahuletz-Museums und kann
zu einem großen Teil in der diesjährigen Sonderschau – ergänzt durch
Lebzeltermodeln aus dem Altbestand des Museums – bewundert werden. In
einem eigens für die Ausstellung produzierten Film erzählt Martin
Schmid über Tradition und Handwerk der Lebzelter und Kerzenzieher im
allgemeinen und die Familie Schmid im besonderen.

Goldhauben und Schwarzhauben aus Niederösterreich
Die Haube ist seit dem Mittelalter das Symbol der verheirateten Frau.
Die Redewendung des „unter die Haube kommen" hat sich bis in die
heutige Zeit erhalten. Mit der Französischen Revolution fiel die
strenge Kleiderordnung, die seit dem Mittelalter Bestand hatte. Nun
stand auch Bürgerinnen der Zugang zu kostbaren Materialien offen, die
bis zu diesem Zeitpunkt dem Adel vorbehalten waren. Die reichen, mit
Goldfolien und -perlen bestickten Hauben kamen in Mode und wurden in
allen Bevölkerungsschichten getragen.
Die hier ausgestellten Hauben wurden im 19. Jahrhundert in
Niederösterreich gefertigt. Eine Ausnahme bildet die Linzer Goldhaube,
die zur Trachtenkultur Oberösterreichs gehört. Die Eggenburger
Bürgerinnen bevorzugten die goldenen Gupfhauben, auch Reiche Wiener
Hauben genannt, die ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert aufkamen. Die
Waldviertler Brettlhaube hingegen steht den goldenen Brettlhauben der
Wachau nahe, die als Identifikationsmerkmal des neuen Österreichs ab
1957 auch die 10 Schilling Münzen zierte. Besonderheiten stellen die
schwarzen Hauben der Raabser und Retzer Frauentracht dar, bei denen die
Naht zwischen Kopfteil und sogenanntem Boden der Haube zu einem großen
schmückenden Rad ausgestaltet ist (Radhauben).

Bei einer seiner Wanderungen im Weinviertel rettete Krahuletz 1907 den
reichen Depotfund vor der Entsorgung als Altmetall. Der Depotfund von
Neudorf bei Staatz gilt als eines der am vollstän- digsten
überlieferten Ensembles bronzezeitlicher Prestigeobjekte aus der
Aunjetitz-Kultur (ca. 2300-1600 v. Chr.), der auch die „Himmelsscheibe
von Nebra" angehört. Bei Deponierungen werden die Objekte absichtlich
vergraben. Hier kombinierte und vergrub die adlige Elite prächtige
Trachtbestandteile und außergewöhnliche Einzelstücke.
Und dann gibt es auch eine Sammlung an Backformen und Küchengefäßen.

Damenbesteck - Eisen, Perlmutt, Lederscheide - um 1760

Evangelisten - Holz, bemalt - 2. Viertel 18. Jh.

Diese Ereignisse haben auch in Eggenburg ihre Spuren hinterlassen
Bis zur Revolution der Informationstechnologie Ende des 20.
Jahrhunderts waren Plakate die Hauptinformationsquelle in einer
Kleinstadt wie Eggenburg. Einladungen, Aufrufe, Anordnungen und
Nachrichten an Litfaßsäulen, Plakatwänden oder einfachen Holzzäunen
waren oftmals von dichten Menschentrauben umringt, die die Neuigkeiten
lebhaft diskutierten. Aus den Beständen des Museums werden
schlaglichtartig Objekte, Faksimile von Plakaten, Verordnungen,
Zeitungsberichten usw. mit zeitgeschichtlichen Themen vorgestellt.
Erinnerungstafel der Gemeinde Kattau an Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, 1934
Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der Landwirtschaftskammer,
genoss er bei der Landbevölkerung hohes Ansehen, in vielen Gemeinden
wurde er Ehrenbürger. Seine Rolle bei der Unterdrückung der Opposition
macht ihn jedoch noch heute zu einer der am meisten umstrittenen
Figuren der jüngeren österreichischen Geschichte. Die Erinnerungstafel
überstand den Bildersturm der Nazizeit, musste jedoch 2013 abmontiert
werden. Seit Juni 2014 befindet sie sich als Dauerleihgabe im
Krahuletz-Museum.
Soldat der Roten Armee, 1945
Die Figurine war ursprünglich als „Hochzeitslader" gekleidet Teil der
Volkskunde-Ausstellung. Die Uniform ist ein Geschenk eines sowjetischen
Stadtkommandanten von Eggenburg. Bekleidung und Ausrüstung sind typisch
für die Rote Armee während der zweiten Kriegshälfte und der
Besatzungszeit. Die Schulterstücke weisen den Soldaten als
motorisierten Schützen aus, er ist mit einer Maschinenpistole PPSH 41
bewaffnet.
Improvisierte rot-weiß-rote Fahne, Eggenburg Mai 1945
Die roten Streifen wurden aus dem roten Tuch einer Hakenkreuzfahne
geschnitten. Deutlich ist auf beiden Streifen der Sitz der zuvor
abgetrennten Stoffscheibe mit dem Hakenkreuz erkennbar. Für den
Mittelstreifen verwendete man offenbar ein altes Leintuch oder einen
Matratzenbezug.

Fayencen - Ursprünge und Werkstätten
Unter Fayencen versteht man irdene Keramik mit einem deckenden, zumeist
weißen Überzug aus Zinnglasur. Der Name leitet sich von einer der
Ursprungsregionen europäischer Fayencen, der italienischen Stadt
Faenza, ab. Ein weiteres Zentrum der Fayenceherstellung befand sich in
Delft in den Niederlanden; hier entstanden ab dem 17. Jahrhundert unter
dem Einfluss der importierten chinesischen Porzellane Fayencen mit
prachtvollen „Chinoiserien" - Landschaftsszenen in asiatischem Stil.
Angeregt von den niederländischen Fayencen nahmen bereits im 18.
Jahrhundert im deutschen Raum die ersten großen Fayencemanufakturen
ihren Betrieb auf, unter anderem in Hanau, Frankfurt am Main oder
Bayreuth. In den österreichischen Erblanden war zur selben Zeit die
Herstellung noch in der Hand kleinerer, handwerklicher Betriebe. Die
meisten Fayencetöpfereien produzierten im Gebiet des heutigen
Niederösterreichs - in diesem Bereich waren zeitweise bis zu 40
„Weißhafner"-Werkstätten tätig, unter anderem in Langenlois,
Hausleiten, Zellerndorf und Hollabrunn. Eine Sonderstellung innerhalb
der niederösterreichischen Fayencen nimmt die rot akzentuierte Keramik
aus Leobersdorf ein (Rotmalerei). Vergleichbare Stücke wurden in
Holíč/Holitsch (heute Westslowakei), der ältesten Fayencemanufaktur der
Monarchie, produziert; gegründet wurde diese im Jahr 1743 durch den
Gemahl der Kaiserin Maria Theresia, Franz-Stephan von Lothringen. Die
großen Fayencezentren des heutigen Westösterreichs entstanden in
Gmunden, Wels und Salzburg.

Teller, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1710
Zunftflasche eines Schneiders, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1697
Teller, Habaner-Fayence, Westslowakei, 1688

Birnkrug mit Heiliger Rosalia, Sieghartskirchen (?), um 1770
Godenschale, Geschenk der Gode (Taufpatin) an die Wöchnerin, Fayence, Niederösterreich, 2. Hälfte 18. Jh.

Das erste Porzellan in europäischen Händen stammte aus dem asiatischen
Raum: Chinesisches und japanisches Porzellan fand vor allem durch
niederländische Handelsgesellschaften ab der Mitte des 16. Jahrhunderts
seinen Weg nach Europa. Das Geheimnis seiner Herstellung war allerdings
zunächst unbekannt. Erste Erfolge in der europäischen
Porzellanherstellung verzeichneten schließlich die Arkanisten, also
frühen Chemikern, um Johann Friedrich Böttger: Dieser experimentierte
als Gefangener des sächsischen Fürsten August des Starken ab dem Jahr
1707 zur Herstellung von Porzellanen. Die Erzeugung von vollwertigem
weißem Hartporzellan gelang 1709 die Geburtsstunde der Meissner
Porzellanmanufaktur (ab 1710). Trotz der höchsten Geheimhaltung ließ
sich nun der Siegeszug des „Weißen Goldes" über das europäische
Festland nicht aufhalten. Flüchtende und reisende Arkanisten brachten
die Rezepturen an verschiedene Orte und in die einzelnen Fürstentümer,
wo sich lokale Adelige um eine Teilnahme in dem Wettlauf der
Porzellanherstellung bemühten.
In Wien hielt das feine Tafelgeschirr im Jahr 1718 mit der Gründung der
ersten Wiener Porzellanmanufaktur durch Claudius Innocentius Du Paquier
seinen Einzug. Die Herstellung gelang Du Paquier nur mit Hilfe der aus
Meißen abgeworbenen beziehungsweise geflohenen Arkanisten Christoph
Konrad Hunger und Samuel Stölzel. Die ab 1744 in Staatsbesitz
befindliche Manufaktur bestand bis 1864 - ihre Fortführung im Wiener
Augarten-Porzellan beruht auf einer Neugründung im Jahr 1924. Die in
den ersten 150 Jahren des Bestehens hergestellten Geschirre waren und
blieben ein exklusives Produkt - dies bereitete einerseits den Boden
für zahlreiche Fälschungen und Imitationen, andererseits erklärt es den
durchschlagenden Erfolg des ab dem späten 18. Jahrhundert aufkommenden,
billigeren Steinguts. Markenzeichen des Wiener Porzellans war der
unterglasurblaue Bindenschild, durch weitere Stempel und Nummern haben
sich die beteiligten Handwerker, Weißdreher, Bossierer, Blaumaler und
Buntmaler, verewigt - wenn auch eigentlich nur für die betriebsinterne
Abrechnung.
Teller mit Ansicht der Teinskirche in Prag, Steingut mit Umdruckdekor
Manufaktur Nowotny & Co. Altrohlau/Stará Role, 1830-1850

Glashütten des Mittelalters und der frühen Neuzeit stellten vorwiegend
grünliches oder gelbliches „Waldglas" her - die unbeabsichtigte Färbung
wurde durch Verunreinigungen der Ausgangsmaterialien verursacht. Die
hohe Kunst des Entfärbens, bereits den Römern bekannt, beherrschten im
15. und 16. Jahrhundert vor allem die Venezianer. Das venezianische
Glas stellte den Inbegriff der Glaskunst dar und wurde in den
Erzeugnissen à la façon de Venise aus barocken Glashütten nördlich der
Alpen nachgeahmt. Eine vergleichbar hohe Qualität erreichten erst
böhmische Glashersteller, die im ausgehenden 17. Jahrhundert schon
herausragende Produktionen in Gratzen/Nové Hrady und Wilhelmsberg bei
Heilbrunn/Hojná Voda betrieben. Der eigentliche Siegeszug des
Böhmischen Glases nahm allerdings erst mit der Erfindung des
schleifbaren Kreideglases um 1683 seinen Ausgang.
Biedermeierglas
In Folge des Aufschwungs der Böhmischen Glashütten ab dem frühen 18.
Jahrhundert erreichte die Glaskunst im Biedermeier eine neue Blüte.
Neben aufwändig geschliffenen und gravierten Gläsern sind die ab den
1820ern produzierten, bunten Überfanggläser für die gehobene Wohnkultur
dieser Epoche charakteristisch. Die Herstellung der Überfanggläser
setzte großes handwerkliches Können voraus: Um ein transparentes Glas
von innen oder außen mit farbigen Glasschichten zu bedecken (d. h. zu
überfangen), bediente man sich einer komplizierten „Trichtertechnik",
wobei alle verwendeten Glasmassen sowohl die transparente als auch die
farbigen - den gleichen Schmelzpunkt haben mussten. Zu den Farbgläsern
gehörten auch die seltenen Urangläser, deren leuchtend gelbe oder grüne
Färbung (Annagelb, Annagrün) durch die Beimengung von radioaktivem Uran
herbeigeführt wurde. Edelsteingläser (Hylalith- und Lithyalingläser)
imitierten mit ihrer Marmorierung kostbare Schmucksteine. Die schon
seit dem Spätbarock beliebten, weiß getrübten Milchgläser eigneten sich
hingegen als neutraler Malgrund für Miniaturen, Personen- oder
Landschaftsdarstellungen. Weitere Besonderheiten der Biedermeierzeit
stellen die Pasten- oder Münzgläser dar, bei denen ein Reliefplättchen
(Paste), zumeist einer Porträtbüste, oder ein Geldstück in einem
aufwändigen Verfahren in die Gefäßwandung oder den -boden
eingeschlossen wurde.

Der poröse, wasserdurchlässige Scherben von Fayence
besteht aus Tonerde mit Zusätzen aus Quarz oder Kalk, sie gehört somit
zur Irdenware. Die charakteristische weiBe Glasur basiert auf einer
zinnoxidhältigen Fritte (Glasschmelze); das Zinnoxid ist verantwortlich
für die weißliche Trübung der Glasur. Der Dekor war zunächst auf die
vier Scharffeuerfarben Grün (Kupfer), Blau (Kobalt), Gelb (Antimon) und
Braunviolett (Mangan) beschränkt, die den hohen Temperaturen beim
Ausbrennen standhielten. Die Farbpalette erweiterte sich im 19.
Jahrhundert unter anderem durch chromoxidhältige Farben.
Steingut hat ebenso wie
Porzellan die weiße Kaolinerde als Grundstoff, zusätzlich sind dem
Scherben Quarz, Feldspat, Kalkstein und Magnesiumsilikate beigesetzt.
Die glänzende Oberfläche entsteht durch das Aufbringen einer
durchscheinenden, bleioxidhältigen Glasur. Bei den häufigen
Umdruckdekoren kam neben den üblichen, auf Metalloxiden basierenden
Farben (Kobaltoxid, Chromoxid ...) auch die radioaktive Pechblende
(Uraninit) zum Einsatz.
Porzellan besteht aus den
Grundstoffen Kaolin (weiße, vorwiegend aus dem Mineral Kaolinit
bestehende, eisenarme Tonerde), Feldspat und Quarz im ungefähren
Mengenverhältnis 50:25:25. Für einen Dekor unter der Glasur wurden
Scharffeuerfarben - häufig Kobaltblau - verwendet, die die hohen
Brenntemperaturen des Glattbrandes überstanden. Auch die weniger
hitzebeständigen Aufglasur- oder Muffelfarben basieren auf Metalloxiden
wie Eisen, Kupfer, Chrom oder Gold, versetzt mit Bleioxid oder
Borverbindungen als Flussmittel.
Die Grundstoffe von Glas sind
Quarz, sowie sogenannte Flussmittel mit niedrigerem Schmelzpunkt. Als
Flussmittel können Holzasche beziehungsweise die aus Holzasche
gewonnene Pottasche (Kaliumcarbonat) sowie mineralische oder aus
Pflanzen gewonnene Soda (Natriumcarbonat) verwendet werden; ebenso in
Verwendung waren Weinstein, Steinsalz oder Salpeter. Wesentlich für die
Herstellung waren zudem die großen Mengen an gutem Brennholz, die ein
Glasofen vor der Industrialisierung benötigte. Für eine weitere
Verarbeitung wurden die Quarzkiesel oder -brocken in den sogenannten
Pochwerken zu feinem Sand aufgearbeitet. Die grünliche oder gelbliche
Tönung des nördlich der Alpen produzierten „Waldglases" ist auf
Eisenoxidverschmutzungen der Ausgangsmaterialien zurückzuführen, eine
Entfärbung des Glases erreichte man durch die Beimischung von
Braunstein (Manganoxid) oder Arsenoxyd. Bleioxide sorgten für den
nötigen Glanz und die Festigkeit der Böhmischen Bleikristallgläser, die
Zugabe von Kreide ergab ein elastisches, zum Schleifen geeignetes Glas.
Für die Herstellung von in der Masse gefärbten Gläsern griff man auf
Metalloxide zurück: Mit Hilfe von Kupfer erzielte man Blau-, Grün- und
ledrige Rottöne, Kobalt wurde für Blau, Gold für Rot, Eisen und Chrom
für Grün, Uranoxid für Gelb oder Grün herangezogen. Die weißliche
Trübung des Milchglases wurde durch die Beimengung von gebrannten
(kalzinierten) Tierknochen oder Zinnoxid herbeigeführt. Bei der
Herstellung von an der Oberfläche färbenden Beizen kam ebenfalls Kupfer
zum Einsatz (für eine Rotfärbung), für Gelbbeize verwendete man Silber.

Jagdgewehr, um 1845
Vorderlader mit Perkussionsschloss, sechskantiger, glatter Lauf, unterhalb befindet sich der hölzerne Ladestock.
Hersteller: Georg Krahuletz, Eggenburg

Bevor es zum 2. Weltkrieg kam, wurde der 1. Weltkrieg als 'Der Große Krieg 1914-1918' bezeichnet.

Jagdgewehr, um 1845
Vorderlader mit Perkussionsschloss, sechskantiger, glatter Lauf, unterhalb befindet sich der hölzerne Ladestock.
Hersteller: Georg Krahuletz, Eggenburg

Uhrwerk der Turmuhr der Eggenburger Pfarrkirche
Pfeilerwerk, Spindelhemmung, Schlagwerk mit Gestänge zu den Glocken Eggenburg, 1. Hälfte 18. Jhdt.

Figurenuhr, Sogenannter „Uhrenmann", Um 1850

Taschenuhr „Esquivillon & Dechoudens", Spindelhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Gehäuse aus Silber
In einem Taschenuhrständer aus Holz, Genf, um 1800

Tischuhr, Stiftankerhemmung mit Unruhe Fa. Mauthe Gmbh, Deutschland, um 1940

Zeitmesser
Die Einteilung der Zeit war immer wichtig für den Menschen. Aus der
Altsteinzeit kennen wir Objekte, die wahrscheinlich zum Zählen von
Tagen oder als (Mond)kalender dienten. Eine feinere Unterteilung der
Zeit war damals vermutlich nicht notwendig. Mit dem Entstehen der
ersten Hochkulturen und arbeitsteilig organisierter
Gesellschaftssysteme wurden aber Stunden und Minuten wichtige Faktoren
zur Gliederung des Alltags. Die frühesten Mittel, die Zeit zu messen
waren Sonnenuhren. Aus Ägypten sind solche schon aus dem 13.
Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen. In der Antike konstruierte man
bereits Sonnenuhren mit komplexen Tabellen, an denen sich die Zeit
erstaunlich exakt ablesen lies. Im Mittelalter gab es Sonnenuhren vor
allem in den Klöstern, um den Mönchen ihre Gebetszeiten anzuzeigen.
Wasseruhren wurden im Mittelmeerraum mindestens seit 1400 v. Chr.
eingesetzt. Mit diesen ließen sich Zeiträume, unabhängig vom Stand der
Sonne abmessen. Einfache Konstruktionen bestanden aus zwei Gefäßen, bei
denen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Wasser von einem in das
andere tropfte. Bei komplexeren
Wasseruhren benützte man das Wasser zum Antrieb von Schaufelrädern, die
sich innerhalb normierter Zeiträume drehten. Sanduhren, die dasselbe
Prinzip wie die Wasseruhren nutzen, kamen erst im Spätmittelalter, etwa
um 1300 auf. Die ersten mechanischen Räderuhren gab es um die gleiche
Zeit. Frühe, oft monumentale Räderuhren dienten meist astronomischen
Beobachtungen. Sehr bald wurden mechanische Uhren, deren Räder durch
große Gewichte angetrieben wurden, auf den Türmen von Kirchen und
Rathäusern angebracht. Lange besaß solcherart die Obrigkeit das
„Zeitmonopol" und bestimmte, wie die Uhren zu gehen hatten, nach denen
sich die Bevölkerung orientieren musste. Standuhren, die nach demselben
Prinzip funktionierten blieben einer zahlungskräftigen Oberschicht
vorbehalten, ebenso wie die ersten tragbaren Dosen- und Taschenuhren,
bei denen das Uhrwerk durch einen Federmechanismus angetrieben wurde.
Erst mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wurden dank
der Massenfertigung Räderuhren zu Alltagsgegenständen und die Messung
der Zeit individuell möglich.

Urzeit der Uhrzeit
Bei der Einteilung der Zeit orientierte man sich zunächst vor allem am
Stand der Sonne, was zur Folge hatte, dass jeder Ort seine eigene Zeit
hatte: Mittag war dann, wenn die Sonne den höchsten Punkt ihrer Bahn
erreicht hatte. Dies störte nicht, solange man sich nicht schneller als
zu Pferd fortbewegen konnte. Die Koordinierung der Ortszeiten wurde
erst Mitte des 19. Jahrhunderts, durch die Erfindung der Eisenbahn,
notwendig. Um ihre Fahrpläne erstellen und einhalten zu können,
benötigten die Eisenbahngesellschaften überregionale Betriebszeiten.
Folglich sprach man von der „Eisenbahnzeit", die sich aber von der
außerhalb des Eisenbahnbetriebs gültigen Zeit unterschied. Da das
Nebeneinander von Eisenbahnzeit und regionaler Ortszeit zu großer
Verwirrung führte, begann man 1883 mit der Einteilung von Zeitzonen,
die auf der Meridian-Einteilung der Erde basierten. Jeweils 15
Längengrade entsprachen einer Zeitzone, diese folgten in
Stundenschritten aufeinander.
Die Mitteleuropäische-Eisenbahn-Zeit (MEZ), unter dieser Bezeichnung
führten die deutschen und die österreichisch-ungarischen
Eisenbahnverwaltungen 1891 die Zeit des 15. Meridians für den inneren
dienstlichen Verkehr und die Dienstfahrpläne ein. Dieses Zeitformat
setzte sich als das einzig allgemein gültige durch. Seit 1972 wird die
Weltzeit, welche die Grundlage der Zeitzonen bildet, nicht mehr
astronomisch bestimmt, sondern mittels Atomuhren, man spricht auch von
der „koordinierten Weltzeit" - „universal time coordinated" (UTC).

Taschenuhr - Signiert: „Anderei Zimerman Neumarkt" Spindelhemmung,
Federantrieb mit Schlüsselaufzug In einem Übergehäuse mit
Schildpattrücken Kette mit einem Anhänger mit dem Zunftzeichen der
Müller Neumarkt, um 1780
Taschenuhr - Signiert: „Joh. Riel in Stadtamhof" Spindelhemmung,
Federantrieb mit Schlüsselaufzug In einem übergehäuse mit
Schildpattrücken Stadtamhof, Regensburg, um 1780
Taschenuhr - Signiert: „Martin Kesler a Villach N.21" Spindelhemmung,
Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Gehäuse vergoldet Villach, um 1790
Uhrwerk einer Taschenuhr - Zylinderhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Um 1850
Uhrwerk einer Taschenuhr - Ankerhemmung, Federantrieb mit Schlüsselaufzug, Um 1860

Ausgestellt sind über 150 Uhren aus 4 Jahrhunderten, darunter
Besonderheiten wie Taschen-Sonnenuhren oder Turmuhren samt Läutwerk.
Eine Kostbarkeit ist die Adleruhr, auf der Napoleon Bonaparte als Adler
die „Neue Zeit" enthüllt.


Pendule - Ankerhemmung, Messingplatinen
Geschnitzte Figuren, Hirsch mit Jagdhund, darüber Diana, Um 1795

Stockuhr - Ankerhemmung, Repetitionsschlagwerk mit zwei Rundgongs 1. Hälfte 19. Jhdt.

Stockuhr „Johann Papt: Ruefs in Karlstein"
Spindelhemmung, Repetitionsschlagwerk mit zwei Glocken Karlstein, 2. Hälfte 18. Jhdt.

Bodenstanduhr „Nitschner in Egenburg No209"
Ankerhemmung, zwei Glocken, Wecker Eggenburg, zwischen 1748 und 1750

Jagen und Sammeln Altsteinzeit zwischen Donau, March und Thaya
Der Raum, der von den Flüssen Donau, March und Thaya begrenzt wird, ist
durch die unterschiedlichen Landschaften des Wald- und Weinviertels
geprägt. In der Altsteinzeit (Paläolihtikum) stellten die Flusstäler
keine Hindernisse für die eiszeitlichen Tiere und Menschen dar.
Vielmehr waren sie Einzugs- und Durchzugsgebiet der Wildtiere während
ihrer weiträumigen, jahreszeitlich bedingten Wanderungen, denen sich
auch der Mensch im Zuge seiner Nahrungs- und Jagdstrategien anschloss.
Seine Siedlungs- und Lagerplätze waren länger- oder kurzfristig
aufgesuchte Stellen (zumeist Freilandsiedlungen und Höhlen).
Im Vergleich zu anderen Gebieten Europas sind in diesem Raum gesicherte
Nachweise früher menschlicher Präsenz erst relativ spät um ± 45/40.000
Jahren vor heute im ausgehenden Mittel- und beginnendem
Jungpaläolihtikum fassbar. Vermeintliche Geröllgeräte, die nicht im
archäologischen Zusammenhang gefunden wurden und als sehr alt angesehen
werden, finden hier keine Berücksichtigung. Frühe Funde kennen wir aus
der Gudenus Höhle im Kleinen Kremstal und von Südmähren aus dem
Mittelpaläolithikum. Auch von Fundplätzen des sog.
"Plateaulehmpaläolithikums" im nördlichen Waldviertel liegen einige
"archaisch" wirkende Steingeräte vor, deren genaue Datierung mangels
stratigraphischer Hinweise nicht einfach ist. Im frühen
Jungpaläolithium (Aurignacien, etwa ab 40/35.000-30/28.000 Jahren)
beginnen sich die Fundstellen zu häufen.
Im mittleren Jungpaläolithikum (Gravettien, etwa vor 30/29.000 -
22/19.000 Jahren - der ältere Abschnitt wird auch Pavlovien - 30.000
bis 24.000 Jahre genannt), beginnt sich das zuvor wärmere Klima
innerhalb der letzten Eiszeit immer mehr abzukühlen. Aus dieser Zeit
sind auch in unserem Raum Fundstellen in größerer Anzahl bekannt.
Danach wird das Klima durch ein Kältemaximum (Hochwürm) vor
22.000-18.000 Jahren, verbunden mit mächtigen Lössablagerungen,
geprägt. Diese Kaltsteppenlandschaft könnte ein Grund dafür sein, dass
aus diesem Zeitraum und den folgenden 10.000 Jahren nur wenige
Fundplätze bekannt sind (z.B. Rosenburg, Horn-Galgenberg). Ebenso
dürftig sind die Hinweise auf die Besiedlung am Ende der Eiszeit vor
ca. 10.000 Jahren, sowie in der darauffolgenden Mittelsteinzeit
(Mesolithikum) vom 8. bis zum 6. Jahrtausend v. Chr..

Sitzende Frauenstatuette (Venus) aus der Phalange eines Mammuts (Abguss)
Fundort: Predmosti, Tschechien - Alter: ca. 25.000 Jahre, Pavlovien
Venus von Willendorf, Kalkstein (Abguss)
Fundort: Willendorf - Alter: ca. 25.000 Jahre, Gravettien
Venus von Stratzing, „Fanny" - Abguss
Fundort: Stratzing/Rehberg - Alter: 32.000 Jahre

Frühe Jungsteinzeit (5500-4900 vor Chr.) - Linearbandkeramische Kultur
Als erste Bauernkultur im Gebiet des heutigen Niederösterreich trat die
sogenannte Linearbandkeramische Kultur auf. Sie war von Westungarn bis
nach Ostfrankreich und Polen verbreitet. Der Name bezieht sich auch die
typischen, bandförmig eingeritzten Linienmuster.

Jungsteinzeit (5500-2000 vor Chr.) - Wohnen im Neolithikum
Das feste Dach über dem Kopf war eine der Neuerungen, die mit den ersten Bauern nach Mitteleuropa kamen.
Der Ursprung „unserer" Häuser liegt wahrscheinlich in West-Ungarn.
Das Modell der Fassade zeigt, wie ein mittelneolithisches Haus
ausgesehen haben könnte. Die Formgebung basiert in erster Linie auf
einer kleinen, vollständig rekonstruierten tönernen Miniatur aus dem
Neolithikum, die in Střelice (Südmähren) gefunden wurde. Hier erkennt
man deutlich den Eingang an der vorderen Giebelseite sowie den darüber
angebrachten Stierkopf, der wahrscheinlich Unheil abwehren sollte.
Bruchstücke anderer Hausmodelle aus Niederösterreich und Südmähren
tragen ähnliche Tierköpfe an der Giebelspitze. Die tragende
Konstruktion der Wände ist von aussen sichtbar und auf der Miniatur
durch Tonwülste angedeutet. Erhaltene Bemalungsspuren auf
Hüttenlehmresten lassen auf verzierte Außenwände schließen. Als
Verzierungsmotive wurden Muster verwendet, die von der Keramik bekannt
sind. Das Giebelfeld des Hauses trägt das Motiv des Hakenmäanders.

Jungsteinzeit (5500-2000 vor Chr.) - Bestattungen und Grabsitten
Die pietätvolle Behandlung Verstorbener zählt zu den Merkmalen der
menschlichen Gesellschaft. Nach der Sesshaftwerdung und dem Entstehen
dauerhafter Siedlungen begann man ab etwa 5300 v. Chr. mit dem Anlegen
von Friedhöfen.
Das Grab des „ältesten Eggenburgers"
Am 18. November 1932 wurden im sogenannten Pröckhlhaus in Eggenburg
Ausschachtungsarbeiten für einen neuen Kanal durchgeführt. Dabei
stießen die Arbeiter auf ein menschliches Skelett. Die damalige
Leiterin des Krahuletz-Museums, Angela Stifft-Gottlieb, wurde
verständigt. Sie ließ die Knochen vorsichtig freilegen und
dokumentierte die Fundsituation. Es wurden nicht nur die Funde
aufgesammelt, sondern auch der gesamte Rumpf des Skeletts in einem
Stück geborgen. Dies ermöglichte eine originalgetreue Aufstellung des
Befundes in der Schausammlung.
Das Skelett lag etwa 90 cm tief in gestreckter Rückenlage,
nord-süd-orientiert. Die Arme waren an den Körper angelegt, der Schädel
war mit Blick nach Osten auf die rechte Schulter geneigt. Neben und auf
der linken Hand lagen kleinere Tonscherben. Die rechte Hand war vom
Unterarm abgetrennt und an die rechte Wange gelegt, darunter befanden
sich ein kleines Steinbeil und eine Spitze aus Feuersteinmaterial. Die
Scherben und das Beilchen datieren das Grab in die mittlere
Jungsteinzeit (ca. 4700 v. Chr.).
Die Frage, warum die Hand abgetrennt wurde, lässt sich nicht mehr
beantworten. Steckte eine Bestrafung oder gar eine Hinrichtung
dahinter? Die Handknochen sind so schlecht erhalten, dass Schnittspuren
nicht mehr erkennbar sind. Möglich wäre auch, dass es sich um eine
Manipulation nach dem Tod, etwa die Unschädlichmachung eines potentiell
„gefährlichen Toten" handelt. Mit solchen Maßnahmen versuchte man
gelegentlich die Wiederkehr Verstorbener zu verhindern oder ihre
Möglichkeiten, noch nach dem Tod Schaden anzurichten, einzuschränken.
„Der älteste Eggenburger" - Bestattung, Mittlere Jungsteinzeit

Bronzezeit (2200-800 v. Chr.) - Bronzeschmiede und Handelsherren
Die Epoche zwischen etwa 2000 und 800 v. Chr. wird als Bronzezeit
bezeichnet, da sie - zunächst zaghaft, dann immer stärker - durch
Herstellung, Handel und Gebrauch von Metallgegenständen geprägt wurde.
Aufgrund stilistischer und technischer Merkmale - besonders der
Bronzeobjekte - sowie unterschiedlicher Bestattungssitten wird die
Bronzezeit in eine frühe, mittlere und späte Phase unterteilt. Die neu
entstandene Bronzeindustrie bewirkte die rasante Intensivierung auch
der meisten anderen Wirtschaftszweige. Die zunehmende Verwendung und
Verbreitung von Bronzegegenständen förderte überregionale Kontakte, die
zur Herausbildung großräumiger Kulturgruppen führten.
Vielfältige neue Arbeitsbereiche führten zur Entstehung professionell
ausgeübter Handwerksberufe; die unterschiedlichen
Verdienstmöglichkeiten brachten eine zunehmend vertikale Gliederung der
Gesellschaft mit sich. Metallgegenstände eigneten sich hervorragend zur
Anhäufung von Besitz, der dann natürlich auch gehortet und beschützt
werden musste. Zu diesem Zweck könnten „hauptberufliche" Krieger
eingesetzt worden sein, die auch die Handelswege überwachten. Da ein
immer höherer Anteil der Gesellschaft nicht in der Landwirtschaft tätig
war, musste diese stets intensiver und effektiver gestaltet werden, um
die gesamte Bevölkerung ernähren zu können.
Eine der wichtigsten Quellen für die archäologische Erforschung der
Bronzezeit stellen Gräber dar. Anhand des Bestattungsritus, der Form
des Grabbaus, der Totentracht sowie der Beigaben lassen sich
Zeitstellung und kulturelle Zugehörigkeiten feststellen. Einzelne
Keramikgefäße waren raschen Änderungen unterworfen, zum Beispiel die
Tassen. Da sie sehr häufig als Beigaben in Gräbern zu finden sind,
kommt ihnen die wichtige Funktion als „Leitform" für bestimmte
Zeitabschnitte oder Kulturen zu.

Kegelhalsgefäße der Hallstatt-Kultur
Kegelhalsgefäße dienten wahrscheinlich als Getränkebehälter -
beispielsweise für Gewürzwein, der wohl mit Wasser gemischt getrunken
wurde. Die Bezeichnung rührt vom markanten kegelförmigen Oberteil der
Gefäße her. Sie waren oft Teil der Geschirrausstattung von Gräbern aus
der Älteren Eisenzeit, wurden aber auch in Siedlungen gefunden.
Wahrscheinlich hat man sie dort als große Kochtöpfe benutzt.
Kegelhalsgefäße sind eine typische hallstattzeitliche Keramikware. Sie
wurden ohne Töpferscheibe im sogenannten Tonwulstverfahren hergestellt;
die Drehscheibe war in Mitteleuropa ja erst ab 450 v. Chr. bekannt. Die
eindrucksvollen Gefäße wurden sowohl in verzierten oder rot-schwarz
bemalten als auch in unverzierten Varianten gefunden.

Keltengold
Die sagenhaften goldenen „Regenbogenschüsselchen" beflügelten die
Phantasie wie kaum ein anderer Fund. Man glaubte, sie wären von einem
Regenbogen auf die Erde getropft - vermutlich ist dies auch der
Hintergrund des Märchens von den „Sterntalern" der Gebrüder Grimm. Um
etwa 300 v. Chr. begannen die Kelten eigene Münzen zu prägen. Anfangs
ahmten sie die Münzbilder nach, die ihnen durch ihre Handelsbeziehungen
bzw. Söldnerdienste bei den Griechen und Römern geläufig waren. So
imitierten frühe keltische Prägungen beispielsweise griechische Münzen,
auf denen Philipp II. von Makedonien (der Vater Alexanders des Großen)
und ein bärtiger Zeus abgebildet waren. Geprägt wurden Gold, Silber,
Kupfer und Bronze.
Die Forschung versucht anhand der Fundorte, einzelne Münzfunde
keltischen Stämmen zuzuordnen - die bisherigen Resultate sind jedoch
nicht unumstritten. So unterteilt man grob die Münzen der Westkelten
(gallische Stämme), der Ostkelten und der Bewohner der iberischen
Halbinsel, die römische und karthagische Münzen als Vorbild nahmen. Für
unseren Raum interessant sind die Prägungen der Boier und Noriker.
Aufgrund der unterschiedlichen Prägevorbilder können Numismatiker
keltische Münzen datieren. Eine stilistische Entfernung vom römischen
bzw. griechischen Original weist üblicherweise darauf hin, dass die
Münzen jüngeren Datums sind. Der bedeutendste Fundort keltischer Münzen
in Österreich ist Roseldorf. Dort hat man etwa 1400 Münzen, kleine
Metallrädchen als Münzersatz und Goldbarren gefunden.
Kleinsilbermünzen (Oboloi) der Großboier vom Typ Roseldorf II
mit der Darstellung eines Pferdes. Sie wiegen etwa 0,7g und waren ab
etwa 210 v. Chr. im Umlauf. Sie gehören zu den ältesten in Österreich
hergestellten Münzen.

Gläserne Kostbarkeiten
Die Glasherstellung ist seit der Bronzezeit bekannt. Typisch für die
Mittel- und Spätlatènezeit waren jedoch Glasarmreife wie der hier
gezeigte aus Klein-Reinprechtsdorf. Die bunten und profilierten
Glasarmreife, die uns nur sehr selten vollständig erhalten geblieben
sind, verraten die farblichen Vorlieben der Kelten. Die ältesten dieser
zerbrechlichen Kostbarkeiten sind in blauen oder grünen Pastelltönen
gehalten; ab 200 v. Chr. setzte sich dann ein kräftiges Blau durch, das
mit gelben oder weißen Schlangenfäden verziert war. Keltische
Glasarmreife wurden nicht gegossen, sondern wahrscheinlich wie folgt
hergestellt: Man entnahm dem Glasofen mit einem Stab aus Metall oder
feuergehärtetem Holz eine elastische Portion Glasschmelze, die man als
Streifen auf einer etwa sechs bis sieben Zentimeter starken Holzstange
aufbrachte. Die Oberfläche war mit einer dünnen Schicht Tonschlicker
(einem zähflüssigen Wasser-Ton-Gemisch) überzogen, der einerseits das
Holz vor dem Anbrennen schützte, andererseits das Abziehen des
erstarrten Glasreifs ermöglichte. In einem weiteren Arbeitsgang
wickelten die Handwerker die Glasschmelze um das Rundholz, glätteten
die Kanten gleichmäßig und stachen dann Verzierungen ein.
Vollständiger Armreif aus Glas - Klein-Reinprechtsdorf Grab 3
Bruchstücke keltischer Glasarmreife - Roggendorf und Burgschleinitz

Leben und Sterben in der Stadt - In den Städten wohnten Menschen auf
engstem Raum nebeneinander. Das Fehlen von Kanalisation, Müllabfuhr und
hygienischen Grundkenntnissen führte zu Seuchen und niedriger
Lebenserwartung.
Schädel - Da auf dem Friedhof zu wenig Platz war, exhumierte man die
Toten nach einigen Jahren und legte die Knochen ins Beinhaus (Karner).
Eggenburg, Karner, Spätmittelalter

„Rauberkachel" - Glasierte Kachel mit dem Wappen des Georg Rauber zu
Plankenstein. Sie war nicht Teil eines Kachelofens, sondern diente als
Schmuck der Hausfassade. Eggenburg, dat. 1522

SCHANDMASKE - 17. Jahrhundert, Herkunft: angeblich Eggenburg (Leihgabe der LETTER Stiftung, Köln)
Im Mittelalter und frühen Neuzeit verhängte man für bestimmte Vergehen
- etwa üble Nachrede - häufig „Schandstrafen", bei denen der oder die
Verurteilte, dem Spott preisgegeben, öffentlich zur Schau gestellt
wurde. Als Verschärfung konnte das Tragen von Schandgeigen, von denen
sich das Zeigen der „langen Nase" ableitet, oder derartiger
Schandmasken angeordnet werden.

Gedenkraum für Prof. Franz Fischer (1893 - 1968). Lehrer, Maler, Forscher, Chronist, Botaniker

Johann Krahuletz (1848-1928) Büchsenmacher, Eichmeister, Professor für Geologie
Johann Krahuletz wurde am 3. November 1848 in Eggenburg, Kremserstrasse
2, als siebentes von neun Kindern des aus Böhmen stammenden Eggenburger
Büchsenmachers Georg Krahuletz und seiner Frau Anna geboren und ist
hier im 80. Lebensjahr am 11. Dezember 1928 verstorben. Johann
Krahuletz ist als Junggeselle in der Geschichte von Eggenburg als der
wohl repräsentativste und prominenteste Bürger unserer Stadt bleibend
verankert. War er doch mit seinem persönlich so sympathisch
bescheidenen und lauteren Charakter gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein
überaus beliebter und verdienter Mitbürger, etwa als Gründer der
Feuerwehr, als Mitbegründer des Männergesangvereins und Solotenor des
Männerquartetts, als gesuchter Darsteller bei Theateraufführungen, als
beliebter Tänzer und überhaupt als Motor des damals so regen
gesellschaftlichen Lebens hier in seiner Geburtsstadt Eggenburg.
Bereits in jungen Jahren erhielt er durch Candidus Ponz, Reichsritter
von Engelshofen eine eingehende Schulung in der Feldforschung, die
später vor allem durch den Wiener Archäologen Matthäus Much und den
Geologen Eduard Suess tatkräftig gefördert wurde. Durch seine
jahrzehntelange unermüdliche, zielstrebige und erfolgreiche
Sammlertätigkeit hier in unserer Region auf paläontologischem,
urgeschichtlichem und volkskundlichem Gebiet, diesen damals erst im
Aufbruch befindlichen Disziplinen, konnte er wertvollste
wissenschaftliche Beiträge erbringen, womit er sich bald den
persönlichen Respekt und die internationale Anerkennung von vielen
prominenten Forschern und Gelehrten erwarb. Weltgeltung erlangten seine
Fossilfunde, die er vor allem beim Bau der Franz-Josefs-Bahn 1867-1869
bergen konnte. Wie z.B. die nach Krahuletz benannte Seekuh,
Metaxytherium krahuletzi, oder der nach Eggenburg benannte einzigartige
Gavialschädel, Tomistoma eggenburgensis, die Delphinreste und die
reiche fossile Muschel- und Scheckenfauna. Auf Grund dieser reichen
fossilen Fauna wurde ein ganzer Zeitabschnitt im unteren Miozän als
„EGGENBURGIUM" benannt.
1874 entdeckt er den jungeiszeitliche Hyänenhorst, die Fuchsen- oder
Teufelslucken bei Roggendorf, die er systematisch von 1883-1889
ausgräbt. Ebenso bedeutend sind seine ur- und frühgeschichtlichen Funde
wie die Entdeckung der Fundstelle am Vitusberg nahe Eggenburg, der
Heidenstatt, oder seine Grabungen in der slawischen Siedlung
Gars/Thunau und die Depotfunde, das Keramikdepot von Maisbierbaum, die
Bronzedepotfunde von Neudorf bei Staatz und Pfaffstetten bei Ravelsbach
und der prachtvolle Spondylus-Schmuck aus der frühen Jungsteinzeit,
sowie das Pferdezaumzeug aus Mödring bei Horn. Daneben sammelt er
volkskundliche Objekte und baute eine bedeutende Keramik, Glas- und
Waffensammlung auf. Alle hier angeführten Objekte sind in den
Ausstellungsräumen des Museums im zu sehen.
Anfänglich galt er als Sonderling, da er sein erlerntes Handwerk als
Büchsenmacher nicht ausübte und vorerst keinem Beruf nachging, sondern
seine Zeit mit Aufsuchen, Sammeln und Forschen verbrachte. Um seinen
Unterhalt zu verdienen wurde er Eichmeister in Eggenburg, was ihn nur
zweimal in der Woche beschäftigte. Doch immer mehr und immer besser
erkannten auch seine Mitbürger die überregionale Bedeutung und den
enormen Wert der Tätigkeit von Johann Krahuletz. Ende der 1890er Jahre
überlegte Johann Krahuletz kurz, seine umfangreiche wissenschaftliche
Sammlung zu verkaufen, denn ausländische Interessenten boten ihm
beträchtliche Summen. Eggenburger Bürger, darunter der Bürgermeister,
der Leiter der Eggenburger Sparkasse, der Notar, der Stadtarzt und der
Schuldirektor, bemühten sich die Sammlungen für Eggenburg zu erhalten
und gründeten mit anderen Interessierten, wie dem Bezirkshauptmann von
Horn, im November 1900 die Krahuletz-Gesellschaft. Die Gesellschaft
beschloss 1901 den Bau des „Krahuletz-Museums", das bereits am 12.
Oktober 1902 eröffnet wurde und 19 Räume auf einer Fläche von 1094 m²
umfasste. Die Sammlungen wurden schließlich von der Stadtgemeinde
übernommen und Krahuletz bekam auf Lebenszeit eine Rente von 2.000
Kronen und die Kustodenstelle im Museum.
Kaiser Franz Joseph I. ehrte Krahuletz im April 1900 mit dem „Goldenen
Verdienstkreuz mit der Krone" und seinem legendären Museumsbesuch am
28. Juni 1904, Kaiser Karl verlieh ihm 1918 den Titel „Kaiserlicher
Rat" und Bundespräsident Dr. Michael Hainisch, der 1924 das Museum
besuchte, im Jahre 1927 den Titel eines „Professors der Geologie", ein
Titel, der seitdem nie mehr vergeben wurde. 1903 besuchten zahlreiche
internationale Erdwissenschafter anlässlich des Internationalen
Geologenkongresses in Wien das neue Museum.
Ein zeitgenössisches Ölbild im Krahuletz-Saal des Museums zeigt den
Junggesellen Krahuletz mit Geologenhammer und im Hintergrund die Stadt
Eggenburg, ein anderes Bild im Stiegenaufgang zeigt ihn in seinem
kleinen Geburts-, Wohn- und Sterbehaus in der Kremserstraße und
veranschaulicht, wie sehr dessen Räume von der unglaublichen Fülle
seiner Funde überflutet waren.

Rundweg entlang der Mauern und Zinnen - Mittelalterliches Ensemble, mystische Steine, kostbare Weine
Wo Wald- und Weinviertel sich berühren, liegt die von Mauern umringte
Stadt Eggenburg. Die mittelalterliche Grenzbefestigung von Eggenburg
zeigt auf einer Länge von fast zwei Kilometern ein gut erhaltenes
Wehrsystem. Die Mauer mit dem Zinnenkranz wurde im 14. Jh. errichtet.
Vorgelagerte Zwingeranlagen kamen zur Verstärkung hinzu, sowie die im
15. Jh. errichteten Wehr- und Tortürme. Nachdem die Stadtverteidigung
hinfällig geworden war, wurden im 19. Jh. Vorwerke und Stadttore
geschleift oder in Häuser integriert. Zinnen blieben uns als Corporate
Identity des Mittelalters. Befestigungen wurden zu romantischen
Versatzstücken der Stadtlandschaft. Promenaden wurden mit Ausblicken in
die Landschaft und Einblicken in Turmruinen entlang der Mauern angelegt.

Johannes-Nepomuk-Statue an der Hornerstraße

Triumphbogen Karlstal

Pfarrkirche St. Stephan
Weithin sichtbar thront auf einer schroff zur Schmida abfallenden
Klippe die Pfarrkirche zum heiligen Stephanus. Ihre beiden wuchtigen
Türme, das steil aufragende Dach über der Halle und ihr zierlicher
Giebelreiter bilden in ihrem eigentümlichen architektonischen Ensemble
den mittelalterlichen Kern der Stadt. Bau und Ausstattung des
Gotteshauses erzählen eine über 800-jährige Geschichte.
Eggenburg wird schon vor 1135 als Pfarre genannt und war über
Jahrhunderte als Kanzlerpfarre vom Landesfürsten reich dotiert (bis
1564 als Doppelpfarre mit Gars am Kamp). Die großzügige Architektur der
Pfarrkirche und ihre Einrichtung zeugen einerseits vom Kunstsinn
reicher Pfarrherren. Sie trachteten danach, ihren Glauben und zum Teil
auch sich selbst bis an die finanziellen Grenzen in Szene zu setzen.
Andererseits ist die Ausstattung der Kirche Spiegel des Wohlstands
gläubigen Bürgertums sowie künstlerischer und handwerklicher Blüte der
Region. Vom Hauptplatz kommend, bietet sich mit dem ersten Blick auf
die Ostfassade der Kirche das typische Zusammenspiel mehrerer Bauphasen
und einander ablösender Stilepochen. Die beiden markanten Türme mit
ihren Rundbogenfenstern (authentisch erhalten am Nordturm), Bogen- und
Würfelfriesen waren Teil des romanischen Vorgängerbaues der Kirche aus
dem 12. Jahrhundert. An diesen erinnert wohl auch der über dem
zentralen Fenster des Presbyteriums angebrachte Stein der Zwillinge.
Das genaue Aussehen der romanischen Kirche kann bis dato nur vermutet
werden. Beim radikalen Um- bzw. Neubau vom 14. bis zum 16. Jahrhundert
wurden der hochgotische Chorraum (um 1330) und die spätgotische Halle
(1485-1537) mit ihrem Giebelreiter an die beiden Türme geschmiegt. So
erhielt die Stephanskirche ihr auffälliges Profil.

Zum Kanzlerturm und zur Zinnenwanderung verlässt man durch die kleine
Mauerpforte das Stadtinnere. Man wendet sich nach rechts, geht die
Stufen hinab und folgt dem im 19. Jh. angelegten idyllischen Glacisweg
bis zum Obelisken.

Der Durchgang im Westen durchbricht die frühere Ratsherrenhalle. Dadurch wurde um 1700 der
gotische Raum geteilt, abgemauert und eine „Lauretanische Kapelle"
geschaffen. Der Eggenburger Künstler Ernst Degasperi (1927-2011)
gestaltete mit seinen Sgraffiti die Eingangshalle als „Tor zum
Frieden". Die Arbeit thematisiert die heroische Tat von Maria
Grausenburger, einer Bäuerin aus Grafenwörth. Auf abenteuerliche Weise
versteckte sie in ihrem Keller die ungarische Jüdin Elena Weiß und ihre
drei Kinder vor den Nazi-Schergen. Aryeh Weiß, der jüngere Sohn der
geretteten Familie, gestaltete als Dank für die Errettung das
Glasfenster im nördlichen Seitenschiff der Eggenburger Stephanskirche.
Durchgang im Westen von St. Stephan mit Haupteingang, „Tor zum Frieden" (Ernst Degasperi, 1979)

Von Anbeginn ist die Pfarrkirche St. Stephan das Wahrzeichen
Eggenburgs. Das romanische Quaderwerk der Türme dieser mächtigen Kirche
präsentiert sich im ursprünglichen Zustand des 12. Jahrhunderts. Die
Apside stammt aus dem 14. Jahrhundert, das Langhaus - eine spätgotische
dreischiffige Hallenkirche mit Bündelpfeilern und Netzrippengewölbe -
wurde um 1500 vollendet. Nach der Piaristenkirche in Krems ist St.
Stephan die zweitgrößte Pfarrkirche nördlich der Donau.

Die Verbindung der Eggenburger Steinmetze zur Bauhütte St. Stephan in
Wien wirkte sich für die Stadt Glück bringend aus. Viele junge
Eggenburger fanden - dank der reichen Vorkommen des weißen Sandsteines
in der Umgebung - ihren Weg zur Steinmetzkunst. Der zeitliche
Zusammenhang und Ähnlichkeiten zwischen dem Stephansdom in Wien und der
Stephanskirche Eggenburg erklären sich aus diesem Zusammenschluss, und
die Eggenburger nennen ihre Kirche mit einigem Stolz eine „Landausgabe"
des Wiener Stephansdomes.
Der Triumphbogen über dem Volksaltar trennt den Hallenraum vom noch
höheren Chor. Dort zeigt sich das klassische Kreuzrippengewölbe der
Gotik des 14. Jahrhunderts. Die Bemalung von Rippen und
Fensterlaibungen erinnert daran, dass die Kirchenräume der Gotik in
bunten Farben erstrahlten. Die Schlusssteine der Gewölbe in den beiden
Jochen des Chores und im Fünfachtelschluss über dem Altar zeigen
Christus, das Osterlamm, mit der Siegesfahne und Pflanzenmotive.
Hochaltar (Josef Kepplinger und Johann Ignaz Sattler, 1894)

Der neugotische Hochaltar ist Blickfang für die Besucherinnen und
Besucher der Kirche und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Er füllt die
gesamte Ostwand des Chores aus. Bezugnehmend auf den Patron der Kirche,
zeigt der Altar auf einer ersten Bühne die Steinigung des heiligen
Stephanus, der als erster überlieferter Märtyrer der neuen Gemeinschaft um Jesus gilt. Darüber thront Maria als Königin im Kreis der zwölf Apostel.
Maria als Königin im Kreis der Apostel (Hochaltar, Detail)

Die Reliefs an den geöffneten Altarflügeln präsentieren Szenen aus den
biblischen Weihnachtstexten, bei geschlossenen Tafeln erscheinen das
Weinwunder in Kana und das letzte Abendmahl. Der aufwändige Hochaltar
ersetzte im Jahr 1894 im Zuge der neugotischen Umgestaltung der Kirche
einen ebenso ausladend dimensionierten barocken Altar aus dem 17.
Jahrhundert.
Die Steinigung des hl. Stephanus (Hochaltar, Detail)

Lässt man den Blick über die Figur des Auferstandenen (1712) an der
Südseite der Kirchenhalle nach oben gleiten, beeindrucken die hoch
aufragenden gotischen Maßwerkfenster: Kein Fenster gleicht in seiner
Gliederung dem anderen. Gleichzeitig machen sie auf die Eindrücke im
Inneren der dreischiffigen spätgotischen Hallenkirche neugierig.


Die Stephanskirche betritt man, idealerweise vom Westen kommend, durch
das Hauptportal oder durch das Seitenportal an ihrer Südseite. Vom
Mittelgang aus eröffnen sich die Dimensionen der gotischen Architektur
des Gotteshauses. Mit den beachtlichen Innenmaßen (Gesamtlänge: 43,5 m,
Höhe des Chorraumes: 15,8 m, Höhe der Halle: 14,5 m) zählt St. Stephan
zu den größten Pfarrkirchen Niederösterreichs. Die dreischiffige
spätgotische Halle ist durch fein gearbeitete Bündelpfeiler aus
Sandstein gegliedert. Sie tragen das aufwändig gestaltete Netzgewölbe:
Dabei fällt bei genauem Betrachten auf, dass die Decke des mittleren
Schiffes noch phantasievoller und feiner gearbeitet ist als die der
Seitenschiffe. Dadurch wird die Bedeutung des Mittelschiffes
hervorgehoben, die Mittelachse betont und der Blick nach oben bzw. in
den Altarraum gezogen.

Von der reichhaltigen barocken Ausstattung des 18. Jahrhunderts sei
hier der Johannes- Nepomuk-Altar im südlichen Seitenschiff näher
beschrieben. Im zentralen Porträt wird Johannes Nepomuk, der „Heilige
des Beichtgeheimnisses", vorgestellt. In der Dynamik der barocken
Inszenierung thematisieren die Symbole das Bußsakrament und das
Martyrium des Johannes Nepomuk. An den Seiten der Altarwand finden
Skulpturen des Evangelisten Johannes (links) und des heiligen Karl
Borromäus* (rechts) ihren Platz.
Johannes- Nepomuk-Altar (Jakob Seer und Matthias Niedermeier, 1728/29)

Zur Einrichtung des nördlichen Seitenschiffes zählt der ausladende
Marienaltar aus dem Jahr 1723. Thema des Altars ist wohl der Tempelgang
Mariens. Apokryphen Texten zufolge, brachten Anna und Joachim ihre
dreijährige Tochter in den Tempel, wo sie bis zu ihrem vierzehnten
Lebensjahr als Tempeljungfrau diente. Die Legenden wollen die besondere
Erwählung Mariens hervorheben und erzählen unter anderem, dass der
Jubel im Himmel darüber übergroß war und dass das Mädchen im Tempel von
Engeln ernährt worden sei. Tatsächlich zeigt der Altar neben Joachim
und Anna eine große musizierende Engelschar mit Instrumenten. Die
ursprüngliche Skulptur der Maria unter dem Baldachin wurde im Laufe der
Geschichte der Kirche durch eine Madonnendarstellung (um 1690) ersetzt.
Das barocke Ölgemälde an der Westwand des nördlichen Schiffes zeigt die Heilige Familie.
Marienaltar (Jakob Seer, 1723), Maria mit Jesuskind (um 1690) verhängt

Den westlichen Abschluss des Langhauses dominiert die im 17.
Jahrhundert eingefügte Empore mit dem barocken Orgelgehäuse. Der
Prospekt ist mit musizierenden Engeln und Girlanden verziert. Das Werk
der Orgel wurde im Jahr 1963 durch ein neues mechanisches Instrument
ersetzt. Dabei achtete Orgelbaumeister Arnulf Klebel auf die
Besonderheiten des Kirchenraumes mit seinen akustischen Eigenschaften.
Seit einigen Jahren werden in St. Stephan wieder vermehrt Orgelkonzerte
angeboten, da namhafte Organisten und Publikum den qualitätsvollen
Klang des Instrumentes besonders schätzen. An den Wangen der
Orgelempore zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1688 die Verkündigung an
Maria durch den Erzengel Gabriel.
Orgel (Prospekt 1769 vollendet, Werk von Arnulf Klebel 1963)

Kirchenväterkanzel - Das
edelste Kunstwerk in der Eggenburger Stephanskirche ist die
Steinkanzel. Sie erinnert an die Pilgramkanzel des Wiener
Stephansdomes, in deren Tradition sie eindeutig steht. Die Eggenburger
Kanzel ist auf der eleganten Stiege mit 1515 datiert, nach ihr wird die
undatierte Wiener Kanzel auf 1505 geschätzt. Die teilweise vergoldeten
und mit Rötel verzierten Steinskulpturen stellen die vier Kirchenväter
dar.
Das Werk entstand fast gleichzeitig mit der berühmten Kanzel im Wiener
Stephansdom und ist an der Wange des Aufgangs mit 1515 datiert. Die
Ähnlichkeiten in Bildprogramm und Aufbau beider Sandsteinarbeiten sind
offensichtlich. Sie zeigen die Porträts der vier lateinischen
Kirchenväter: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor. Die Kanzel
war mit einem aufwändigen neugotischen Schalldeckel versehen. Er wurde
zusammen mit zahlreichen anderen Ausstattungsstücken aus der gleichen
Zeit bei der Innenrenovierung der Kirche in den 1960er-Jahren entfernt.
Obwohl die Kirchenväterkanzel aktuell in der Liturgie kaum mehr
Verwendung findet, so ist sie dennoch auch heute Symbol für die
zentrale Verkündigungsaufgabe der Kirche.

Kreuzweg

rechts: Taufbecken mit der Skulpur Johannes' des Täufers (1640) beim Aufgang zur Orgelempore

Die Stadtburg - Die Geschichte der „Veste Eggenburg"
Die Veste Eggenburg war von alters her landesfürstliches Lehen.
Erstmals wurde sie im Jahre 1249 von Hermann von Baden erstürmt. 1399
kam es im Zuge der Ausgestaltung der Befestigungsanlagen zum Neubau der
Burg. Als Herzog Albrecht V. anlässlich seiner Mündigkeitserklärung in
Eggenburg weilte, nahm er mit seinem Gefolge in der Burg Quartier. 1486
nahm Matthias Corvinus Eggenburg ein. Nach der Besetzung hatte die Burg
ihre Bedeutung verloren.
Nach mehrmaligem Besitzwechsel wurde 1566 die Burg und Herrschaft mit
Ausnahme des Gerichtes an den Bürgermeister und Rat der Stadt Eggenburg
verpfändet. Als die Veste durch Sturm großen Schaden nahm, bestand der
Kaiser auf Ablösung der Pfänder. Wieder ging der Besitz mehrmals in
andere Hände über. 1756 war das Schlossgebäude so baufällig, dass das
Landgericht verlegt wurde. Beim großen Stadtbrand 1808 wurden die Reste
der alten Veste vernichtet. 1874 kaufte Magdalena Oswald den Besitz.
Sie heiratete den k. k. Oberstleutnant Jaroslav Seitz und ließ auf den
Grundmauern des alten Palas die heutige Villa errichten. Die Anlage ist
heute noch im Privatbesitz der Familie Seitz.

Rund um die Kirche weisen Grabmonumente in vielen Stilarten und
zahlreiche Skulpturen auch darauf hin, dass hier bis 1785 der Friedhof
bestand.
Die barocke Darstellung der Maria Immaculata an der Außenwand der
Apsis, ausdrucksstark gemeißelt vom Eggenburger Meister Franz Strickner
(1721), verweist schon auf die reiche Ausstattung der Kirche und die
große Steinmetztradition Eggenburgs.

Die Pfarrkirche hl. Stephanus ist eine römisch-katholische Kirche in
der Stadt Eggenburg in Niederösterreich. Die Kirche ist ein weithin
sichtbarer und die Stadt überragender Bau mit einem Langhaus mit hohem
Satteldach und einem von zwei Türmen flankierten Chor. Nördlich ist sie
mit einem gedeckten Gang mit dem ehemaligen Pfarrhof verbunden.

Pestsäule


Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne diese Videos antun:
Krahuletz-Museum, Eggenburg, Oktober 2023
Pfarrkirche St. Stephan, Eggenburg, Oktober 2023