web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Heimatmuseum Eggendorf
5.000 Jahre Eggendorfer Geschichte, Juni 2024
Ein Streifzug durch 5.000 Jahre Eggendorfer Geschichte: Das Heimatmuseum Eggendorf lädt zu einer Reise in die Geschichte der Region ein. Objekte aus den verschiedensten Zeitepochen geben Einblick in das einstige Leben der Menschen in der industriell geprägten Gemeinde. Zu sehen sind Funde aus der Hallstattzeit ebenso wie Geräte und Dokumente der kaiserlichen Papierfabrik und der ehemaligen Baumwollspinnerei. In Schaukästen sind alte Kameras, Telefone, Radios, Rechenmaschinen und Fotos ausgestellt.

Wann wurde Eggendorf gegründet?
Zu den Fragen „wer, wann und warum wurde Eggendorf gegründet" gibt es
keine gesicherten Unterlagen oder Urkunden. Man kann nur die
historischen Fakten interpretieren und daraus Schlüsse ziehen. Das
Gebiet von Eggendorf wurde zwischen 770 und 820 n. Chr. von Awaren
bewohnt. Karl der Große besiegte die Awaren 796-800 n. Chr. und
gründete ein Awaren-Khanganat am Plattensee, das bis zur Enns reichte.
Ab 840 n. Chr. sind keine Awaren in Europa mehr urkundlich erwähnt. In
diesen Raum drängten die vom Karpatenbecken kommenden Magyaren nach.
Die Urheimat der Magyaren dürfte der Bereich des Urals gewesen sein,
ein nomadisches Volk, das ab 890 n. Chr. in die pannonische Tiefebene
einwanderte und die Reiterheere Plünderungszüge in ganz Europa
durchführten (wie vorher die Awaren). Nach der Schlacht am Lechfeld 955
n. Chr. zogen sie sich aus dem jetzigen Österreich (ausgenommen
Burgenland) nach Westungarn zurück und wurden sesshaft. Die Grenze
Leitha-March war aber nach wie vor unruhig. 976 kommt es zur Gründung
der Mark Ostarrichi und Karanthanien.
Das Königreich Ungarn wurde am 20. 8. 1000 von Stephan I. gegründet
(Königskrone vom Papst Silvester). Er christianisierte die heidnischen
Magyaren. Es kommt immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen
mit den Ungarn (1035 und 1041). Das Eggendorfer Gebiet lag in der
Steiermark (Karanthanien) und nach 1192 (Georgenberger Handfeste) in
dem babenbergischen Herzogtum. Zur Grenzsicherung wurden ab 1100
zwischen Triesting und Piesting Grenzsiedlungen gebaut: Schönau,
Günselsdorf, Teesdorf, Tattendorf, Gebendorf, Oberwaltersdorf, Trumau.
Da die Kirche in Untereggendorf zwischen 1160 und 1220 erbaut wurde,
kann man für Eggendorf ca. 1080 bis 1160 annehmen. Wie bei den
Grenzsiedlungen zwischen Triesting und Piesting, erfolgte der Auftrag
zur Planung vom König (Schenkung von Königshufen) und die Ausführung
der Planung durch fränkische Vermesser. Die strategische Anordnung des
Dorfes zwischen den Burgen Lichtenwörth und Ebenfurth wurde nur durch
die Mäander der Fischa gestört, dadurch musste Eggendorf geteilt
werden. 12 ganze Lehen oben und 12 ganze Lehen unten. Ab dem 14 Jhd.
kam es zur Teilung der ganzen Lehen (1½ und ½ Lehen); 1751 zur
„Theresianischen Fassion" gab es nur mehr 7 Lehen mit >10 Joch
(OE03, 17, 27, 34; UE 09, 10, 33) bei 48 Höfen und 8 Hofstadeln und
einer Gesamtgröße von Ober- und Untereggendorf mit 360 Joch Hausäcker
(ohne Freihof, Mühle, Pfarre und Gemeinde).
In der Literatur war man bisher der Ansicht, dass Ober- und
Untereggendorf 2 selbstständige Orte waren und erst zur Gemeindewerdung
1850 zu Eggendorf vereinigt wurden. Aus der derzeitigen Datenlage muss
dies aber überdacht werden. Die Trennung des Ortes in 2 Teile erfolgte
bei der Gründung durch landschaftliche Gegebenheiten. Zur Verwaltung
gab es nur einen Freihof und die „Edelfreien Herrn" nannten sich alle
„von Eggendorf (Luidolt von Ekchendorf oder Erchengar von Ekchendorf
usw.). Die Benennung Ober- und Untereggendorf erfolgte ab Mitte des 14
Jhd. durch die Aufteilung des Ortes auf mehrere Grundherrschaften
(Puchhaimer, Stubenberger, Fronauer, Pergauer usw.) aus Gründen der
Übersichtlichkeit. Zur Grenzsicherung durch die Errichtung von Dörfern
(Günselsdorf, Tattendorf, Eggendorf ....) wurde auch Wiener Neustadt
als Grenzfestung (Stadtmauer, Wassergraben, Soldaten) 1194 gegründet.
Die Gründung von Eggendorf kann man daher auf den Zeitraum von 1080 bis
1160 eingrenzen.

Wer hat Eggendorf gegründet?
Dazu gibt es leider keine gesicherten schriftlichen Unterlagen oder
Urkunden. Man kann nur die historischen Fakten interpretieren und
daraus Schlüsse ziehen. Das Gebiet von Eggendorf gehörte im 11. und 12.
Jhd. zur Mark Pitten bzw. zur Steiermark. Die Grenze zum Herzogtum
Österreich bildete die Piesting. Durch die Georgenberger Handfeste kam
es 1192 zu einer Vereinigung. Ortsgründungen in Grenz- oder eroberten
Gebieten konnten in dieser Zeit nur vom König durchgeführt werden; sie
erfolgten in der Regel durch eine Schenkung von Königshufen an den
Markgrafen. In Eggendorf waren es ca. 12 Königshufe (24 ganze Lehen).
Der genaue Standort wurde vom Grafen bestimmt, die Planung erfolgte
durch Vermesser mit der sogenannten Königsrute (1 Königshufe ist 79.52
ha, 1 Königsrute ist 4.72m). Die Anordnung der Häuser und Hausäcker
erfolgte wie beim „Fränkischen Reihendorf". Die Verwaltung (Abgaben und
Robott) erfolgte durch den Freihof durch „Edelfreie Herrn". Die Größe
der Lehen betrug ca. 15 Joch.
Aus der derzeitigen Datenlage kommen für die Gründung von Eggendorf
zwei Herrschergeschlechter in Frage; die Grafen von Pitten mit Ekbert
II oder III von Formbach und der Markgraf der Steiermark Otakar III.
Graf Ekbert I. hatte noch in den achziger Jahren des 11 Jhds das Gebiet
östlich der Schwarza um das Zentrum Pitten und Neukirchen erschlossen
und militärisch gegenüber Ungarn gesichert. Sein Sohn Ekbert II hat die
beherrschende Stellung in diesem Gebiet (Gloggnitz, Neunkirchen,
Pottschach, Schwarza, Grimmenstein) ausgebaut. Die Burgen Pitten,
Grimmenstein, Kranichberg und Klamm bildeten die Pfeiler seiner
Herrschaft. Als Gegenmaßnahme zu dieser Bildung des „Pittnerländchens"
wurden von Otakar III. die Burgen Emmerberg, Wulfingstein und Packstein
mit Gefolgsleuten besetzt und im Norden das Pittner Gebiet von
Österreich abgeriegelt. Als neues Zentrum forcierte Ottokar III.
anstelle von Pitten und Neunkirchen das nahe zu Österreich gelegene
Fischau (1166 und 1185 Landtaidinge). Mit dem Aussterben der Traungauer
(Otakar IV., Georgenberger Handfeste) fällt die Steiemark (und Pitten)
an Leopold V. (Babenberger). 1246 (die Babenberger sterben mit
Friedrich II. der Streitbare aus) wird Pitten Fiskalgut. In einer
Urkunde von König Friedrich dem Schönen von 1316 wird Eggendorf als
Fiskalgut vom Haus Pitten genannt und verpfändet. Wer war nun der
Gründer? Die Namensähnlichkeit von Ekbert (II oder III) oder Markgraf
Otakar III. mit Beziehungen zur Burg Emmerberg. War es der Graf von
Pitten oder der Markgraf der Steiermark. Nach den äußeren Umständen
kommt ein Zeitfenster von 1080-1160 in Frage.

Die Kirche St. Paul - Die alte Steinkirche
Die erhobenen Entstehungsdaten der Steinkirche aus den Jahren 1160-1220
lassen keinen Schluss über eine eventuelle Vorgängerkirche aus Holz zu.
Die Steinkirche könnte von Ministerialen der Formbacher (der
Emmerberger?) erbaut worden sein, da die Kapelle der Ruine Emmerberg
durchaus Parallelen zur Eggendorfer Kirche aufweist.
Weitere Baumaßnahmen
Während die romanischen Teile vor allem die heutige Sakristei und Teile
der noch sichtbaren südlichen Außenwand betreffen, finden sich gotische
Bauteile im Bereich der heutigen Sakristei und im neu erbauten
Chorturm. Neben der Verstärkung der Außenwand finden sich die Konturen
der ehemaligen Eingangstür. Kurz vor dem 2. Türkeneinfall erfolgte 1682
die Erweiterung des Langhauses, und damit wurden die Größenmaße der
heutigen Kirche definiert. Mit der um 1728 erfolgten Barockisierung des
Innenraums mussten zur Verstärkung der beiden Kuppeln tragende Säulen
errichtet werden. Die letzten wichtigen Änderungen im 18. und 19.
Jahrhundert betrafen die außen gut sichtbaren Verstärkungen sowie den
Bau einer gemauerten Turmstiege, um bei Bränden Gefahren zu verhindern.

Verschiedene Diözesanzugehörigkeiten
Unsere Gegend gehörte in karolingischer Zeit zur Karantanischen Mark
und in der Folge zum so genannten Pittener Gebiet. In der ersten Hälfte
des 11. Jahrhunderts kam es zu einer Änderung der diözesanen
Zugehörigkeit: Damit lag das Gebiet der künftigen Pfarre Eggendorf
nunmehr im Sprengel der Erzdiözese Salzburg. Bis zum Jahre 1785 blieb
Eggendorf salzburgisch und befand sich damit in einem
„Drei-Diözesen-Eck" in Nachbarschaft mit Ebenfurth (Diözese Passau) und
mit Zillingdorf (Diözese Raab). Erst 1785 wurden das Industrie- und
Weinviertel der Erzdiözese Wien zugeteilt.


Dehel „Demaria-Lapierre" 1936 / Voigtländer „Bessa" 1935

Telefon W 6760 und ÖBB 11688, 1948

Voigtländer „Avus" ca. 1913

AEG „Deutscher Kleinempfänger" 1938

Hea „Trixi 230 UN" 1964 / Minerva „Mirella 612" 1961-66 / Kapsch „Musette" 1965
Radione „Gipsy" 1957 / Nordmende „Cambridge" 1971-72 / Ingelen „TRv 100 Portable" 1957

Filmprojektor Eumig P8 „Imperial" / Filmprojektor „Eumig P II" 1980
Diaprojektor „Leitz Prado 250" 1955 / Diaprojektor „Pani Pantax" 1972
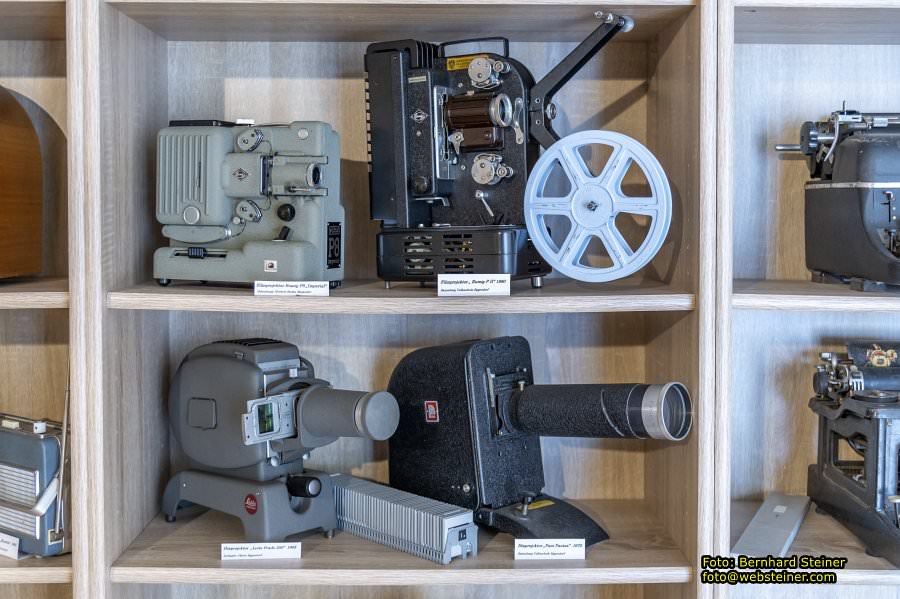
LC. Smith & Bros „Typewriter“ 1906

1316, März 28, HHStA
König Friedrich der Schöne verpfändet mit Zustimmung seiner Brüder an
Konrad von Werd (Werde) für 700 Pfund Wiener Pfennige, die er Konrad
für dessen Dienst an den Rhein geben soll, die Burg zu Pitten samt
allem Zubehör und 30 Mut Hafer Marchfutter (entspricht ca 54.000 Liter)
in den Dörfern Ekchendorf, Niedern Zemmingdorf, Ober Zemmingdorf,
Treuchendorf, Judenfuert, Chotzdorf, Eyczgendorf, Hadreinswerde
(Haderswörth) und Swartzza (Schwarzau) mit dem Rechte der freien
Verfügung über die Pfandschaft und erklärt Konrad nicht vor Bezahlung
der Schuldsumme aus dem Besitze der Burg zu entfernen (enthausen).
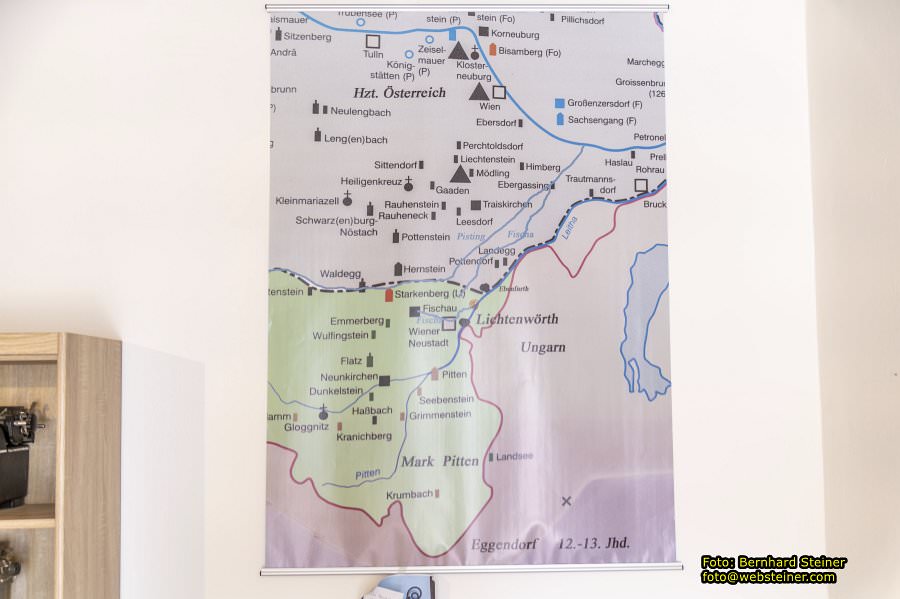

Schreibmaschine „AEG Mignon 2" 1925

Ein Wirrwarr an Besitzrechten
Mit dem Bereitungsbuch von 1590/91, bei dem die Feuerstellen bzw.
behausten Güter jedes Ortes aufgezeichnet wurden, erfasste man auch die
jeweiligen Lehensherren: So waren in Ober-Eggendorf von den insgesamt
31 Häusern 6 Häuser dem Neustädter Bischof lehenspflichtig, die
restlichen 25 Häuser befanden sich in „Streubesitz", sollten aber im
17. Jahrhundert durch diverse Käufe zur Herrschaft Pottendorf kommen
und 1671 nach der Hinrichtung des Grafen Nádasdy kaiserliches Kammergut
werden. In Unter-Eggendorf, das 1590/91 aus 26 Häusern bestand, waren
14 dem Neustädter Bischof und 4 Häuser dem Pfarrer von Lichtenwörth
lehenspflichtig, die restlichen 8 Häuser hatten verschiedene
Lehensherren. Zum Vergleich: 1850, also unmittelbar vor der
Zusammenlegung der beiden Ortsteile zu einer Gemeinde gehörten in
Ober-Eggendorf von insgesamt nunmehr 37 Häusern 29 zur Herrschaft und
Gemeinde Pottendorf und 8 zum Bistum Wiener Neustadt, in
Unter-Eggendorf mit 34 Häusern waren 18 dem Bischof, 9 der Herrschaft
Pottendorf, 5 Lichtenwörth und 2 der Gemeinde lehenspflichtig.
Kriegerische Überfälle
Unsere Gegend blieb im Laufe der Jahrhunderte auch von diversen
kriegerischen Ereignissen nicht verschont. Bereits aus dem 15.
Jahrhundert sind Übergriffe auf bäuerliches Gut dokumentiert. Auch der
Lange Türkenkrieg (1593-1606) brachte den hiesigen Häusern und der
Kirche große Schäden. An der Kirche erinnert eine eingelassene Tafel,
in der es heißt: „Im Jahre 1605 wurde ich von den Rebellen verwüstet
und zerstört und durch den hochwürdigen H. Melchior Klesl, Bischof von
Neustadt, wieder errichtet und aufgebaut im Jahre 1608." Ein Stein auf
Hauptstraße 150 gedenkt des Zivilopfers David Pilot, der ebenfalls 1605
ums Leben gekommen ist.
Die größte Katastrophe stellte allerdings das Türkenjahr 1683 dar:
nahezu beide Ortschaften wurden durch Brand vernichtet, das Vieh
weggetrieben und unzählige Menschen getötet. Der Zillingdorfer Pfarrer
klagte, dass er nicht alle Gestorbenen in das Totenregister eintragen
könne, da es so viele seien.

Eine einheitliche Gemeinde - keine leichte Sache
Im Sinne der Gemeindewerdung waren der Zusammenlegung der beiden
Ortsteile Ober- und Unter-Eggendorf heftige Turbulenzen vorhergegangen,
auch die ersten Wahlen des Bürgermeisters und der Gemeinderäte
verliefen naturgemäß nicht ohne Schwierigkeiten. Nachdem 1970 das von
der Gemeinde Eggendorf vorgesehene Industriegebiet an der Bundesstraße
17 zwischen Theresienfeld und Sollenau in Bauland umgewidmet worden
war, erhielt Kurt Schedler die Zustimmung seitens der Gemeinde ein
neues Siedlungsgebiet zu errichten. Damit war die Siedlung Maria
Theresia als der dritte Ortsteil von Eggendorf geboren. Nach und nach
erfolgten der Bau einer Kirche und eines Friedhofs sowie weitere
Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur. Heute leben in der Siedlung
ungefähr doppelt so viele Menschen wie in Eggendorf-Ort.
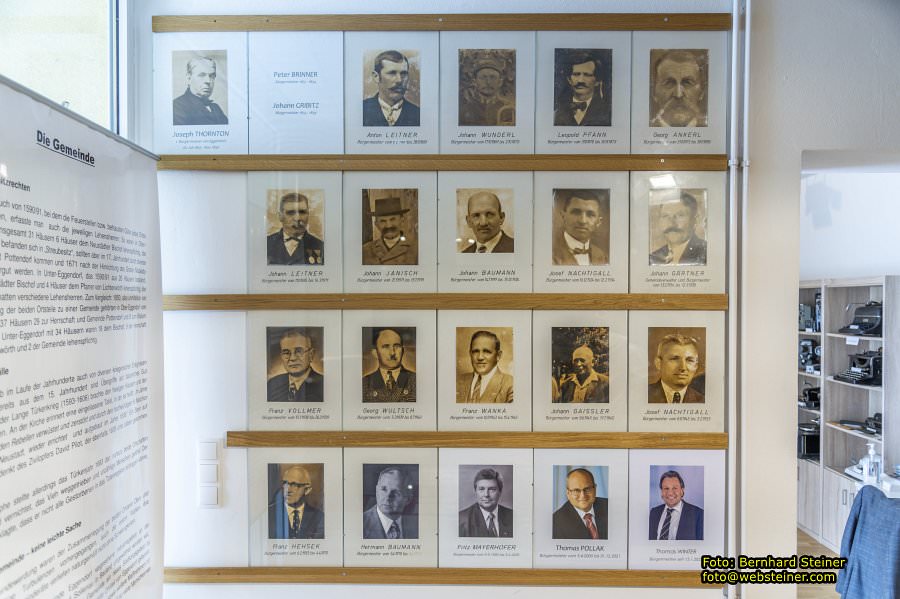
Feuerspritze „Modell A.P.W&S."


Die Baumwollspinnerei - Eine Hightech-Fabrik mit Wurzeln in Eggendorf
Bis 1802 existierten in Kontinentaleuropa keine großen
Fabrikspinnereien, da das entsprechende Know-how fehlte. Erst mit der
Ankunft der drei Kinder der Familie Thornton aus dem englischen Halifax
änderte sich die Situation schlagartig. Es wurde bereits 1804 in
Pottendorf mit der Produktion begonnen, ein Jahr später hatte das
Unternehmen schon 650 Arbeitskräfte und 23.040 Spindeln.
In Eggendorf war es der Neffe Joseph Thornton, der bereits 1832 die
Mühle und alle für das Projekt Spinnerei notwendigen Grundstücke
gekauft hatte. Er plante damit auch ein soziales Projekt für die
Beschäftigten. In der Pfarrchronik heißt es: „Ich habe in Antrag nächst
der Mühle zu Untereggendorf eine Spinnfabrik zu erbauen, und wenn mir
das Glück will, so hoffe ich bey 300 Menschen hinlängliche Arbeit zu
verschaffen..." Joseph Thornton legte auch auf politischem Parkett eine
Karriere hin: Bei der im Juli 1850 erstmals erfolgten Wahl des
Gemeindevorstands wurde er zum Bürgermeister gewählt. Er nahm die Wahl
zwar an, verabschiedete sich aber völlig überraschend nach einem Jahr,
verkaufte Spinnerei und Mahlmühle an Johann Hoff um 178.000 fl
Conventionsmünze und zog nach Wien.
Johann Hoff zog sich nach 10 Jahren als Besitzer der Spinnerei zurück,
behielt aber die Mahlmühle weiter bis 1883, die er an Carl Friedrich
Seuter von Loetzen verkaufte. Theresia Thornton, die Witwe nach Johann
Thornton, dem Bruder des Eggendorfer Betriebsgründers und Initiators
der Unterwaltersdorfer Spinnfabrik, erwarb 1860 mit ihren Söhnen die in
Konkurs befindliche Eggendorfer Spinnerei, die sie bis 1882 innehatten.
Mit dem Kaufvertrag vom 21. Dezember 1882 begann mit Carl Friedrich
Seutter von Loetzen die Dynastie der Familie Seutter, die für 125 Jahre
die Geschichte der Spinnfabrik prägen sollte.
Die Familie Seutter von Loetzen in Eggendorf
Carl Friedrich Seutter von Loetzen, geboren 1820 in Lndau am Bodensee,
begann seine berufliche Laufbahn als Lehrling in Prag, war Reisender
eines Baumwollgarngeschäftes und wurde 1873 Alleininhaber der Firma
Seutter & Comp. Neben dem Hauptsitz in Wien bestanden
Niederlassungen in Prag, Seebach/Kärnten und in Eggendorf. Carl
Friedrich starb 1892 in Wien.

Seine Nachfolger wurden Hermann und Günter Seutter von Loetzen, ab 1902
war Herrmann Alleininhaber des Unternehmens. Er trug sich mit dem Plan,
nach dem Neubau der Schule in den Jahren 1908/09 das alte Gebäude in
einen Kindergarten umzugestalten. Sein früher Tod mit nur 45 Jahren
machte dieses Vorhaben jedoch zunichte.
Die Witwe Amélie führte für ihre beiden minderjährigen Söhne Erich und
Herbert den Betrieb als Inhaberin bzw. Geschäftsführerin mit großer
Umsicht weiter. Sie ermöglichte weitere Investitionen und hatte wie die
übrigen Mitglieder der Familie großes soziales Empfinden, das vielen
Menschen im Dorf zugutekam. Auf der Parte anlässlich ihres Todes im
Jahr 1953 heißt es: „Nach dem plötzlichen Tode ihres Gatten ... hat sie
die geplante Liquidation der Firma verhindert und sie durch mehr als
zehn Krisen- und Kriegsjahre mit Hingabe, Tatkraft und Geschick
geführt."

Die letzten Jahre des Unternehmens
1978/79 wurde die Firma Seutter & Co. in die neu gegründete Firma
Seutter & Co. Aktiengesellschaft und anschließend in die Firma G.
Borckenstein & Sohn Aktiengesellschaft eingebracht. 1988 entschloss
sich die Geschäftsführung, den alten dreistöckigen Fabrikbau durch eine
ebenerdige Halle zu ersetzen. Es waren vermutlich wirtschaftliche
Überlegungen, die im Jahr 2000 zur Restrukturierung und 2003 zur
Verlegung des Eggendorfer Werkes nach Neudau führten.
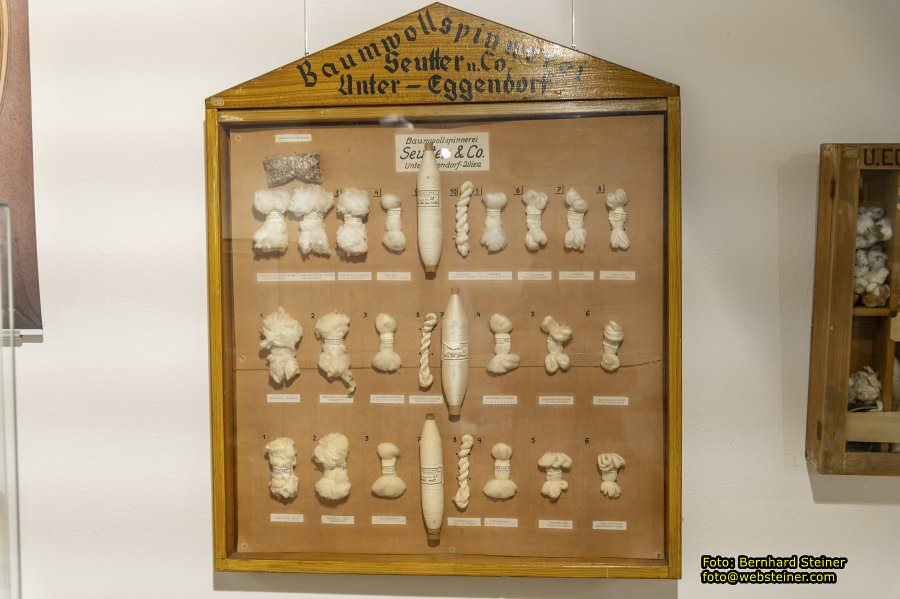
Die Papierfabrik - Die Dynastie Purtscher
Die Papierfabrik in Ober-Eggendorf ist mit rund 280 Jahren das am
längsten aktiv bestehende Industrieunternehmen des Ortes. Als
zeitlicher Richtwert für den Bestand der Fabrik kann das Jahr 1655
gelten, in dem der Papiermachergeselle Hans Debith aus Eggendorf
genannt wird. In den nächsten Jahren änderten sich die
Besitzverhältnisse der Herrschaft Pottendorf und damit auch für die
Papierfabrik immer wieder: Seit 1665 durch Kauf im Besitz von Franz
Graf von Nádasdy, wurde sie ab 1670 nach dessen Verhaftung im
Zusammenhang einer Magnatenverschwörung und späterer Hinrichtung als
kaiserlicher Kammerbesitz bis 1701 durch die Hofkammer verwaltet. Als
erster nachweisbarer Papiermacher lässt sich der 1674 verstorbene
Mathis Metschen identifizieren. Im selben Jahr noch begann mit
Christian di Ara der Familie Purtscher, die ursprünglich aus dem
Schweizer Wallis stammte und deren Mitglieder in der Folge einige
Papierfabriken in Nieder-Österreich ihr Eigen nannten. Für den Wiener
Hof kam der Standort sehr gelegen, da er „jährlich eine schröckliche
menge papirs mit großer spesa" günstig decken konnte. Purtscher musste
sogar um Vorschuss ansuchen, um den für die Herstellung der feinen
Papiere nötigen Filz kaufen zu können. Sohn Christoph Michael, der 1701
den Betrieb übernommen hatte, spendete für die Kirche neben dem
Taufbrunnen (1710) auch einen heute nicht mehr vorhandenen Speisekelch
(1718).
Der große Neubau
Johann Purtscher, der Letzte dieser Dynastie, verkaufte 1810 das
Unternehmen an ein Konsortium. Als die Fabrik im Jahr 1854 Mitglied des
Konzerns der K.k. priv. Ebenfurther-Obereggendorfer und Wiener
Neustädter-Papierfabriken von Leop. Fr. Leidesdorf & Comp. wurde,
begann auch die Geschichte der Familie Salzer, die bis 1936 die
Geschicke der Firma lenken sollte. Noch 1850 hatte man mit dem Neubau
der Fabrik nach modernen Technologien begonnen. In der Pfarrchronik
heißt es: „Von den früheren zur Fabrikation verwendeten Gebäuden blieb
gar Nichts ..." Auch das große zweistöckige Wohnhaus - durchwegs
Zimmer-Küche-Wohnungen - wurde sehr rasch errichtet.
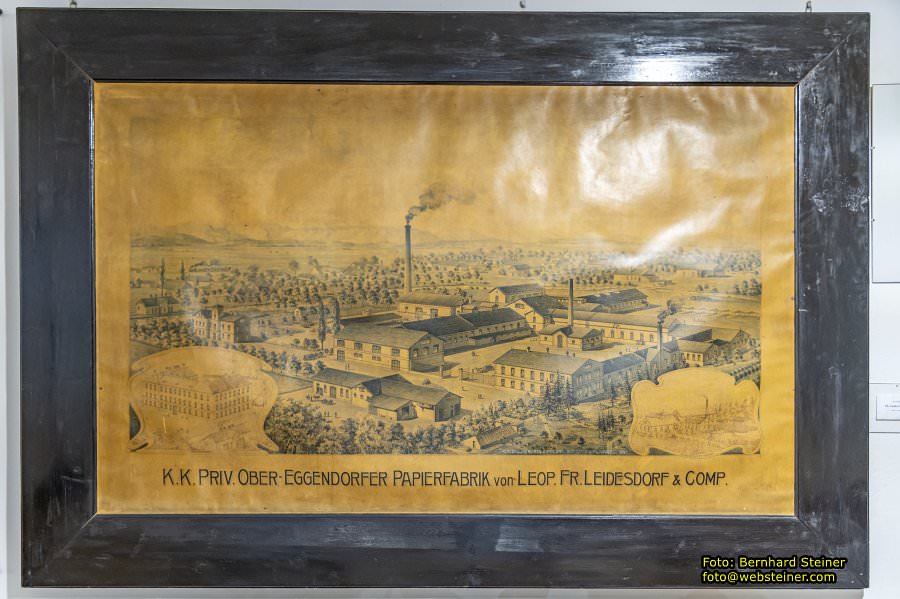
Funde von Spinnwirteln und Webgewichten legen die Vermutung nahe, dass
bereits ab dem 6. Jahrtausend v. Chr. in Mitteleuropa Textilien erzeugt
wurden. Früheste Funde von Spinnwirteln in Österreich: 5.600 bis 4.900
v. Chr. So fand man in der Zeit des Spätneolithikums (3.800 v. Chr.) im
Bodensee Beutel aus Flachsgewebe, die zum Gütertransport dienten.
Bronzezeitliche Reste von Fördersäcken lassen sich auch aus der
Bronzezeit (ca. 1.500 v. Chr.) nachweisen. Welche Materialien wurden
versponnen? Einerseits pflanzliche Fasern, wie Flachs, Hanf,
Brennnessel oder Baumbast, andererseits tierische Fasern, wie Haare von
Schaf, Ziege, Dachs oder Schwänze von Pferden.
In der Bronzezeit lag die Gewebedichte bei 5 Fäden/cm, in der
Hallstattzeit erhöhte sich die Fadenanzahl auf 11-15 Fäden/cm. Das
Maximum lag bei 40 Fäden/cm. Die Webgewichte veränderten sich im Laufe
der Zeit: Waren sie im Spätneolithikum walzenförmig, so finden sich in
der Urnenfelder- bzw. Eisenzeit pyramidenförmige Exemplare, durch
letztere konnten größere Gewebedichten hergestellt werden. Die
Webstuhlbreiten variierten in der Hallstattzeit: 60-90 cm schmale
Variante, 120-160 cm Standard, 370 cm: größte Breite.
Hallstattzeitlicher Webstuhl

Die Awaren in Eggendorf
Die Awaren waren ein Nomaden- bzw. Reitervolk aus dem
zentralasiatischen Steppengebiet mit Schlitzaugen (die Abstammung von
Mongolen, Han-Chinesen bzw. Turkvölkern ist nicht genau geklärt),
langen Haaren zu einem Zopf gebunden. Ihr Reich wurde von Turkvölkern
stark bedroht, daher verließen sie das alte Siedlungsgebiet und nach
einigen Irrfahrten kam es (um 560 n.Chr.) zur Landnahme im
Karpatenbecken beim Schwarzen Meer. Mit Byzanz kam es zu einem Bündnis,
der die Nordgrenze der Römer gegen Bezahlung sichern sollte.
In der Pannonischen Tiefebene betrieben die Awaren Viehzucht (Pferde,
Rinder, Schafe, Schweine usw.), die Awarenherrschaft lebte aber
hauptsächlich von den Kriegs- und Beutezügen und den Tributzahlungen.
Das Reiterheer war fast unschlagbar und die Raubzüge führten sie bis
Thüringen, Griechenland und den Balkan. Diese Übermacht dauerte bis 792
n. Chr. Kaiser Karl der Große zerstörte in einem Kriegszug das
Hauptquartier der Awaren, den sogenannten „Hring" und unterwarf den
Khagan. Da die Awaren nach der Niederlage gegen die Franken von den
Slawen stark bedrängt wurden, bat der christliche Kapkhan Theodor
Anfang 805 Kaiser Karl in Aachen um eine Wohnstätte zwischen Savaria
und Carnuntum und erhielt ein,,Awarisches Reservat". Theodor starb bald
darauf. Der Nachfolger ließ sich am 21. September 805 in der Fischa
(Bad Fischau oder Fischamend) auf den Namen Abraham taufen und erhielt
ein tributpflichtiges Awaren Khanganat (Fürstentum) mit Zentrum am
Plattensee. Der Zuständigkeitsbereich ging bis zur Enns. Dieses
Fürstentum bestand bis 828.
Die Awaren waren nicht nur ein gefürchtetes Reitervolk, sondern hatten
ein hohes Niveau in der Eisenwarenerzeugung (Waffen), in der
Goldschmiede und vielen anderen Handwerkstechniken; sie brachten den
zentralasiatischen Bronzeguss nach Europa und erfanden den Steigbügel.
Typisch sind die Gürtelbeschläge mit Menschendarstellungen,
Tierkampfszenen und Greiffiguren. Die Anwesenheit der Awaren in
Eggendorf ist durch ein großes Gräberfeld mit ca. 800 Gräbern belegt.
Eine Siedlung konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden. Bisher
wurden 6 Gräber archäologisch untersucht; 4 Kindergräber und 2 Skelette
von Erwachsenen (Datierung 741-820 n. Chr.).

Das nordöstliche Österreich und damit auch das Wiener Becken sind seit
Beginn de Neolithikums (ab ca. 5.600 v. Chr.) kontinuierlich besiedelt.
Auf Grund der Bodenbeschaffenheit war diese Region zur Ansiedlung von
Bauerngemeinschaften besonders geeignet. Die bisher ältesten Funde
unserer Gegend sind allerdings erst dem Spätneolithikum, also der
Kupferzeit a. 4.300 - 2.200 v. Chr.) zuzuordnen. Siedlungen dieser
Epoche wurden gerne an Terrassenkanten oder Hängen in der Nähe von
Gewässern angelegt. Federrührender Träger der Keramik war in unserem
Gebiet die Badener Kultur.
Barrenring, Bronzezeit, ca. 1900 v.Chr., Fundort Ober-Eggendorf

Vereinsobfrau Dr. Christiana Buzzi und Walter Buzzi zeigten viel
Enthusiasmus bei einer persönlichen Führung durch das Museum. Danke!
