web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Eisenerz
ehem. Innerberg, September 2024
Eisenerz ist eine Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern
im Bezirk Leoben im Norden der Steiermark, rund 25 km nordwestlich der
Bezirkshauptstadt Leoben. Der frühere Name der Gemeinde war Innerberg.
Eisenerz liegt am Erzbach inmitten der aufragenden Felsen der
Eisenerzer Alpen im Südwesten und des Hochschwab im Nordosten. Die vier
Felsformationen von Eisenerzer Reichenstein, Wildfeld, Kaiserschild und
Pfaffenstein dominieren das Stadtbild. Dazu kommen die rötlich
gefärbten Stufen des Erzbergs, der der größte Eisenerz-Tagbau
Mitteleuropas ist.

Liebfrauenkirche
1453 urkundlich als Bürgerspitalskirche erwähnt. 1490 neu gebaut. 1598
heutige Form. Durch Brände 1615 und 1745 beschädigt und baulich
verändert.

Kath. Filialkirche, Marktkirche Mariä Geburt, Liebfrauenkirche


Die Liebfrauenkirche wurde urkundlich erstmals 1453 als
Bürgerspitalskirche erwähnt, 1490 wurde sie neu gebaut und erhielt ihre
heutige Form 1598. Weiters wurde sie infolge von Bränden in den Jahren
1615 und 1745 baulich verändert.


Posthof - Mittelalterl. Hubhaus mit Hofkern aus dem 14. Jhd., später
Fleischhackerhaus, ehem. Postkutschenstation

Bürgerl. Wohnhaus - Baukern aus dem 13. Jhd., 1858-1872 Wohnhaus
bürgerl. Handwerker, Unterkunft für Saisonarbeiter der Vordernberger
Radmeister Kommunität

Altes Rathaus - Bausubstanz aus dem frühen 15. Jhd., 1535 zum Rathaus
umgestaltet, 1580 Turm, 1853 Bezirksgericht

Innerberger Traidkasten - ursprünglich 2 Häuser aus dem 14. Jhd., im
17.Jhd. Verwendung als Traidkasten (Getreide und Schmalzlager zur
Versorgung der Knappen)

Lebzelterhaus - Bausubstanz frühes 15. Jhd. bis 1654 Fleischhackerei,
danach Lebzelter- und Wachszieherei bis 1880, Fassade 19. Jhd.

Fendthaus - heutige Bauform aus dem 16. Jhd., altes Handwerkerhaus
Das Museum führt die Besucher in eine Welt, in der das Wunder der
Geburt Christi sichtbar gemacht wird. Mehr als 50 Weihnachtskrippen und
sakrale Exponate geben einen Einblick in die Krippenkunst vom
18.Jahrhundert bis in die Gegenwart. Eine Vielfalt aller Stilrichtungen
von historisch wertvollen bis Weihnachtskrippen jüngeren Datums,
hergestellt von Eisenerzer Krippenbauern, können neben orientalischen
Krippen bestaunt und teilweise auch „begriffen“ werden.

Glück auf! - TIEF OBEN im ERZ
Hoch über Eisenerz ruht sie als stiller Wächter über unserer Bergstadt.
Am Fuße des Erzberges aber wird sie zum Stein gewordenen Tor der
einstigen Gruben dieses Berges - die Kirchenburg St. Oswald. Jeder
Grubenfahrt in die Tiefe des Berges ging des Bergmanns Bitte um Gottes
Schutz und Beistand für das Tagwerk voran. So wurden Gebet und Arbeit
als innige Beziehung gepflegt und haben schlussendlich in der
Kirchenburg architektonische Gestalt bekommen.
Von der Wehrkirche zur Fluchtburg
Die Türkengefahr führte zu einem wehrhaften Ausbau vieler Städte in
Österreich, der Steiermark und auch der Märkte beiderseits des
Steirischen Brotlaibs. So wurde zum Schutz der Innerberger (Eisenerzer)
Bevölkerung die mittelalterliche Wehrkirche bis in die 1530er Jahre
stufenweise zu einer mächtigen Fluchtburg ausgebaut. Der ursprüngliche
Eingang auf der Westseite der Kirche werde vermauert und der heutige
Zugang vom Norden her durch ein eindrucksvolles Vorwerk mit zwei
imposanten Halbrundtürmen gesichert. Über diesen Torzwinger und das
ältere Innere Burgtor betritt man nun den Kirchhof. Die Türken aber
blieben - Gott sei Dank - fern. Als Fluchtburg diente die Kirchenburg
dennoch, und zwar den protestantischen Bürgern von Innerberg, die sich
im Zuge der Gegenreformation vor dem Bischof von Seckau hier
verschanzten. Heute ist die Kirchenburg St. Oswald eine dergrößten
erhaltenen Wehrkirchenanlagen Österreichs.

Der Steirische Erzberg, der Schichtturm und die Kirchenburg St. Oswald
prägen unverwechselbar das Ortsbild von Eisenerz. Alle drei sind
einzigartige Wahrzeichen dieser alten Bergstadt, deren sagenumwobene
Anfänge weit in die Vergangenheit zurückreichen. Nach legendärer
Überlieferung soll „das löbliche Erzbergwerk des innerbergischen
Eisensteines im Jahre 712 erfunden worden sein“.
Der Turm der Liebfrauenkirche vor dem Eisenerzer Schichtturm

Wehrkirche St. Oswald
Die Kirchenburg St. Oswald ist eine der größten erhaltenen
Wehrkirchenanlagen Österreichs. Kirche und Johanneskapelle laden zu
Meditation und Gebet ein. Im ehemaligen Mesnerturm erfährt man viel vom
Leben und den Traditionen der Bergleute, und man bekommt auch einen
kleinen Einblick in den Himmel.
Anlass für die ab 1482 auf Geheiß Kaiser Friedrichs III. begonnene
wehrhafte Befestigung der Kirche und die Errichtung der bestehenden.
Wehranlage (Tabor) bis um 1532/34 war der drohende Einfall der Türken
auch hier in Eisenerz, der dann aber Gott sei Dank ausblieb. 1529, als
die Türken gegen Wien vorrückten, verstärkte man die niedrigen Mauern,
die Kirche und Friedhof zunächst umgaben, und versah sie mit hölzernen
Wehrgängen, Schießscharten und Pechnasen. Der Zugang wurde von Norden
her durch eine wuchtige Barbakane (Vorwerk) und ein Innentor gesichert.
Durch einen eigenen Brunnen und einen Aborterker war die Anlage zudem
gerüstet, der Bevölkerung im Notfall als Fluchtburg zu dienen.
Benutzt wurde die Anlage dann erst viele Jahre später, um 1599 im Zuge
der Gegenreformation, als sich protestantische Eisenerzer Bürger vor
dem Bischof von Seckau verschanzten — freilich ohne Erfolg. Angesichts
der 316 gut ausgerüsteten kaiserlichen Schützen, die den Bischof
begleiteten, gaben sie die Besetzung auf.

Die stetig anwachsende Siedlung „Innerberg", wie Eisenerz einst hieß,
erhielt bald ein sakrales Zentrum: Schon 1282 ist in Urkunden von einer
Kirche „ad S. Oswaldum" die Rede (der Kirchenpatron Oswald starb 642
und hat am 5. August seinen Gedenktag).
Die heute noch bestehende, spätgotische Pfarrkirche St. Oswald entstand
in den Jahren um 1470 bis 1520; die Einweihung erfolgte 1512. Aufgrund
der drohenden Türkengefahr ließ sie der Kaiser zwischen 1532 und 1534
von der Admonter Bauhütte zu einer mächtigen Wehranlage ausbauen. 1768
erhielt der Turm eine Zwiebelhaube, die im Zuge der „Regotisierung" am
Ende des 19. Jahrhunderts durch das heutige Dach ersetzt wurde.

Der dreijochige Chor mit 5/8-Schluss wird von einem mächtigen
Parallelnetzrippengewölbe überspannt; der Chor (1472) ist der älteste
Bauteil der bestehenden Kirche, allerdings wurden einige Bauglieder im
Zuge der erwähnten Regotisierung erneuert, so etwa die kielbogige
Sessionsnische auf der rechten Seite, das Schulterbogenportal zur neuen
Sakristei gegenüber, die Maßwerkbrüstung der nördlichen Emporenöffnung
oder die Figurenbaldachine der Apostelstatuen. Beim Blick in den
Altarraum bilden Volksaltar, Ambo und Kanzel ein liturgisches Dreieck
(Tisch des Brotes — Tisch des Wortes — ehemaliger Ort der Verkündigung).

Kanzel, die um 1900 von einem Schmiedemeister in Graz ganz aus Stahl
gefertigt wurde; der Stein im Fuß stammt ebenfalls vom hiesigen Erzberg.

In der Sakristei
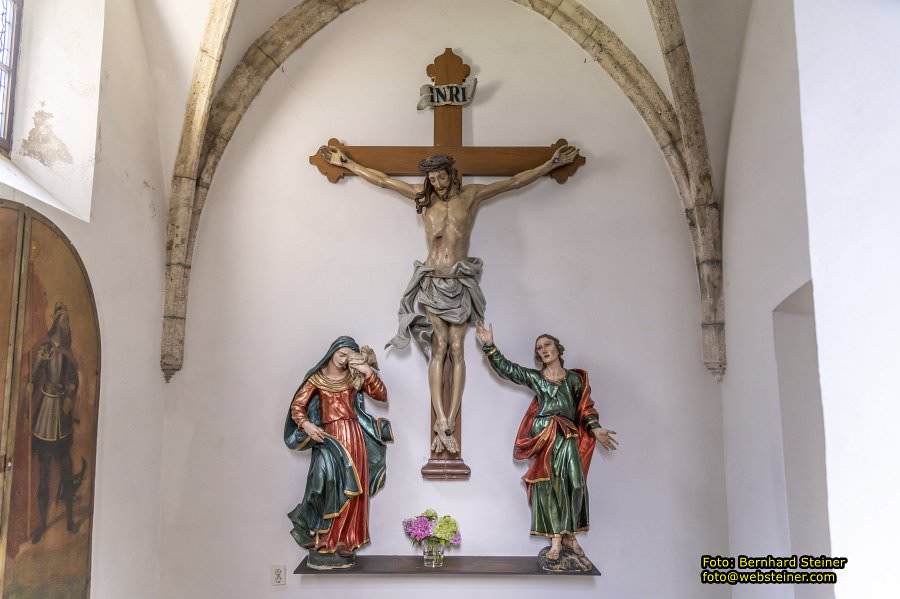
Über dem Eingang zum sternrippengewölbten, vierjochigen Kirchenschiff
ist die kunsthistorisch und theologisch mit vielen Rätseln behaftete
Doppelkanzelempore (jetzt Orgelempore), die mit ihrem dekorativen
Reichtum zu den bemerkenswertesten Beispielen ihrer Art in Österreich
gehört. Die gesamte Front mit ihrer seitlich vorgezogenen Brüstung und
den beiden sich wie Kelche entfaltenden Erkern wird von einem
außergewöhnlich phantasiereichen Formenreichtum überzogen.
Das große Fenster unter der Empore wurde erst 2005 im Zuge der
Sanierung der Westfassade geöffnet und gibt in seiner Form die Umrisse
des ehemaligen spätgotischen Hauptportales wieder, das man einst aus
wehrtechnischen Gründen vermauert hatte. Das große Glasfenster über der
Orgel stellt die beiden als Patrone der Kirchenmusik verehrten
Heiligen, König David und Cäcilia dar.

Das barocke Triumphbogenkruzifix wurde im Zuge der
Volksaltaraufstellung in die Mitte des Chores versetzt. Der
„Volksaltar“ wurde am 4. Juli 1993 geweiht.
Der Marmoraltar im neugotischen Stil stammt aus dem Jahr 1905 (geweiht
1912). In den Baldachinnischen zuseiten des Tabernakels stehen die
Marmorfiguren der vier Evangelisten: links Johannes (Adler) und Lukas
(Stier), rechts Markus (Löwe) und Matthäus (Engel); zuoberst über dem
Tabernakel der Kirchenpatron, der hl. Oswald mit Krone, Schwert und
Rabe.
Apsisfenster: Die fünf Fenster im Chorraum erhielten 1898 figürliche
Farbglasscheiben der Tiroler Glasmalereianstalt in Innsbruck. Sie
zeigen von links nach rechts: 1) Die Heiligen Johannes den Täufer und
Barbara (Patronin der Bergleute), darunter die Heiligen Georg und
Joseph (Patrone der Zünfte); 2) „Kaiserfenster‘“‘, oben Krönung Mariens
durch die Heilige Dreifaltigkeit, in der Mitte die Grundsteinlegung der
ersten Pfarrkirche, darunter kniend Kaiser Franz Josef I. mit dem
Habsburgerwappen und der Inschrift, die auf die Grundsteinlegung zur
ersten Oswaldikirche durch Rudolf von Habsburg im Jahr 1279 verweist;
3) Die Heiligen Michael und Florian, darunter Anna und Joachim; 4) Herz
Jesu und Herz Mariae; 5) Christus als Guter Hirte und als Sämann.

Rechter Seitenaltar: Auf der Mensa, die ähnlich wie jene des etwa
zeitgleichen neugotischen Hochaltares gestaltet ist (auf den
Originalplänen des Friedrich von Schmidt sind auch die gesamten
Seitenaltaraufbauten entsprechend ausgeführt), steht eine
bemerkenswerte Statue der Loretomadonna — in Anlehnung an „Maria
Loreto‘“, die schwarze Madonna der Loretokapelle bei Ancona. Diese
reich verzierte Holzplastik der gekrönten Muttergottes mit dem
Jesuskind schuf der Eisenerzer Künstler JOHANN TENDLER im Jahr 1839.
Loretomadonna von Johann Tendler, 1839

Nördliche Seitenkapelle mit Taufbecken
Unter dem neugotischen Farbglasfenster mit einer Darstellung von
Christi Himmelfahrt steht die in einem Holzschrank verwahrte Krippe.
Die von JOHANN TENDLER um 1830 geschnitzten Figuren wurden ursprünglich
in verschiedenen Szenen aufgestellt (Skizze im Krippenmuseum), 1972
wurden sie von Egon Machaczek in den Kasten eingebaut, der zur Advents-
und Weihnachtszeit geöffnet ist.

Die Kreuzwegbilder (um 1840) stammen von Johann Tendler.

Farbglasfenster im Kirchenschiff an der Südwand
1) Die vierzehn Nothelfer (1903),
2) Eine Szene aus dem Leben des Kirchenpatrones, des hl. Oswald, die
auf seine Mildtätigkeit anspielt: Bei einem Gastmahl erfährt er, dass
Arme draußen um Gaben bitten, woraufer ihnen nicht nur die Speisen
bringt, sondern auch das silberne Tafelgeschirr an sie verteilt. Der
Bischof segnet daraufhin die schenkende Hand des Königs und sagt:
„Diese Hand soll nie verwesen“.
3) Eine weitere Szene zeigt das Begräbnis des hl. Oswald, wobei der
nach seiner Tötung abgetrennte und erst später aufgefundene Kopf nun
vereint mit dem übrigen Körper bestattet wird.

In den Baldachinnischen der Wandvorlagen stehen zehn neugotische
Statuen der Apostel. Sie wurden um 1900 vom Grazer Bildhauer PETER
NEUBÖCK geschaffen. Die beiden „fehlenden“ Apostel Johannes und
Matthäus, die zugleich Evangelisten sind, finden sich als Statuen am
Hochaltar. Die zwölf Apostel bilden als Zeugen der Auferstehung und
Verkünder des Evangeliums das Fundamentder Kirche; sie tragen gleichsam
die Kirche, in die jeder Getaufte als „lebendiger Stein“ eingefügt wird.

Im Südosten der Wehranlage überragt dieser dreigeschossige Bau die hohe
Ringmauer. Der schlanke, turmartige Bau beherbergt den Karner, die
Johanneskapelle und zuoberst den Mannschaftsraum. Der Baukörper war von
Anfang an als Teil der Wehranlage gedacht. Das zeigen v.a. die
Schlüsselscharten im Mauerwerk der Johanneskapelle. Die über dem Karner
errichtete Kapelle hat schon 1498 bestanden und wurde 1593 in die
heutige Form umgebaut.
In den Zeiten der Religionswirren des 16. Jhdt wurde das Gotteshaus als
bürgerliches Zeughaus verwendet, ehe die Kapelle und der jetzt
bestehende Altar wieder eingeweiht wurden. Im 20. Jhdt verkam die
Kapelle erneut zu einer Art Rumpelkammer. 2007 wurde die
Johanneskapelle restauriert und ihrer ursprünglichen Bestimmung
zurückgegeben. Dabei wurde die verborgene Akustik dieses Kirchenraumes
wiederentdeckt und dient von nun an dem Lobe Gottes!
Geht man nördlich um die Kirche und den Chor herum, erblickt man in der
Südostecke der Befestigungsmauer die Baugruppe der spätgotischen
Johanneskapelle mit dem Karner. Der schon 1448 anlässlich einer
Stiftung erwähnte Karner birgt die Gebeine, die nach Auflassung des
einst um die Kirche angelegten Friedhofs ausgegraben wurden sowie
Gebeine von im Ersten Weltkrieg hier gefallenen Soldaten.

TIEF OBEN - Zum Schutze der Bevölkerung
Es ist das Gelände, welches das Erscheinungsbild der Kirchenburg mit
dem dreiecksförmigen Grundriss der Ringmauer vorgegeben hat. Bereits
1436 wird eine Friedhofsmauer um die Pfarrkirche erwähnt. 1482 wird auf
Anordnung Kaiser Friedrich III die Anlage befestigt und die einstige
Friedhofsmauer abschnittsweise zu einer Ringmauer ausgebaut. Diese
erste Ringmauer mit Zinnenkranz lässt sich besonders gut im Bereich des
Osttores erkennen. Der nordwestliche Teil der Ringmauer mit dem Inneren
Burgtor ist gemeinsam mit dem Langhaus der Kirche bis 1503 entstanden.
Das letzte Teilstück der Ringmauer zwischen Reckturm und Langhaus wurde
vor 1510 fertiggestellt.
Auf Grund der drohenden Türkengefahr wurde die Wehranlage bis 1534
immer weiter verstärkt und vorgelagertem Graben ausgebaut. Das Nordtor
erweiterte man 1532-34 mit einem Zangentor, flankiert von zwei
mächtigen Halbrundtürmen. Die Wehranlage wurde mit hölzernen
Wehrgängen, Pechnasen und Schießscharten versehen. Im Osten wurde ein
Brunnen gegraben, um die Bevölkerung im Belagerungsfalle mit Wasser
versorgen zu können. Ein Aborterker im Nordteil der Ringmauer diente
der Notdurft der Bevölkerung. Über Jahrhunderte hielt die Wehrmauer den
äußeren Einflüssen stand. 1967 jedoch stürzte die südliche Wehrmauer
auf einer Länge von 35 Metern ein. Drei Jahre später konnte der
Wiederaufbau bereits abgeschlossen werden.

Die über dem Karner um 1498 errichtete Johanneskapelle wurde 1593
umgebaut und erhielt damals ihre heutige Form eines Wehrkirchleins. Der
zweijochige Raum mit 5/8-Schluss besitzt ein Netzgewölbe und wurde
2007/2008 renoviert und mit Figuren der barocken Kicheneinrichtung
ausgestattet.

SCHAUDEPOT IM MESNERTURM
Mit dem Schaudepot im alten Mesnerturm wollen wir barocke Figuren und
andere Objekte aus der Oswaldikirche, die im Zuge der Regotisierung um
1900 ausrangiert wurden, aus der Vergessenheit holen und neu ins
Blickfeld rücken.
Unter dem Titel: VOM LEBEN ZWISCHEN HIMMEL UND BERG wird das Leben und
der Glaube der Innerberger Bergleute in einem Hör- Schau-Spiel auf neue
Art und Weise dargestellt.
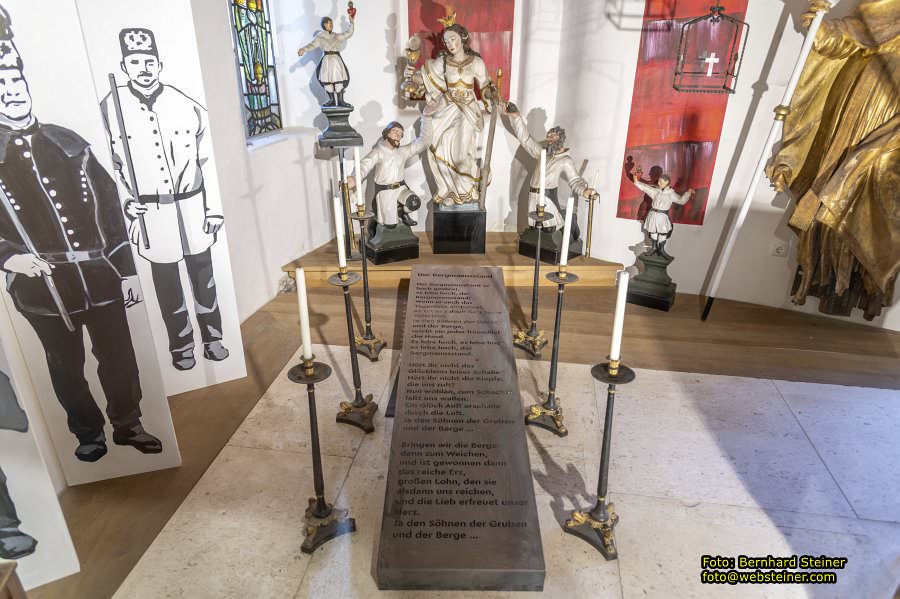
BERG - Im unteren Stock wird - eingebettet in die Geschichte des
Erzberges - über Leben, Arbeit und Tradition der Bergleute erzählt.
HIMMEL - Im oberen Stockwerk betreten wir mit Engeln, Heiligenfiguren
und anderen Objekten die himmlische Sphäre und möchten somit einen
tieferen Einblick in die Glaubenswelt der alten Eisenerzer/Innerberger
ermöglichen.

MESNERTURM
Der Mesnerturm, der Teil des sogenannten Vorwerkes ist, wurde 1530 im
Zuge der letzten Erweiterung und Verstärkung der Kirchenburg dazugebaut
und diente zuerst als Wehrturm. Erst nach der Bannung der Türkengefahr
in der Barockzeit wurde der ursprünglich offene Turm in einen Wohnturm
umgebaut.

Bis in die 1950er Jahre war er die Wohnung der jeweiligen Mesnerfamilie
von St. Oswald. Während sich die Küche und das Esszimmer im unteren
Stockwerk befanden, wurden die oberen zwei Stockwerke als Schlaf- und
Aufenthaltsräume genutzt. Die ebenerdigen Gewölberäume dienten als
Erdkeller und Lebensmittellager; die Waschküche und das Holzlager
befanden sich im Nebengebäude im gegenüberliegenden Rundturm.

seither Tagebau mit modernster Abbau- und Aufbereitungstechnik
1986 Einstellung des Grubenbetriebes
1945 Stilllegung der letzten Hochöfen
1873 Eröffnung der Kronprinz-Rudolf-Bahnstrecke Hieflau - Eisenerz
19. Jhdt Industrialisierung - Beginn des Tagebaues
1720 Einführung des Sprengens mit Schwarzpulver
1581 Erbauung des Schichtturmes
1292 Innerberg (Eisenerz) erhält das Marktrecht
1150 Bau der ersten Stucköfen (Radwerke) an den Flussläufen
712 "Erfindung" des Steirischen Erzberges
seit 2004 Revitalisierung der Kirchenburg
1912 Abschlussider Regatisierung der Oswaldikirche
18. Jhdt Barockisierung der Oswaldikirche
1599 Gegenreformation unter Bischof Martin Brenner
um 1540 Die Eisenerzer Bevölkerung ist größtenteils protestantisch
1530-32 Die Kirchenburg erhält ihre heutige Forר
1512 Einweihung der spätgotischen Kirche
1269 Baubeginn der romanischen Oswaldikirche
1218 Eisenerz fällt der neugegründeten Diözese Seckau zu
Die Kirchburg St. Oswald ist eine der größten erhaltenen
Wehrkirchenanlagen Österreichs. An der Stelle eines romanischen
Oswaldi-Kirchleins gen. 1190 wurde von 1470 bis 1512 der spätgotische
Neubau errichtet. Ab dem Jahr 1482 ließ Kaiser Friedrich III. aufgrund
der ständig steigenden Türkengefahr die niedrigen Friedhofsmauern der
Kirche zu einer wehrhaften Kirchenbefestigung dausbauen. Von 1530 bis
1532 wurde die Anlage verstärkt, das Westtor der Kirche zugemauert und
das „Vorwerk“ errichtet. Nach der Befreiung Wiens im Jahr 1683 wurde
der Dreigeschoßige Wehrturm des Vorwerkes in einen Wohnturm als
Unterkunft für die Mesnerfamilie umgebaut. Das Obergeschoss dient heute
als Begegnungsort; in den beiden unteren Geschoßen befindet sich seit
2020 das frei begehbare Schaudepot.

Am Weg zum Erzberg kommt man am Trofengbach Grberei Salzer Museum
vorbei. Gerberei-Museum strahlt in großen Lettern auf der
Hausfassade und steht für den Inhalt des Gebäudes. Besucher erfahren
alles über den Produktionsprozess und die Wichtigkeit von Leder für die
Berg- und Hüttenleute. Das Handwerk der Gerber hat in Eisenerz eine
lange Tradition. Die Aufschrift „Anno 900 Ledererhaus“ gibt einen
Hinweis auf die Entstehungszeit, die mit 1548 urkundlich gesichert ist.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: