web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Post- und Telegraphenmuseum Eisenerz
Österreichisches Spezialmuseum in Eisenerz, September 2024
Realitätsnah und interaktiv kann man hier Postgeschichte erleben. Zahlreiche geschichtlich wertvolle Originalexponate, wie historische Postfahrzeuge, ein originales k. k. Postamt, Schreib- und Kanzleiutensilien, Briefkästen aus aller Welt und vieles mehr, versetzen die Besucher:innen in vergangene Zeiten. Im Fernmeldebereich ist die Zeitspanne vom Morseapparat bis zur Mobilfunktechnik ausgestellt.

Das Posthorn
Still ist schon das ganze Dorf, Alles schlafen gangen, Auch die Vöglein im Gezweig, Die so lieblich sangen.
Dort in seiner Einsamkeit Kommt der Mond nun wieder, Und er lächelt still und bleich Seinen Gruß hernieder;
Nur der Bach, der nimmer ruht, Hat ihn gleich vernommen, Lächelt ihm den Gruß zurück, Flüstert ihm: willkommen!
Mich auch findest du noch wach, Lieber Mond, wie diesen, Denn auf immer hat die Ruh' Mich auch fortgewiesen.
Mich umschlingt kein holder Traum Mit den Zauberfäden, Hab mit meinem Schmerze noch Manches Wort zu reden. -
Ferne, leise hör ich dort Eines Posthorns Klänge, Plötzlich wird mir um das Herz Nun noch eins so enge.
Töne, Wandermelodei, Durch die öden Straßen, Wie so leicht einander doch Menschen sich verlassen!
Lustig rollt der Wagen fort Über Stein' und Brücken; Stand nicht wer an seinem Schlag Mit verweinten Blicken?
Mag er stehn! die Träne kann Nicht die Rosse halten; Mag der rauhe Geißelschwung Ihm die Seele spalten!
Schon verhallt des Hornes Klang Ferne meinem Lauschen, Und ich höre wieder nur Hier das Bächlein rauschen.
Ich gedenke bang und schwer Aller meiner Lieben, die in ferner Heimat mir Sind zurückgeblieben;
Diese schöne Sommernacht Muß vorübergehen, Und mein Leben ohne sie Einsamkeit verwehen.
Mahnend ruft die Mitternacht Mir herab vom Turme. Ferne! denket mein! die Zeit Eilt dahin im Sturme!
Unsre Gräber, denket mein! sind schon ungeduldig! - Daß wir nicht beisammen sind, Bin ich selber schuldig.
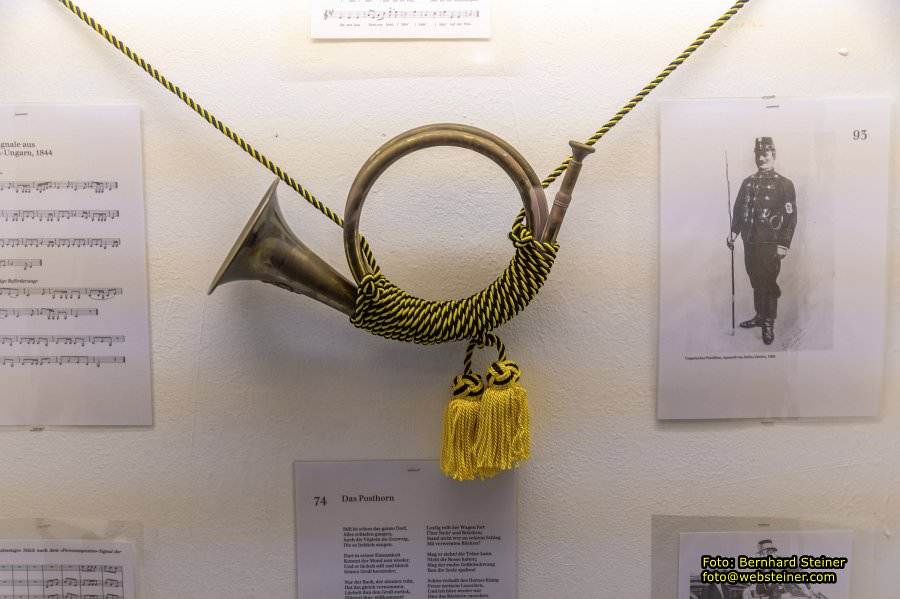
Kammerhof Historischer Überblick
Zeitweilig auch märkisches Haus genannt
Erbaut vor 1498
Besitzer vor 1498: Radmeisterfamilie Harlanger
1498: Hans Haug kaiserlicher Mautner und Forstmeister in Innerberg
1524: wegen Amtskassen Außenständen auf kaiserlichen Befehl konfisziert
1528: Erzherzog Ferdinand, Sitz des Kammergrafenamtes Verwaltung des Eisenwesens in der ganzen Monarchie.
1786: Innerberger Hauptgewerkschaft
1879: von Kaiser Franz Joseph gekauft, zu Jagdschloß umgestaltet
1916: Herzog Max von Hohenberg, Fürstin Sophie von Hohenberg und Fürst
Ernst von Hohenberg, erhalten Kammerhof und Liegenschaften in Eisenerz
und Radmer von Kaiser Karl
1938-1945: durch „Deutsche Reichsforste" enteignet
1951: Rückgabe an Herzog Max und Fürst Ernst von Hohenberg durch die engl. Militärverwaltung, bzw. Republik Österreich
1971- bis dato: Gutsverwaltung und Eigentümer Fürst Albrecht von Hohenberg und Fürstin Leontine von Hohenberg

Post- und Telegraphenamt Eisenerz Geschichte
Ein Kommissionsgutachten gab die Veranlaßung, daß Kaiserin Maria
Theresia, mit Entschließung vom 5. März 1751, zur Beförderung der
Korrespondenz und des Comercii verordnete, daß von Grätz(Graz) bis
Lintz (Linz) ein ordentlicher Postkurs durch das Eisenärzt angelegt
werden soll, mit 6 neuen Stationen: Vordernberg, Eisenärzt, Reifling,
Altenmarkt, Kasten und Lostein in Steiermark. Mit dieser neuen Ordinari
sollte den 1. Mai 1751 der Anfang gemacht werden. Somit besteht in
Eisenerz seit 1. Mai 1751 schon über 200 Jahre ein Postamt.
Das Postamt Eisenerz hatte anfänglich nur mit Brief- und Fahrpostdienst
Befassung. Doch die fortschreitende Entwicklung der Montanindustrie in
Eisenerz, die auch an den Postdienst größere Anforderungen stellte,
bewirkte, daß beim Postamte Eisenerz schon im Jahre 1869 der
Telegraphendienst, im Jahre 1883 der Fernsprechbetrieb und der
Postsparkassen-Sammeldienst und Scheckverkehr eingerichtet wurde.
Das Postamt Eisenerz befand sich zuletzt im Hause Freiheitsplatz 5,
dessen Eigentümerin die Alpine war. Die Räumlichkeiten entsprachen
nicht mehr den heutigen Anforderungen und man sah sich daher gezwungen,
neue Räumlichkeiten in Eisenerz ausfindig zu machen. Bereits im Jahre
1968 wurden Verhandlungen mit der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft
(Alpine Montan) WAM, zwecks Unterbringung eines neuen Postamtes in
einen Neubau in der Hieflauerstraße 19-21 aufgenommen. Am 15. September
1972 war es dann mit der Verlegung soweit und das Postamt wurde
eröffnet.

Tauchen Sie in die Geschichte der Post ein und erleben Sie eine
Zeitreise in die Ära vor Telefon, Handy und Internet! Das
Österreichische Post- und Telegraphenmuseum bietet Ihnen einen
spannenden, liebevoll gestalteten und umfangreichen Einblick in das
Post- und Telegraphenwesen von der Kaiserzeit bis heute. Entdecken Sie
geschichtlich und kulturell wertvolle Exponate,wie z.B. die
fahrtaugliche und begehbare Postkutsche, ein originales k. k. Postamt
aus der Zeit um 1900, posthistorische Unterlagen, Schreib- und
Kanzleiutensilien oder technische Apparaturen. Ergänzt wird die
Sammlung durch Briefkästen aus aller Welt und themenspezifische,
philatelistische Materialien, die Ihnen einen Eindruck von der Post
rund um den Globus geben.

Mitten in Eisenerz, der Bergstadt in der geschichtsträchtigen Region
der Steiermark, erwartet Sie das Österreichische Post- und
Telegraphenmuseum. Es wurde im August 2012 in Zusammenarbeit mit der
Österreichischen Post AG gegründet und erfreut heute nicht nur
Briefmarkensammler*innen und Freund*innen der Post, sondern auch
Kultur- und Geschichtsinteressierte.

Das Österreichische Post- und Telegraphenmuseum ist in den historischen
Räumlichkeiten des Kammerhofes untergebracht. Als ehemaliges
Jagdschloss des Kaisers Franz Joseph I. konnte es schon im 19.
Jahrhundert seine Gäste begeistern und lädt heute zu einer Reise in
vergangene Zeiten und zu lebendigen Erinnerungen ein.

Postwagen gebaut 1893
Die Gemeinden Hofkirchen und Taufkirchen leisteten sich gemeinsam
diesen Zweispänner mit Ladefläche, mit dem täglich morgens und abends
Post- sendungen von der Bahn abgeholt und ausgeliefert wurden.

Morse-Apparat

Morse Alphabet
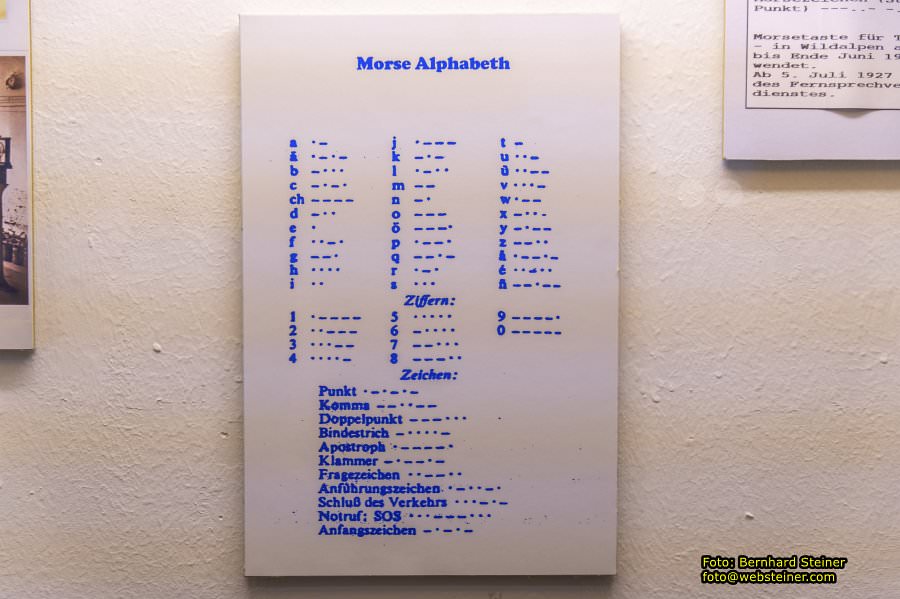


Gründerzeit-Schreibtischgarnitur um 1880.
Plastischer Messingguss, durchbrochen gearbeitet u. ornamental geziert,
figurale Bekrönung "Amor mit Pfeil und Bogen". Aus dem k.k. Adelbesitz.


Schreibgarnituren aus der Biedermeier Zeit des (1845 - 1848) (als das Löschblatt noch nicht erfunden war)

Keramik-Schreibtischgarnitur um 1900, glasiert, farbig bemalter, reliefierter Dekor, mit Streusand- und Tintenbehälter

Postmotorrad Puch SG 125

Postfahrrad aus Hieflau / Stmk.

Puch-Lastenroller Typ Laro 125, Baujahr 1956


k.k. Landbriefträger, 1904

(v.l.n.r.) Fernsprechapparat OB Wandapparat mit Schreibpult
PRIVAT-POSTKÄSTEN UM 1890.
Fernsprechapparat OB Wandapparat, OB (Ortsbatterie) Batterie befindet sich im unteren Kästchen



Drucktypograph AEG Mignon No. 4, 1903

OB Vermittlungsschrank Orts- und Fernumschalter
Bis zur vollständigen Automatisierung des Fernsprechnetzes wurden
Klappenschränke dazu benutzt, die Sprechverbindung zwischen zwei
Fernsprechteilnehmern herzustellen. Dazu waren jeder Sprechstelle eine
Klinke und ein Elektromagnet mit einem einfachen Klappenmechanismus
zugeordnet.
Jeder Fernsprechapparat war zur damaligen Zeit mit einer Ortsbatterie
(OB) ausgestattet. Wollte jemand ein Ferngespräch führen, betätigte er
den Kurbelinduktor an seinem Fernsprechapparat. Damit erzeugte er einen
Wechselstrom, der „seinen" Elektromagneten im Klappenschrank zum Anzug
brachte. Dadurch wurde eine metallische Klappe freigegeben, die
herunterklappte und damit dem „Fräulein vom Amt" einen
Verbindungswunsch mitteilte. Die Verbindung wurde durch entsprechendes
Stecken der Verbindungsschnüre in die zugehörigen Steckbuchsen
hergestellt. Das Ende des Gespräches wurde der Vermittlung durch
neuerliches Betätigen der Kurbel bekanntgegeben.

Typendrucktelegraph (Hughes Schreiber)
Im Jahre 1855 wurde der Typendrucktelegraph der Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Entwicklung des britisch amerikanischen Konstrukteurs
und Erfinders David Edward Hughes (1831-1900) sollte die Telegraphie
nochmal ein ganzes Stück weiterbringen.
Im Vergleich zum Morsetelegraphen setzte der Hughes Telegraph nicht nur
direkt lesbare Schrift um, er telegraphierte auch mit einer
vergleichsweise höheren Geschwindigkeit von durchschnittlich 1200
Wörtern in der Stunde. Die Telegraphistinnen es waren hauptsächlich
Frauen, die in den Ämtern arbeiteten - bedienten dabei eine Klaviatur,
deren Tasten mit je einem Buchstaben belegt war. Bei Texteingabe und
-empfang mussten sie die aus Pendel und Fliehkraftbremse bestehende
Reguliereinrichtung so lange betätigen, bis Sende- und Empfangsapparate
synchron waren. Am Empfangsgerät wurden die Stromstöße in gedruckte
Schrift umgesetzt, sodass die Kenntnis des Morse-Alphabets nicht mehr
notwendig war. Hughes -Telegraphen wurden so bis ins 20. Jahrhundert
hinein weltweit zur Nachrichtenübertragung genutzt.

Fernsprechapparat OB 05
OB (Ortsbatterie) Batterie befindet sich beim Teilnehmerapparat

Die Gummiplatte wird in eine Vulkanisierpresse
gelegt. In dieser befindet sich die entsprechende Druckform. Durch
Erhitzen wird der Gummi nun von einem plastischen in einen elastischen
Zustand überführt. In den elastischen Gummi formt die Druckform der
Presse nun durch Hydraulikdruck das Druckbild und lässt es abkühlen.
Schließlich nimmt man den ausgehärteten Gummi von der Druckform und
schneidet diesen zu. Heute nutzen Stempelhersteller bei der
Vulkanisation eine Mater und eine von der Industrie vorgefertigte
Gummiplatte. Die Vulkanisierpresse erzeugt bei der Herstellung das
Druckbild einer Mater.


SIEGEL - (von Sigillum, lat. Bildchen, abge- leitet), anfänglich zum
Verschließen einzelner, auch gefaltener Bogen oder Umschläge genützt.
Pakete, Säcke, Leinwandverpackungen etc. waren mittels Schnur- oder
Drahtversiegelung zu sichern. Häufige Formen waren Wachs-, Blei-,
Metall- und sogar Goldsiegel.
WACHSSIEGEL - (älteste Form). Die herrschenden Fürsten und Regierenden
siegelten ihre Briefschaften mit rotem Wachs. Schwarzes Wachs war dem
Trauerbrief vorbehalten. Binfache Bürger vorausgesetzt des Schreibens
kundig benützten ebenfalls einfaches Natur- oder auch eingefärbtes
Wachs.
SIEGELLACK - (auch spanisches Wachs genannt) kam Mitte des 16. Jhdt.
aus China nach Europa. In zahlreichen Farben hergestellt (vergl.
Wachssiegel).
WEIZENSIEGEL - (gebackene, mitunter gefärbte Weizenbreischeiben von ein
bis mehrere Zentimeter Durchmesser, dienten angefeuchtet als
Verschluß). Zusätzlich mit einem Prägewerkzeug individueller Gestaltung
(als Sicherheitsmerkmal) gekennzeichnet. Man könnte dies als Vorläufer
der Gummierung bezeichnen.
PETSCHAFTEN (Typare, Petschiere) unterschiedliche Formen der Handgriffe
und Siegelplatten. Ausführungen entsprechend dem Ansehen und der
finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Briefeschreibers.
SIEGELRINGE - eine "handliche", zierliche Variante der oft volumenösen Petschaften.
* * *
Siegellack besteht aus Kolophonium + Farbstoffe + Schellack

Hunde-Schreckschuß-Pistole
verwendet vor 1950 von Postzustellern zur Abschreckung von Haushunden im ländl. Bereich.


Schreibmaschine Adler No. 7, 1901

Postkasten aus Gibraltar

Leopold Streißelberger, Jahrgang 1949, wohnhaft in Eisenerz.
Erlernter Beruf Zimmerer bei der Voest - Alpine Eisenerz
Der von mir gestaltete Wassermann hat folgende Anzahl aus Schuppen, die in 1, 2 und 5 Cent-Münzen gestaltet sind:
1 Cent -- 900 Stück
2 Cent -- 1810 Stück
5 Cent -- 200 Stück
Somit hat mein Wassermann 2910 Stück Cent-Münzen als Schuppen.
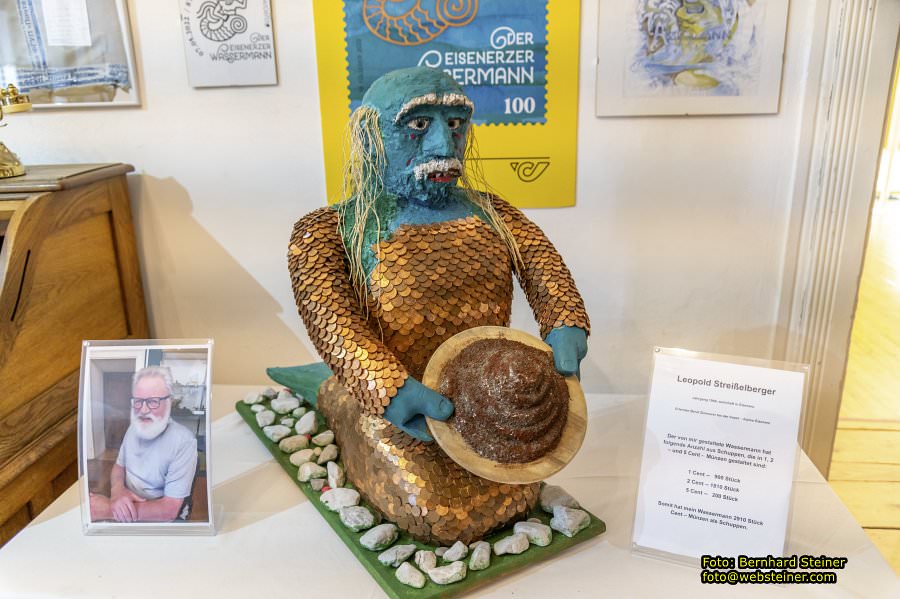
Schreibmaschine Underwood, 1920
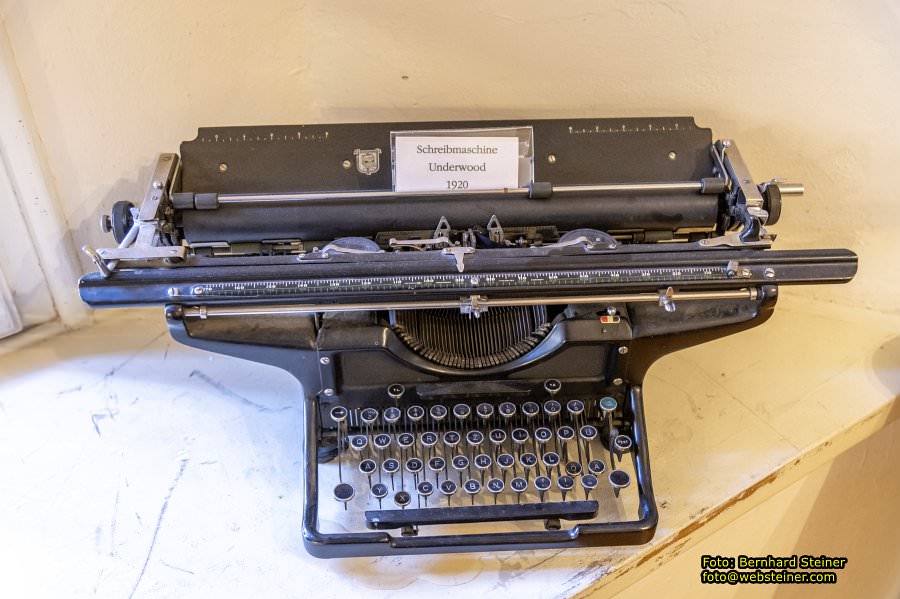
BLEISTIFT, richtig wäre GRAPHITSTIFT
Schreibstift mit einer Graphitmine (entstanden nach der früheren Bleimine).
in Holzfassung (besonders Rot-Zeder).
Die Mine besteht aus hochkohlenstoffhaltigem Graphit mit
hochplastischem Tonanteil. Sie wird bei Weißglut gebrannt und
anschließend zur Verbesserung der Schreibeigenschaften in ein Bad aus
Fetten und Wachsen getaucht. Härtebezeichnungen H, B, F sind die engl.
Anfangsbuchstaben für hard, black und fast.
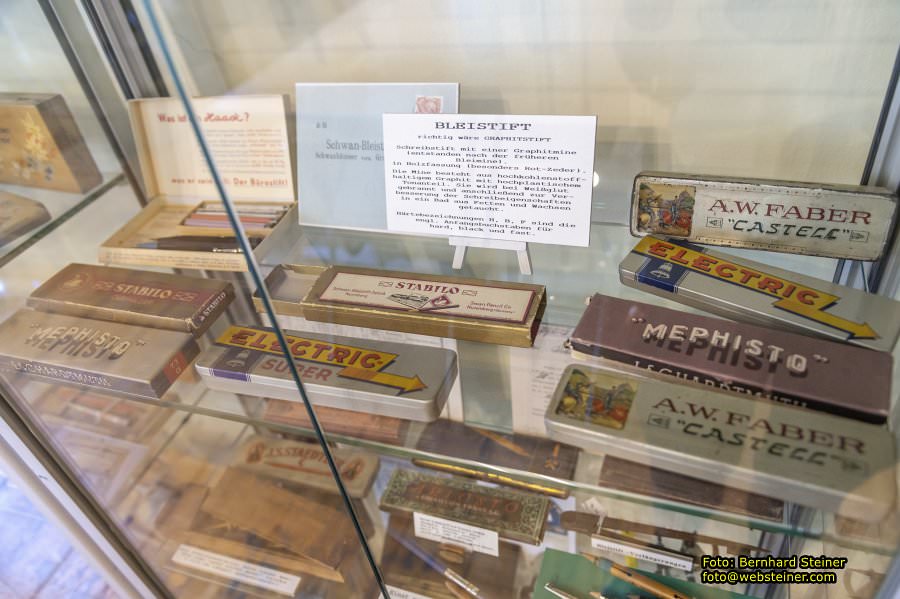
Die Entdeckung des Erzberges
Folgt man dem Lauf des Erzbaches talab, gelangt man dort, wo der
Abfluss des Leopoldsteiner Sees herabrauscht, zu einer grottenartigen
Vertiefung im Felsen. Ein unheimlicher, tiefer, dunkler Wasserspiegel
blinkt aus der Grotte. Hier soll es gewesen sein, wo vor vielen tausend
Jahren manchmal eine seltsame Gestalt aus dem schwarzen Höhlenwasser
auftauchte und sich an der Sonne wärmte. Das seltsame Wesen hatte einen
schuppigen Fischleib und die Bergbewohner hielten es für einen
Wassermann. Obwohl sie Angst vor ihm hatten, beschlossen sie, ihn zu
fangen. Sie fürchteten aber, der schlüpfrige Leib des Geschöpfes würde
ihren Händen entgleiten.
So beschmierten sie einen alten Mantel mit Pech und warfen ihn über das
Männchen als es einmal am Rand der Grotte schlief. Sodann setzten sie
sich rund um den gefangenen Wassermann hin, packten Brot und Speck aus
und begannen ihn zu füttern. Der Wassermann spuckte alles aus, was sie
ihm zu essen gaben und da wurden die Männer ärgerlich. Sie befestigten
eine Hundeleine an seinen Fesseln und machten sich mit ihm auf den
Heimweg. Der Wassermann quakte laut, aber das half ihm nichts.
Als die Männer mit dem Wassermann zu einer Stelle kamen, von der aus
man den Erzberg sieht, wollte er nicht mehr weiter, keinen Schritt. Er
sträubte sich, geriet in hellen Zorn und verlegte sich, als alles
nichts nützte, aufs Bitten und Betteln. Schließlich bot er den Männern
einen hohen Lohn für seine Freilassung an. „Lass hören, was du uns
bieten kannst", antworteten sie. Der Kleine erwiderte: „Wählt selbst
aus, was ihr wollt. Ich kann euch Gold für ein Jahr geben, Silber für
zehn Jahre oder Eisen für immer." Ohne lange zu zögern, riefen die
Männer: „Gib uns Eisen für immer!" „Ihr habt gut gewählt", antwortete
der Wassermann. „Seht, dort steht der Berg, der euch Eisenmetall in
alle Ewigkeit spenden wird. Verwendet es gut zu eurem und eurer
Nachkommen Glück und Segen!" Bei diesen Worten wies er auf den massigen
Erzberg in der Ferne.
Die Männer aber gaben dem Wassermann nicht sofort die Freiheit; sie
wollten zuerst die Ergiebigkeit des Berges erproben. Ein halbes Jahr
bauten sie den Berg ab, an dessen Hänge das rötliche Eisenerz offen
zutage lag. Und wirklich, nach dieser Zeit hatten sie so viel
reichhaltiges Erz gewonnen, so dass sie sicher wussten, der Wasser-
mann hatte die Wahrheit gesprochen. Jetzt brachten sie ihn zu seinem
Wasserloch zurück. Sofort tauchte er in das dunkle Wasser der Höhle
unter. In diesem Augenblick bebten die Felsen und das schwarze Wasser
färbte sich blutrot. Die erschrockenen Leute glaubten eine spöttische
Stimme zu hören: „Um das Beste habt ihr zu fragen vergessen: Um den
Karfunkelstein und die Bedeutung des Kreuzes in der Nuss!" Und fort war
er.
Was seine Worte bedeuteten, konnte niemand sagen. Mancher hat
herumgerätselt und doch nicht die Bedeutung herausfinden können.
Bergleute glauben, der Karfunkelstein sei das beste und sicherste
Grubenlicht und das Kreuz in der Nuss müsse wohl mit der Verwendung des
Kompasses im Bergbau zusammenhängen. Der Wassermann zeigte sich von da
an nie wieder, weder in der Grotte, noch am Leopoldsteinersee. Der
Erzberg aber ist zum ewigen Segen für das ganze Land geworden.
(Sabine Hönegger nach Käthe Recheis: „Sagen aus Österreich", 1970)
* * *
Das ist die vollplastische szenische Darstellung der Sage des
Wassermanns. Diese Guckkastenidylle soll Ihre Fantasie in die
Vergangenheit reisen lassen! - Raudisgund Tobias

Die Sage vom Eisenerzer Wassermann
In Neustückl gewahrt man am Fuße einer schroffen Felswand ein in
Gestein eingebettetes Wasserbecken, dessen klare Fluten von einem aus
der Felsengrotte hervortretenden Bächlein gespeist werden.
Zu König Davids Zeiten, ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt,
bemerkten die Bewohner des lieblichen Tales täglich an dieser Stelle
einen Wassermann, der bei jeder Annäherung von Menschen murrend in die
Grotte verschwand. Die Leute beschlossen, ihn durch List zu fangen,
weil sie hofften, durch ihn zu großen Schätzen zu gelangen. Sie legten
an das Ufer innen mit Pech beschmierte Kleider, ferner Braten und Wein
und verbargen sich im Gebüsche. Der Wassermann näherte sich neugierig
den Gaben der Menschen, aß und trank und schlüpfte ahnungslos in die
Kleider. Er besah sich im Spiegel des Wassers und tanzte wie toll
herum. Der genossene Wein bewirkte, dass er ermattet hinsank und in
einen tiefen Schlaf verfiel.
Die Leute fielen über ihn her, fesselten ihn trotz heftiger Gegenwehr
und führten den Gefangenen talauswärts. Sie kamen zu der Stelle, wo man
den Erzberg zum erstenmal erblickt. Ein altes Wegkreuz kennzeichnet
heute diesen Platz. Hier wollte der Wassermann nimmer weiter und
versprach den Leuten große Schätze für seine Freilassung. Er sprach:
„Nun wählet schnell auf dieser Stell. Ein goldener Fuß bald schwinden
muss. Ein silbernes Herz, die Zeit verzehrts. Ein eiserner Hut hält
lang und gut. Erwägt es klug, dann habt genug!" Alle riefen: „Den
eisernen Hut wollen wir haben". Der Wassermann zeigte ihnen den Erzberg
und erhielt seine Freiheit zurück. Als er wieder in seinem gewohnten
Elemente war, rief er den Leuten höhnisch zu: „Wart ihr doch dumm, da
rund herum. Hätt euch gesagt, wenn ihr gefragt: Wie Gold man macht aus
Spreu und auch das Alte neu. Was dann bedeuten muss das Kreuz in jeder
Nuss - und der Karfunkelstein mit seinem feurigen Schein. Nun ists für
euch zu spät, niemand es mehr verrät!"
Hierauf verschwand er in den Fluten und ward nie mehr gesehen. Die
Leute aber fingen an, den Erzberg abzubauen und wurden reich und
glücklich.
(Johann Krainz vlg. Hans von der Sann: „Sagen aus Eisenerz und seinem
Gebiet" in „Mythen und Sagen aus dem steirischen Hochlande", 1880)

Die hier ausgestellten Briefkasten sind durchwegs Geschenke der
jeweiligen Postverwaltung bzw. Postmuseen, an das Post- u.
Telegraphenmuseum Eisenerz. Daher sind alle Ausstellungsstücke Eigentum
des Post- u. Telegraphenmuseums Eisenerz.
Cypern, Italien, Moldawien, Weißrussland, Türkei, Portugal, Finnland,
Mazedonien, Rumänien, Island, Österreich, Slowenien, Slowakei,
Griechenland, Spanien, Australien, Ungarn, Neuseeland, Russische
Föderation, Norwegen, Schweiz, Brasilien, Vereinigte Arabische Emirate,
Oman, Tunesien, Kroatien, Gibraltar, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien

Postkästen aus Italien, Mazedonien, Irland (Laternenpfahl-Briefkasten)




Münzfernsprecher
Der erste „Telefonautomat" Österreichs wurde am 17. August 1903 im
Wiener Südbahnhof in Betrieb genommen. Es handelte sich um eine
„Telephonstation", welche nach Einwurf von 20 Heller zum Führen eines
aktiven Gespräches zur Verfügung stand. Ende 1907 standen in Österreich
44 öffentliche Münzfernsprecher im Einsatz: 42 in Wien und 2 in Tirol
in den Bahnhöfen Trient und Brixlegg. Zehn Jahre später waren in Wien
600 und in den Ländern 178 öffentliche Münzfernsprecher im Einsatz. Der
Münzfernsprecher entwickelte sich bis in die heutige Zeit zum
Multimediapoint.
Bedienungsanleitung
1.) Fernhörer abheben.
2.) Einschilling-Münzen einwerfen.
3.) Wählen, nach Melden des gewünschten Teilnehmers sofort
4.) Zahlknopf (rote Taste) drücken, sonst keine Sprechverständigung.
5.) Wenn erstes Gespräch nicht zustande kommt - bei „Besetzt",
„Nichtmelden" oder „Fehlverbindung" -, Fernhörer einhängen. Münzen
fallen in die „Rückgabe". Vorgang ab Punkt 1 kann wiederholt werden.
6.) Werden nach Beendigung des ersten Gesprächs weitere Gespräche
gewünscht, nur rote Taste drücken, wählen und sprechen. Nach Melden des
Teilnehmers ist rote Taste nicht zu drücken.
Achtung: Ist während des Gespräches keine Münze mehr sichtbar und
ertönt das Warnsignal im Hörer (Pfeifton), so müssen innerhalb von 10
Sekunden wieder Einschilling-Münzen eingeworfen werden, sonst wird die
Verbindung getrennt.
Erscheint eine eingeworfene Münze nicht im Sichtkanal, so ist die
schwarze Taste zu drücken bis die schadhafte Münze in die „Rückgabe"
fällt, und eine andere Münze zu verwenden.


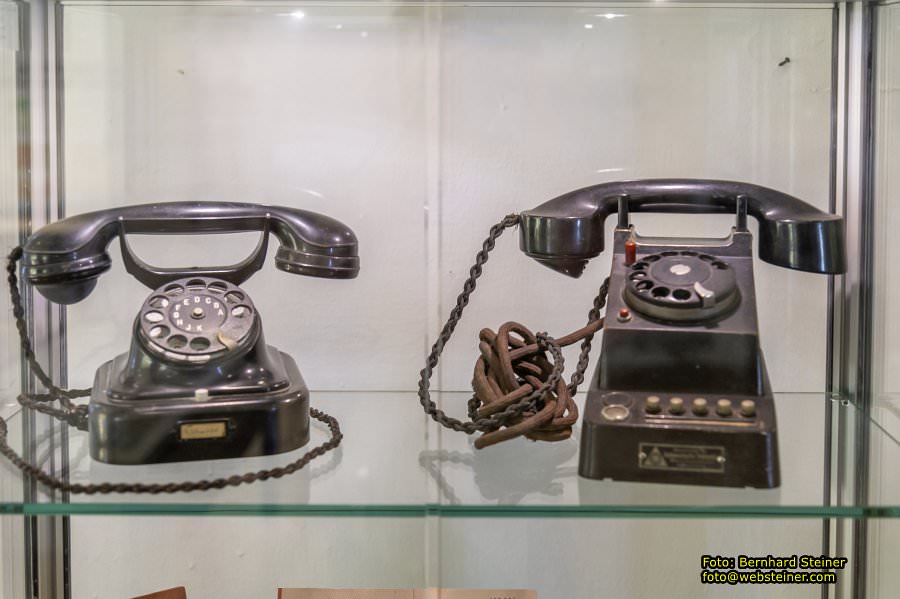
Frankiermaschine Firma Francotyp (1920) und Schreibmaschine Firma Corona

Briefkasten Deutsche Reichspost
ÖSTERREICH WURDE AM 13.3.1938 AN DAS DEUTSCHE REICH ANGESCHLOSSEN.
ÜBERSTREICHUNG DER GELB LACKIERTEN BRIEFKÄSTEN MIT ROTER FARBE.


Rechenmaschinen Walter WSR 160, 1966
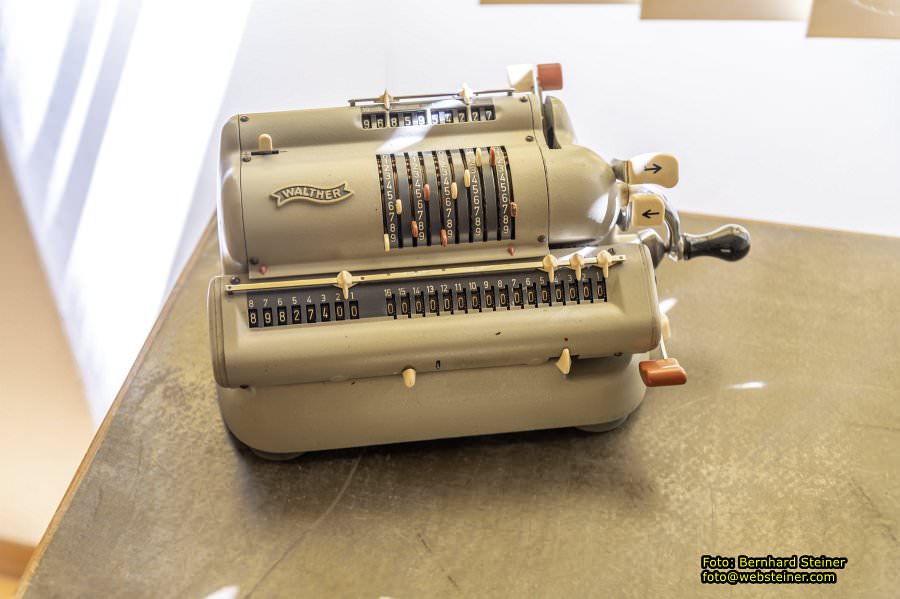
Original Öst. Alpenpost 1852

Postmusik Linz, Innsbruck, Salzburg, Wien

ÖSTERREICHISCHE POST- UND TELEGRAPHENVERWALTUNG Rangabzeichen um 1955

BTX - Bildschirmtext
Das BTX wurde in Österreich von 1982 bis 2001 von der PTV angeboten. Es
war ein Information- und Kommunikationsdienst und damit ein Vorgänger
des heutigen Internets. Die Informationen wurden über Seiten *Nummer#
aufgerufen. Es konnte auch auf externe Rechner zugegriffen werden z. B.
Теlefonbuch, Banken (Telebanking).
Das MUPID (Mehrzweck Universell Programmierbarer Intelligenter Decoder)
wurde, als spezielles BTX Endgerät von der TU Graz, entwickelt. Im
Gegensatz zu anderen BTX Terminals konnte das MUPID als eigenständiger
Home Computer verwendet werden. Das MUPID war mit der BTX Zentralle,
über ein Moden mit 75 bit/s Upload und 1200 bit/s Download, verbunden.

OES (Österreichisches elektronisches System)
Das OES ist ein digitales, rechnergesteuertes, vollelektronisches Vermittlungssystem.
Es verwendet elektronische Bauelemente (Halbleiter, integrierte
Schaltungen, Mikroprozessoren) anstelle der früher in der
Telefonvermittlungstechnik üblichen elektromechanischen Relais,
Schalter und Wähler.
OES wurde in Österreich eingeführt, weil die Telekom Austria AG ihre
Einrichtungen an den internationalen technologischen Standard anpassen
musste.
Ab 1986 wurde die analogen Vermittlungsstellen kontinuierlich durch OES
Vermittlungsstellen ersetzt. 1999 konnte die Volldigitalisierung
abgeschlossen werden.
Ab Dezember 2009 begann die Umstellung des digitalen,
leitungsvermittelnden OES Netzes in ein neues Vermittlungssystem Next
Generation Network. NGN ist ein paketvermittelndes Netz unter Nutzung
des Internet Protokolls. Der nur die Sprachtelefonie betreffende Teil
des neuen Netzes wird als NGN-V bezeichnet. Das Kürzel V steht für
Voice over Internet Protocoll (VoIP). Der Systemtausch von OES auf
NGN-V wurde im März 2012 abgeschlossen.
OES Vermittlungsstellen gibt es in zwei Versionen:
◆ OES-D gefertigt von Kapsch AG und Schrack Elektronik AG (Austria Telecommunication GmbH).
◆ OES-E gefertigt von Alcatel Austria AG und Siemens AG Österreich.
Beide Versionen boten den gleichen Komfort und die gleichen
Leistungsmerkmale, so dass für Telefonteilnehmer kein Unterschied
bestand.
Die Vorteile der OES Technik:
• Vollelektronisches, digitales Koppelnetz
• Blockierungsfrei; weniger Besetztfälle
• Zuverlässig durch Doppelung der Einrichtungen (Redundanz)
• Zentrale und dezentrale Mikroprozessoren
• Schneller Verbindungsaufbau durch Mehrfrequenzwahl
• Verwendung hochintegrierter elektronischer Baugruppen und Software Steuerungen
• Geringer Platzbedarf (nur 20% gegenüber konventionellen Systemen)
• Rasche Montage und Inbetriebnahme
• Einfache Erweiterbarkeit und Anpassung an betriebliche Forderungen
• Modularer Hard- und Software Aufbau
• Zentraler Betrieb und Überwachung
• Wartungsfrei; weniger personalintensiv
• Rasches Reagieren auf Kundenwünsche
Hier sehen Sie die UVSt (Unselbständige Vermittlungsstelle) von Radmer.

Fernmeldewesen
In diesem Raum sehen Sie einen Querschnitt aus Vermittlungs- und
Übertragungseinrichtungen der neueren Fernmeldetechnik. Rechts vom
Eingang sehen Sie Exponate des analogen Selbstwählfernverkehrs mit
seinem Herzstück dem Registerverzoner und einer Übersichtskarte der
österreichischen Vermittlungsstellen. Das Kabelendgestell war der
Abschluss der symmetrischen Fernkabeln. In den Vitrinen sehen Sie
Mobiltelefone, Schnurlostelefone und Faxgeräte. An der hinteren Wand
ist ein Koaxsystem montiert. An der linken Wand sehen Sie eine digitale
Vermittlungsstelle (OES) und Komponenten vom ISDN. Im vorderen Bereich
sehen Sie Einrichtungen der digitalen Übertragungstechnik (PCM 30) und
der Lichtwellenleitertechnik.

Die Geschichte des Telefons
1861: Der deutsche Lehrer Philipp Reis führte seine Erfindung, das
gesprochene Wort mit Hilfe elektrischer Ströme in die Ferne zu
übertragen, in der Öffentlichkeit vor.
1876: Der Amerikaner Alexander Graham Bell entwickelte den ersten
Fernsprecher, der schon aus Spule, Dauermagnet und Membra- ne bestand.
Dies war die Grundlage zur Weiterentwicklung des heutigen Telefons.
1878: Dieses Jahr gilt als Geburtsjahr der Telefonie, da Thomas Edison
die Induktionsspule erfunden hat. Die erste Telefonzentrale wurde in
New Haven (USA) aufgebaut, die Fernsprechapparate der einzelnen
Teilnehmer wurden durch Leitungsdrähte mitei- nander verbunden. Später
folgten die Städte London und Paris.
1881: Wien und Berlin traten in den Kreis dieser Städte. Start der
Telefonie in Österreich war am 3 Juni. Der Wiener Privat -
Telegraphengesellschaft wurde die Konzession erteilt, ein
Fernsprechnetz in einem Radius von 15 km rund um den Stephans- dom zu
errichten.
1882: Am 1. August diesen Jahres wurde der Telefonverkehr auch in Graz
eröffnet, dadurch war diese Stadt die zweite des Kaiserrei- ches, die
vom Nachrichtenmedium Telefon erobert wurde. Andere wichtige Städte wie
Prag, Triest, Lemberg und Pilsen folgten unmittelbar.
1887: Ab diesem Jahr lag die Verantwortung der Telefonie in Österreich
bei der K. u. K. Post- und Telegraphenverwaltung. Der Staat kaufte die
Konzessionen der privaten Telefonnetze auf und begann den Weiterausbau
des Fernsprechnetzes in Österreich,
1899: Da der handvermittelte Telefonverkehr durch das Fräulein vom Amt
wegen der rasch zunehmenden Anzahl an Sprechstellen sich als
umständlich erwies, wurde auf den, vom Amerikaner Strowger erfundenen,
elektromechanischen Wähler mit Nummern- scheibe zurückgegriffen. So
wurde der erste automatische Telefonverkehr in Wien installiert und
ständig verbessert.
1910: Wurde in Graz Europas größtes automatisches Amt mit 2000 Einzel- und 1200 Gesellschaftsanschlüssen eröffnet.
1930: Das Amt in Graz wurde durch den technischen Fortschritt zu klein
(zu wenig Kapazität) und gegen ein Zehntausenderamt (=10 000
Anschlüsse) ausgetauscht.
1933: durch den 1. Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise gab es
massive Rückschläge in der Entwicklung der Telefonie. Das Telefon wurde
zum Luxusgut, welches sich nur noch wenige Bürger leisten konnten. Wer
telefonieren wollte ging, zum Münzfernspre- cher. Die Post- und
Telegraphenverwaltung (PTV) reagierte mit Preisnachlässen, dadurch
entstanden wieder 11.000 neue An- schlüsse in Österreich.
1937: Es gab schon ca. 286.000 Telefonanschlüsse in Österreich. Durch
den Anschluss von Österreich an Deutschland wurde die Ei-
genständigkeit der PTV beendet und alle Femmeide - Angelegenheiten
wurden von Berlin aus gesteuert.
1940: In Graz wurde die Fernmeldemonteurschule errichtet.
1945: Nach dem Ende des 2. Weltkrieges, ab April 1945, gab es die PTV
wieder und sie übernahm wieder die Österreichischen Fern-
meldeeinrichtungen, welche aber nach dem Krieg in einem sehr desolaten
Zustand waren. Durch den ungeheuren Aufbauwillen gab es bereits Ende
1945 in Wien schon 33.364 Telefonanschlüsse und ein Jahr später bereits
85.976.
1951: Durch den massiven Ausbau, die Entwicklung und Automatisierung
entstand 1951 das Fernwahlsystem 51. Dieses Kennzahlen- system löste
das bis dahin gebräuchliche Nummem-Ziffern-System ab und ersetzte es
mit den heute noch gebräuchlichen vier- stelligen Ortskennzahlen.
Parallel dazu schufen Koaxialkabel und die Richtfunktechnik die
Voraussetzungen für einen zügigen Ausbau des Selbstwählfenverkehrs.
1955: Es gab schon über 300.000 Telefonanschlüsse in Österreich und es werden ständig mehr.
1965: Intelsat installierte ihren ersten Satelliten im Weltall, über
welchen die Femsprechleitung zwischen Wien und New York geschal- ten
wurde.
1972: Österreich war eines der ersten Länder, in dem der
Fernsprechverkehr vollautomatisiert wurde. Durch das Ende des
„Fräuleins vom Amt" konnten 1,6 Millionen Telefonteilnehmer selbst
wählen, und das nicht nur innerhalb Österreichs, auch die Teilnehmer
aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Italien waren ab nun direkt
erreichbar.
1978: Es wurde begonnen das österreichische Telefonsystem zu
digitalisieren, d.h. das analoge Wählsystem wurde durch ein digitales
(vollelektronisches) ersetzt. Auch die bisher verwendeten Wählscheiben
Apparate wurden durch Tastentelefone ersetzt. Die OES-Technik
(Österreichisches Digitales Telefonsystem) war der Grundstein für die
Herstellung von ISDN Anschlüssen.
1980: Durch die Inbetriebnahme der Erdfunkstelle Aflenz ist es möglich
interkontinentale Telefonverbindungen via Satellit abzuwickeln.
1992: Der Start von ISDN in Österreich.
1996: Die Post- und Telegraphenverwaltung (PTV) wurde ein
eigenständiges Unternehmen in Form einer Aktiengesellschaft namens
Post- und Telekom Austria AG (PTA AG).
1998: VoIP Voice over IP (Intranet-, Internettelefonie) ist schon in
Firmennetzwerken möglich. Außerdem wurde durch die Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes das Unternehmen PTA AG ausgegliedert und so
entstand das heutige erfolgreiche Unternehmen A1 Telekom Austria AG.
Damit endet auch die mehr als 100-jährige Verbindung zwischen Telefon
und Briefpost.
1999: Alle elektromechanischen oder halbelektronischen Anlagen waren
ersetzt; auch der letzte Viertelanschluss" wurde ein Einzelanschluss.
d.h. ab diesem Zeitpunkt ist das österreichische Festnetz vollkommen
digitalisiert. Es gab ca. 3,8 Millionen Festnetzanschlüsse, davon
254.000 ISDN Anschlüsse.


Fernmeldewesen
In diesen Raum sehen Sie einen Querschnitt aus der Entwicklung der Telegraphie und Telefonie.
Eine Telefonvermittlungsstelle und eine Nebenstellenanlage sind von
inneren Aufbau sichtbar dargestellt und können mit Hilfe installierter
Fernsprechapparate zum besseren Verständnis der Verbindungsherstellung
in Betrieb genommen werden. Eine Nebenstelle ist über eine Freileitung,
mit zwei verschiedenen Bauweisen, an die Anlage herangeführt. Viele der
Exponate sind mit Zahlen bezeichnet, die das Konstruktionsjahr
ausweisen (z.B. W 48 bedeutet Wählapparat Baujahr 1948)

Fernschreibnetz (1936 bis 2006)
Das Fernschreibnetz, später auch TELEX (TELeprinter Exchange) genannt,
wurde in Österreich 1936 eingeführt. 1945 wurden die Städte Graz und
Linz an das Hauptamt in Wien an geschalten. Bis 1948 folgten die Städte
Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und Bregenz. Für Wählverbindungen wurde
TW 39 (Telegraphen Wählsystem) verwendet, aufgebaut mit Wählern und
Relais. Die Verbindung wurde, ähnlich wie beim Fernsprechen, mit
Nummernscheiben gewählt.
Das elektromechanische Vermittlungssystem TW 39 wurde in den
80er-Jahren durch das elektronische Vermittlungssystem EDS
(Elektronische Daten System) ersetzt. Für die schriftliche
Kommunikation war das zuverlässige Telexnetz für die Wirtschaft
unverzichtbar. Der Teilnehmerhöchststand in Österreich wurde mit 25.954
Teilnehmer im Jahre 1987 erreicht. Durch die Einführung von Telefax ist
die Zahl der Telex Teilnehmer weltweit stark rückläufig. Ende 2001
wurde das öffentliche Telex Netz in Österreich eingestellt. Für eine
besondere Gruppe (Banken) wurde es noch bis Ende März 2006
weiterbetrieben.
Fernschreiber
Der Vorgänger des Fernschreibers war der Huhges-Typendrucktelegraph,
den Sie im Parterre des Museums sehen. Man unterscheidet Blattschreiber
und Streifenschreiber. Blattschreiber geben den Text auf einer
Endlosrolle aus. Streifenschreiber hingegen geben den Text auf einem in
der Regel 9,5 mm breiten Papierstreifen aus. Diese wurden bei
Telegrammen eingesetzt.
Fernschreiber verwenden eine sequenzielle, digitale und asynchrone
Datenübertragung mit Start- und Stoppbits und nutzen einen 5-Bit-Code,
das internationale Telegrafenalphabet Nr. 2. Dieser Code beschränkt den
zur Verfügung stehenden Zeichensatz auf 32 Zeichen (25). Zur
Übertragung von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen ist der Code auf
zwei Ebenen aufgeteilt, zwischen denen mittels Spezialzeichen zur
Buchstaben-Ziffernumschaltung gewechselt wird. Übertragen wurde mit 50
Baud (hier gleich 50 Bit/s) Übertragungsgeschwindigkeit. Das verwendete
Zeichenformat besteht aus 1 Startbit, 5 Codebits und 112 Stoppbits.
Dadurch konnte im Telex Netz, aufgrund der gebräuchlichen 50 Baud, eine
Übertragungsrate von 6,67 Zeichen pro Sekunde erreicht werden. Dies
entspricht 400 Zeichen pro Minute.
* * *
Fernschreiber Olivetti Blattschreiber und Fernschreiber Blattschreiber Lorenz 133

Telefonzelle mit Wertkarte, somit ohne Münzen

Teilnehmer 3 (8657) und Teilnehmer 4 (8674)

Lochstreifen, Speichermedium der 60er-Jahre
Ein Lochstreifen ist ein aus Papier, Kunststoff oder einem
Metall-Kunststoff-Laminat bestehender streifenförmiger Datenträger,
dessen Information durch eingestanzte Löcher festgehalten wird. Das
Prinzip entspricht einer Lochkarte mit variabler Länge. Bereits im 18.
Jahrhundert wurden Lochstreifen, hier aneinander gereihte
Holzplättchen, zur Steuerung von Webstühlen verwendet.
Die Lochstreifen dienen seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch der
Darstellung und Speicherung von Daten. Zunächst wurden sie in der
Datenübermittlung durch Telegraphen eingesetzt und später als
Speichermedium für Fernschreiber (5 Bit, Breite 17,4 mm) und Computer
(8 Bit, Breite 25,4 mm) verwendet. Der Fernschreibcode ist ein 5 Bit
Code, damit lassen sich 32 Zeichen darstellen (25). Diese 32 Zeichen
reichen nicht aus alle Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen
darzustellen, daher eine Doppelbelegung durch Buchstaben und Ziffern
Wechsel.
* * *
Fernschreiber Handlocher (Diente zum Erstellen von Lochstreifen)
Fernschaltgerät (Diente zur Herstellung einer Fernschreibverbindung)
Fernschreiber T 37 mit Lochstreifen

Heir geht die Post ab.

Verschiedene Telefonapparate

Fernsprechapparat W 80 mit Komfort Tastwahlblock
Fernsprechapparat W 80 mit Tastwahlblock
Fernsprechapparat T 90

Fernsprechapparat T 95, Fernsprechapparat T 98
Gebührenzähler mechanisch, Gebührenzähler elektronisch

Fernsprechapparat W 28 Wandapparat, Mithörapparat, Fernsprechapparat W 48 Wandapparat mit Taste
Fernsprechapparat mit Umschalter, Fernsprechapparat W 38

OB Vermittlungsschrank Orts- und Fernumschalter
Bis zur vollständigen Automatisierung des Fernsprechnetzes wurden
Klappenschränke dazu benutzt, die Sprechverbindung zwischen zwei
Fernsprechteilnehmern herzustellen. Dazu waren jeder Sprechstelle eine
Klinke und ein Elektromagnet mit einem einfachen Klappenmechanismus
zugeordnet. Jeder Fernsprechapparat war zur damaligen Zeit mit einer
Ortsbatterie (OB) ausgestattet. Wollte jemand ein Ferngespräch führen,
betätigte er den Kurbelinduktor an seinem Fernsprechapparat. Damit
erzeugte er einen Wechselstrom, der „seinen" Elektromagneten im
Klappenschrank zum Anzug brachte. Dadurch wurde eine metallische Klappe
freigegeben, die herunterklappte und damit dem „Fräulein vom Amt" einen
Verbindungswunsch mitteilte. Die Verbindung wurde durch entsprechendes
Stecken der Verbindungsschnüre in die zugehörigen Steckbuchsen
hergestellt. Das Ende des Gespräches wurde der Vermittlung durch
neuerliches Betätigen der Kurbel bekanntgegeben.
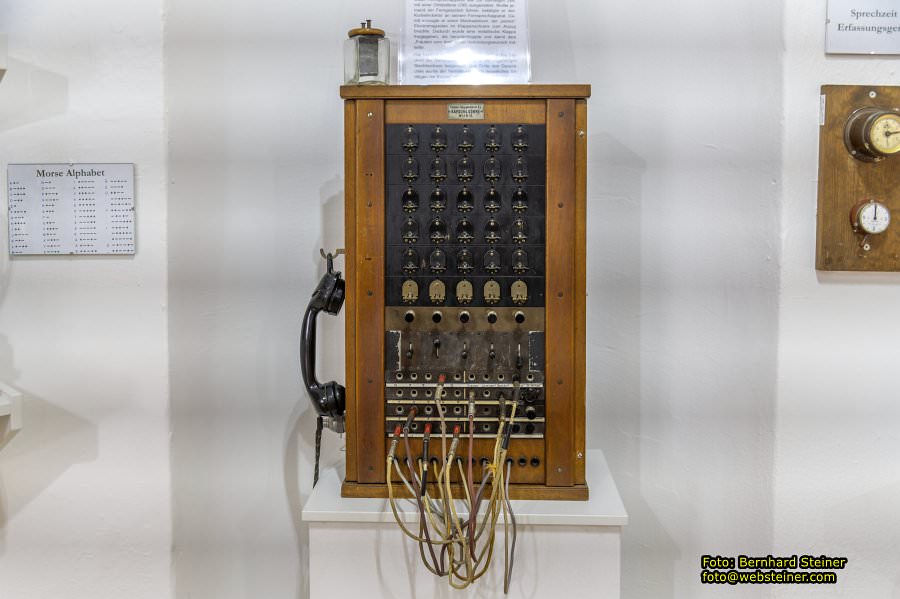
Morse Apparat

Zentralbatterie Wählapparat

Wählvermittlungsstelle 1927
In dieser Vermittlungsstelle wurden erstmals die Ziffern der
Telefonnummer mit Hilfe von Drehwählern und Hebdrehwählern verarbeitet.
Am Ende dieser Wählerstrecke befand sich die Leitung zum gewünschten
Teilnehmer.
Sämtliche für das Zustandekommen der Verbindung notwendigen
Nebenfunktionen, wurden von dieser Anlage automatisch generiert. Diese
Anforderungen waren das Wählaufforderungszeichen, Веsetztzeichen,
Rufkontrollzeichen, der Rufstrom und die Gesprächszählung. Die Anlage
wurde von einer Zentralbatterie mit dem notwendigen Gleichstrom
versorgt. Diese Bauform wurde ab 1927 sowohl als Ortswählvermittlung
als auch als Nebenstellenanlage für große Firmen verwendet.
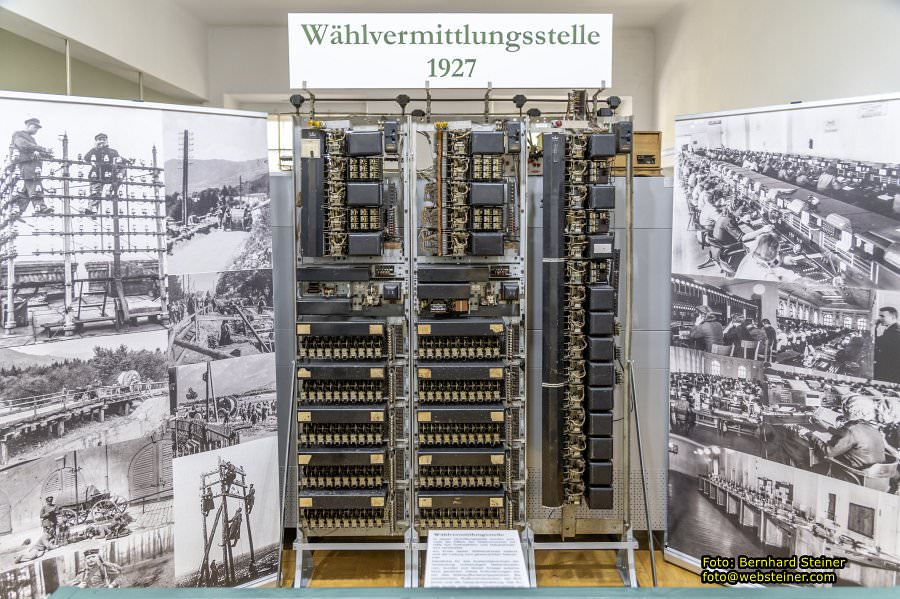
Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: