web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Feldbach
Stadtpfarrkirche & Heimat.Museum im Tabor, August 2024
Feldbach ist mit über 13.500 Einwohnern die
fünftgrößte Stadt der Steiermark. Sie ist Sitz der
Bezirkshauptmannschaft des politischen Bezirks Südoststeiermark. Das
Stadtgebiet von Feldbach liegt im mittleren Raabtal. Die Raab
(ungarisch Rába, lateinisch Arrabo) ist ein rechtsufriger Zufluss zur
Donau mit einer Gesamtlänge von 250 km.
Villa Hold (Neues Rathaus von Feldbach)
Das am Kirchenplatz zwischen Pfarrkirche und Hauptplatz stehende, im
neugotischen Stil zwischen 1890 und 1892 errichtete Gebäude wurde nach
den Plänen des Grazer Architekten August Gunolt im Auftrag der
vermögenden Brauerei- und Hotelbesitzerin Josefine Hold (1852–1927)
ausgeführt. Sie war die Witwe des 1878 früh verstorbenen
Brauereibesitzers Engelbert Hold, ein Neffe von Franz Hold (1806–1872),
dem Besitzer der Brauerei Puntigam. Seit dem 16. Juni 2023 befindet sich in der umgebauten Villa Hold die Stadtverwaltung der Stadt Feldbach.

Das Rathausviertel
Durch sorgsame, unter Bedacht auf den Denkmal- und Ortsbildschutz
ausgeführte Restaurierungen und Gestaltungen entstand im Jahr 2023 am
nördlichen Ende des Hauptplatzes das neue Rathausviertel der Stadt
Feldbach. Die Bezeichnung geht darauf zurück, dass die in den Jahren
1890-92 als Privathaus erbaute Villa Hold nunmehr als neues Rathaus
genutzt wird. Neben diesem bilden die 2020/21 sanierte, wieder im
Originalton gefärbelte Stadtpfarrkirche zum hl. Leonhard, der bunte,
das „Miteinander leben in Vielfalt" widerspiegelnde Kirchturm und der
im 15. Jahrhundert als Schutzburg erbaute, heute das Heimatmuseum
beherbergende Tabor die bemerkenswertesten Bauwerke.
Dazu kommen moderne Baudenkmäler wie der Busbahnhof oder der
„Fisch-Brunnen", weiters der steiermarkweit einzigartige, künstlerisch
gestaltete Dekalogweg und die großzügigen, schön und wertig gestalteten
Plätze und Freiflächen, die zu einem außergewöhnlichen Ambiente
beitragen. Das neue Rathausviertel liegt an der historischen Achse der
Stadt, die vom 1873 errichteten Bahnhof über die Franz-Josef-Straße,
den Kirchenplatz, den Rathausplatz und den Hauptplatz zum „Alten
Rathaus" an dessen südlichem Ende führt, vor dem sich das Wahrzeichen
der Stadt, der „Steinerne Metzen", ein historisches Getreidemaß,
befindet.

Das Bestehen einer Kirche geht auf die erste urkundliche Erwähnung von
Feldbach im Jahr 1188 zurück. Rund um sie entstand im 15. Jahrhundert
eine Fluchtburg, der Tabor. Im Jahr 1688 erfolgte der Bau des barocken
Kirchturms. Ein Teil der alten Kirche ist erhalten und wird seit 1954
als Gedächtniskirche für die Opfer der beiden Weltkriege genutzt. Der
abgetragene Teil findet sich als Umriss in der Pflasterung des
Kirchenplatzes wieder.
Von 1898 bis 1900 wurde nach Plänen von Arch. Johann Pascher die neue
Pfarrkirche zum hl. Leonhard errichtet. Sie ist einschiffig und hat
einen schmäleren, gerade abgeschlossenen Altarraum. Die Ausmaße. des
Innenraums sind beachtlich. Die volle Länge beträgt 48,6 Meter, die
Weite inklusive der Kapellen dehnt sich auf 20,4 Meter aus, die Höhe
beträgt 20,2 Meter. Der Hochaltar entstand im Jahr 1907. Die Malereien
im Inneren der Kirche wurden 1947 vollendet. Zum 100jährigen Bestehen
erfolgte im Jahr 2000 eine Innenrenovierung. Im Jahr 2012 wurde die
Pfarrkirche mit einer neuen Orgel ausgestattet.
In den Jahren 2020/21 wurden die komplette Fassade und das Dach
erneuert, wobei die ursprüngliche Farbe wieder hergestellt wurde.
Gleichzeitig erfolgte die Neugestaltung des Kirchenplatzes und die
Anlegung eines Dekalog-Weges. Oberhalb des Hauptportals ist wieder eine
Statue des Pfarrpatrons hl. Leonhard zu sehen, der im 6. Jahrhundert in
Frankreich lebte und sich für Gerechtigkeit und zu Unrecht Gefangene
einsetzte. Seine Darstellung mit der Kette ließ ihn später zum
bäuerlichen Fürsprecher werden.

Die Pfarrkirche zum hl. Leonhard
Die Pfarrkirche zum heiligen Leonhard wurde 1898 bis 1900 nach Plänen
von Arch. Johann Pascher unter Verwendung von Renaissanceformen als
Ausbau zur alten Pfarrkirche (1188 urkundlich erwähnt) errichtet. Der
Altarraum erhielt sein heutiges Aussehen nach einem Entwurf von Prof.
Erwin Talker aus Anlass der Innenrenovierung im Jahr 2000. Im gesamten
Innenraum verteilt findet sich eine Vielzahl von bemerkenswerten
Malereien und Statuen. Im Jahr 2012 erhielt die Stadtpfarrkirche eine
neue, hochwertige Orgel. Diese wurde von der Firma Mathis hergestellt,
sie verfügt über 46 Register und 3.597 Pfeifen. In den Jahren 2020/21
erfolgte eine umfassende Außenrenovierung, bei der unter anderem die
ursprüngliche Farbgebung wieder hergestellt wurde. Weiters wurde eine
Statue des Kirchenpatrons in einer Giebelnische hoch über dem
ostseitigen Haupteingang aufgestellt. Die Nische war vermutlich seit
dem Jahr 1943 leer, als eine sich dort befindliche Statue verschwand.
An die Geschichte der Kirche erinnern die zuletzt 2014 generalsanierte
Gedächtniskirche, ein Rest der ursprünglichen gotischen Kirche aus dem
12. Jahrhundert, und die im Kirchenmuseum verwahrten Exponate. Nach
außen sichtbar ist der Grabstein von Wolfgang und Amalia Zwickl, in
deren Besitz sich zu Lebzeiten das Schloss Hainfeld befand. Deren
Enkel, Georg Bartholomäus Zwickl, errichtet in den Jahren 1642 bis 1652
das Franziskanerkloster in Feldbach, welches mit Unterbrechungen bis
zum Jahr 2012 bestand.
Dein Wille geschehe
So beten wir im Gebet Jesu, im Vaterunser. Die Darstellungen am
Triumphbogen haben auch mit dem Willen Gottes zu tun. In der Mitte oben
ist die Heiligste Dreifaltigkeit dargestellt. Jesus streckt seine Hand
nach links aus. Auf dieser Seite können wir Adam und Eva erkennen, die
den Willen Gottes ablehnten und wie Gott sein wollten. Der
ausgestreckte Arm Jesu weist darauf hin, dass der Sohn Gottes auch die
Stammeltern Adam und Eva aus der Finsternis des Bösen befreien möchte.
Gott-Vater richtet unsere Blicke auf die rechte Seite. Hier sehen wir
Maria und den Erzengel Gabriel. Diese junge, gläubige Frau sagte Ja zum
Willen Gottes, nämlich Mutter seines Sohnes zu werden. Obwohl sie nicht
wusste, was der Plan Gottes alles für sie beinhaltete, gab sie
vertrauensvoll ihre Zustimmung: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast."
(Lukas 1,38)

„Gott ist die Liebe" - das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Das
Symbol für die Liebe ist uns allen bekannt, es ist das Herz. In der
Stadtpfarrkirche gibt es zwei Statuen (Werke der Grazer Bildhauer Jakob
Gschiel und Peter Neuböck), die mit einem Herzen dargestellt sind. Sie
finden sich bei den beiden Altären links und rechts des Triumphbogens,
die 1901 und 1902 erbaut wurden. Herz Jesu und Herz Mariä manche mögen
diese Darstellungen vielleicht „kitschig" finden, doch ihre zweifache
Botschaft ist von großer Bedeutung: „Gott hat ein Herz für uns Menschen
- Jesus ist dieses Herz" und „Jesus schenkt uns seine Mutter - Ma- rias
Herz schlägt auch für uns". Es ist nicht von ungefähr, dass sich die
beiden Statuen in der Stadtpfarrkirche befinden. Im 19. Jahrhundert
erfreute sich die Herz-Jesu- und die Herz-Mariä-Verehrung großer
Beliebtheit. Am 11. Juni 1899, an der Schwelle zum Hl. Jahr 1900,
vollzog Papst Leo XIII. sogar die Weltweihe an das Heiligste Herz Jesu.
Ein Jahr später wurde die neue Feldbacher Kirche geweiht; da darf dann
natürlich im Gotteshaus das „Herz Jesu" und das „Herz Mariä" nicht
fehlen.
Vom Jesus-Altar herab grüßen uns auch der hl. Antonius von Padua
(1195-1231) mit dem Jesuskind und der hl. Aloisius von Gonzaga
(1568-1591). Antonius war ein großer franziskanischer Volksprediger und
ist bis heute wegen seiner „Hilfe bei der Suche nach Verlorenem" bei
den Gläubigen sehr beliebt. Aloisius wollte Jesuit werden, erkrankte in
jungen Jahren bei der Pflege römischer Pestkranker und starb selbst an
Pest. Einige Jahrhunderte wurde Aloisius besonders als Patron der
Jugend verehrt und als solcher findet er sich auch in unserer
Pfarrkirche.
Maria wird an ihrem Altar mit den Begleiterinnen Barbara und Philomena
gezeigt. Die hl. Barbara (+306) war eine begeisterte Christin und wurde
in der Verfolgungszeit wegen ihrer Liebe zu Christus mit dem Schwert
hingerichtet. Sie gilt als Beschützerin der Bergleute, die es aufgrund
des Basaltabbaus auch in Feldbach gibt. Die hl. Philomena war auch eine
frühchristliche Märtyrin, deren Grab erst im 19. Jahrhundert in der
Priscilla-Katakombe in Rom entdeckt wurde. Ihre Verehrung war gerade
zur Zeit des Neubaus unserer Kirche sehr groß und so fand sie auch bei
uns Aufnahme.

Audienz bei einer Königin
Wenn wir uns nun umdrehen, kommt es sogar zu einer Begegnung mit einer
„echten Königin"; keiner ist davon ausgeschlossen. Die Monarchin wurde
in Näfels in der Schweiz geboren. Es handelt sich um die Königin der
Instrumente - die Orgel. Auf Initiative von Stadtpfarrer Mag. Friedrich
Weingartmann - er war auch für das Glockenprojekt 2015, die Renovierung
des Kirchturms 2017 und für die Außenrenovierung der Stadtpfarrkirche
2020/21 verantwortlich - kam es zum Bau der neuen Orgel durch die Firma
Mathis. Aus den vielen technischen Daten der Orgel seien nur die
Register- und Pfeifenzahl genannt: 46 Register und 3.597 Pfeifen. Am
10. November 2012 wurde die Orgel, die wahrhaft eine Königin ist, von
Bischof Dr. Egon Kapellari geweiht. Er war es auch, der 2015 die Weihe
der vier neuen Glocken vornahm. Das Fenster über der Orgel stammt aus
dem Jahr 1980 und wurde nach dem künstlerischen Entwurf von Sr. Basilia
Gürth, der späteren Äbtissin der Abtei St. Gabriel im benachbarten
Pertlstein, im oberösterreichischen Kloster Schlierbach hergestellt. Im
oberen Teil des Glasfensters offenbart sich uns das Gotteslamm.

Bei der Kanzel, die seit 1908 unsere Kirche ziert, beginnen wir nun mit
einem kleinen Rundgang. Bis zum II. Vatikanischen Konzil (1962-1965)
war die Kanzel der Ort der Predigt und leistete früher, aufgrund des
Fehlens des Lautsprechers, große Dienste. Um die Wichtigkeit der
Verkündigung des Wortes Gottes zu unterstreichen, wurde sie besonders
gestaltet. Unser Kanzelkorb zeigt Bilder mit Christus und den vier
Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie stammen vom
Edelsbacher Künstler Michael Raballer. Der Grazer Bildhauer Jakob
Gschiel (von ihm stammt auch die Herz-Jesu-Statue) schuf den Engel mit
der Posaune, der am Schalldeckel zu sehen ist. Im Neuen Testament wird
einige Male darauf hingewiesen, dass der Engel mit der Posaune die
Wiederkunft Christi ankündigt. Der Engel, der mit einem Finger nach
oben weist, möchte uns wecken, damit wir als Freundinnen und Freunde
Jesu unseren Weg gehen, und diese Freundschaft nicht „verschlafen".

Ein Franzose in Feldbach
Der Patron, der Schutzheilige der Pfarre Feldbach, ist der heilige
(hl.) Leonhard, der im 6. Jahrhundert als Einsiedler im heutigen
Zentralfrankreich lebte. Aufgrund seines Patronats ist er in der Kirche
im Zentrum des Hochaltares zu finden. Doch warum wird ein Franzose als
Beschützer einer südoststeirischen Pfarre verehrt? Das ist ganz einfach
zu erklären: Im Mittelalter war die Wallfahrt zum hl. Apostel Jakobus
dem Älteren nach Santiago de Compostela trotz größter Strapazen sehr
beliebt. Da der Jakobsweg an der Grabeskirche des hl. Leonhard in
St-Léonard-de-Noblat bei Limoges vorbeiführte, „brachten" die Pilger
diesen Heiligen „mit" in ihre Heimat. So wurde Leonhard auch in unserem
Land bekannt. Es gibt noch ein weiteres interessantes Detail zur
Verehrung dieses heiligen Mannes: Leonhard wird mit einer zerbrochenen
Kette dargestellt. Diese weist darauf hin, dass er sich in besonderer
Weise für die Befreiung von Gefangenen einsetzte. Die ursprüngliche
Bedeutung der Kette ging im Laufe der Jahrhunderte verloren, und so
wurde sie von vielen als Viehkette interpretiert. Deshalb wurde aus dem
Patron der Gefangenen der Schutzheilige des Viehs. Es ist nun auch
verständlich, warum der Heilige aus Frankreich gerade im ländlichen
Raum hochverehrt wurde und wird. Noch ein letzter wichtiger Hinweis:
Unsere Statue des hl. Leonhard weist mit der rechten Hand nach unten
zum Tabernakel. Im Tabernakel wird das Heiligste aufbewahrt, die hl.
Kommunion Jesus ist da im verwandelten Brot. Es ist, als wolle Leonhard
unsere Aufmerksamkeit auf diesen kostbaren Schatz lenken.
Vier Heilige stehen am Hochaltar dem Einsiedler und Abt Leonhard zur
Seite. Links und rechts von ihm sehen wir die Apostel Petrus und
Paulus. Simon Petrus gehörte zu den Erstberufenen Jesu, wurde von ihm
zum Felsen (griechisch petra/petros) der Kirche bestimmt und war später
der erste Bischof von Rom und damit der erste Papst. Paulus verfolgte
zunächst die ersten Christengemeinden, wurde aber nach seiner Bekehrung
zum großen Völkerapostel für Jesus Christus. Die Gräber der beiden
Glaubenszeugen der Urkirche befinden sich in Rom. Die Heiligen links
und rechts außen sind Josef und Anna. Der hl. Josef war der Bräutigam
Marias und der Adoptivvater Jesu und wird deshalb mit dem Jesuskind
dargestellt. Die hl. Anna war die Mutter Marias, also die Großmutter
Jesu, und wird uns mit ihrem Kind, der kleinen Maria, gezeigt. Anna
begegnet uns gleich an mehreren Orten in unserer Kirche, das auf ihre
besondere Verehrung in der Südoststeiermark weist; denken wir nur an
ihr Heiligtum in St. Anna/Aigen und die Annakapelle am Feldbacher
Kalvarienberg.
Überragt wird der Hochaltar, der seinen Platz 1907 in der Kirche fand,
vom sogenannten Gnadenstuhl. Es ist eine Darstellung des dreieinigen
Gottes mit Gott-Vater, der seinen gekreuzigten Sohn in den Armen hält;
die Taube, das Symbol für den Hl. Geist, schwebt über den beiden.
Jesus, der Sohn Gottes und ganz Liebende, geht den Weg der Liebe bis
zum Ende, bis zum Kreuz und besiegt damit für uns den Tod, den Bösen
und die Sünden der Welt. Das ist Gnade - „Gnadenstuhl".
Der auferstandene König der Liebe
Bruder Lukas Reicht malte zwischen 1946 und 1947 neben dem „geöffneten
Himmel" auch das beeindruckende Bild an der Westseite des Altarraumes
und die drei Szenen am Triumphbogen. Verweilen wir zuerst beim Gemälde
über dem Hochaltar. Der auferstandene Jesus zeigt sich uns mit seinem
Herzen und einer goldenen Krone. Jesu Liebe will das Kostbarste für die
Menschen sein: Das Herz steht für seine unendliche Liebe, die Krone für
die Kostbarkeit dieser Liebe.
Umgeben wird der König der Liebe von Engeln und vier
Auferstehungszeugen. Auf der linken Seite sehen wir zuerst Petrus. Als
erster der Apostel durfte er Jesus, den Auferstandenen, sehen. Neben
ihm kniet Maria Magdalena. Sie ist die allererste Zeugin des
auferstandenen Herrn und die erste Verkünderin dieser frohen Botschaft.
Rechts außen können wir Paulus erkennen. Er gehörte ursprünglich nicht
zu den Aposteln, sondern zu den Christenverfolgern. Bei einer
„Christenjagd" erschien ihm vor Damaskus Jesus, der Auferstandene. Er
änderte sein Leben, wurde selbst zum Apostel für Christus und musste
die eigene Verfolgung kennenlernen. Neben Paulus finden wir den
knienden Johannes, der einzige Apostel, der Jesus bis unter das Kreuz
folgte. Er begleitete Petrus zum leeren Grab.

Himmel und Erde berühren sich
Am 22. Oktober 2000 zum Jubiläum „100 Jahre Stadtpfarrkirche" - feierte
Diözesanbischof Dr. Johann Weber mit der Gottesdienstgemeinde die
Altarweihe und den Abschluss der Innenrenovierung der Kirche. Für das
Projekt „Renovierung und Neugestaltung" zeichnete Dechant Johann
Leopold verantwortlich. Der Entwurf des neuen Altarraumes stammte von
Prof. Erwin Talker. Am Fußboden finden sich drei Kreise und drei Farben
Blau (Glaube), Grün (Hoffnung) und Rot (Liebe). Auch bei Altar und Ambo
- beide aus ungarischem, rotem Marmor - begegnet uns die Zahl Drei.
Dieser Ort ist in besonderer Weise dem dreifaltigen Gott geweiht. Hier
wird in jeder hl. Messe Tod und Auferstehung des Sohnes Gottes durch
das Wirken des Hl. Geistes in die Gegenwart geholt. Zuerst dürfen sich
die Mitfeiernden am Tisch des Wortes (Ambo) durch Gottes Wort stärken
lassen. Danach wird ihnen die am Tisch des Brotes (Altar) verwandelte
Gabe zur Stärkung und Vereinigung gereicht. Diese Gabe ist Jesus
selbst: „Das ist mein Leib." (Markus 14,22)
Wenn Jesus, unser Herr und Freund, wirklich gegenwärtig ist, dann ist
der „Himmel offen". Darauf will auch das Deckengemälde, das vom
Seckauer Mönch Lukas Reicht stammt, hinweisen. Der Himmel ist offen,
und so sehen wir ganz zentral den Hl. Geist, der von vielen Engeln mit
Weihrauchfässern und Musikinstrumenten umgeben ist. Bei genauem Schauen
entdecken wir auch die vier lateinischen Kirchenväter, berühmte
Theologen des christlichen Altertums: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus
und Gregor der Große.

Auf der gegenüberliegenden Seite hinten finden wir das „Feldbacher
Lourdes". Am 11. Februar 1858 erschien Maria dem vierzehnjährigen
Mädchen Bernadette (1844-1879) zum ersten Mal in der Grotte von
Lourdes. Es folgten noch 17 weitere Erscheinungen. Gerade durch die
Quelle, die Bernadette auf Geheiß von Maria mit ihren bloßen Händen
freilegte, und deren Wasser auch heilende Wirkung zeigte, wurde Lourdes
sehr bald zum Wallfahrtsort der Kranken. So ist es bis heute geblieben.
Da es vielen Gläubigen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht
möglich war, nach Lourdes zu pilgern, kam es in Kirchen und Kapellen
zum Nachbau der Grotte, auch hier in Feldbach. Wir sehen Maria, die
sich bei einer der Erscheinungen „Unbefleckte Empfängnis" nannte, und
die davor betende Bernadette. Diese wurde später Ordensfrau und starb
bereits in jungen Jahren an einer langen, schweren Krankheit.

Auf dem Weg zur Taufkapelle begegnen uns „alte Bekannte": die hl. Anna
mit der kleinen Maria, der hl. Leonhard und der hl. Josef. Zum ersten
Mal aber sehen wir eine weitere französische Heilige - die Karmelitin
Theresia von Lisieux (1873-1896). In der Kapelle selbst erwartet uns in
der Mitte der Taufstein. Bei der Innenrenovierung der Kirche im Jahr
2000 wurde eine Taufkapelle errichtet. Prof. Erwin Talker wollte neben
der Dreiheit des Altares und des Ambos auch beim Taufbecken auf den
dreieinigen Gott hinweisen. Hier werden Menschen, meist Kinder, im
Namen des dreieinigen Gottes getauft. Das dabei verwendete Wasser weist
auf Leben hin, auf das Leben, das Gott schenkt. Eltern schenken ihren
Kindern kostbares, doch vergängliches Leben. Gott schenkt uns ewiges
Leben, das bereits in der Taufe grundgelegt wird. So sind die Getauften
Kinder Gottes und gehören zur großen Familie Gottes. Der Beichtstuhl,
den Sie außerhalb des Taufortes sehen, hat, bildlich ausgedrückt, auch
mit Wasser zu tun. Es ist der Ort der „Reinigung" von Sünden.

Wenn wir die „neue Kirche" beim Ausgang in der Nähe des Beichtstuhls
verlassen, gelangen wir direkt in eine kleine gotische Kirche. Diese
ist ein Teil (Hauptschiff) der alten Kirche, also der,Mutter-Kirche".
Sie ist ja wegen des Baus des neuen Gotteshauses teilweise abgetragen
worden. Der Ursprung dieser Kirche liegt im 12. Jahrhundert; erstmals
wurde sie 1188 genannt. Gerade in dieser Zeit brachten die Jakobspilger
auch die Verehrung des hl. Leonhard in unsere Heimat (deshalb auch
Patron der Pfarre Feldbach). Anziehungspunkt dieses geistlichen Ortes
ist eine beeindruckende Kreuzigungsgruppe, die dem Bildhauer Veit
Königer (18. Jahrhundert) zugeschrieben wird.
Seit 1954 ist die Mutter-Kirche dem Österreichischen Kameradschaftsbund
Stadtverband Feldbach anvertraut. Sie dient als Stätte des
Gedächtnisses für die in beiden Weltkriegen umgekommenen Soldaten und
Zivilpersonen der Pfarre. Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre
Gedächtniskirche" im Jahr 2014 wurde unter Obmann Ökonomie-Rat Karl
Buchgraber die ,,alte Kirche" generalsaniert.
Die nun folgende Seitenkapelle beherbergt ein großes Kreuz, DAS Zeichen
des Christentums. Hier begegnet uns die Liebe des Sohnes Gottes, die
bis zum qualvollen Tod am Kreuz ging, und so zur gekreuzigten Liebe für
die Menschheit wurde. Eigentlich ist es ein Missionskreuz. Wir sehen am
Kreuz Schilder, die darauf hinweisen, wann es in der Pfarre Feldbach
sogenannte Missionen gab. Diese dienten der Pfarrbevölkerung zur
Verkündigung und Vertiefung des christlichen Glaubens und dauerten
jeweils einige Wochen. Die Verkündigung des gekreuzigten und
auferstandenen Herrn ist zu jeder Zeit von besonderer Bedeutung. Seit
seiner Seligsprechung im Jahr 2011 befindet sich hier auch das Bild des
hl. Johannes Paul II., des großen Papstes des 20. Jahrhunderts. Trotz
des schweren Weges des Kreuzes, den auch er kennenlernte, strahlte er
christliche Hoffnung und Freude aus.

Der bunteste Kirchturm als Zeichen für ein Miteinander Leben in Vielfalt
Am 8. Mai 1945, also am letzten Tag des Zweiten Weltkrieges, erfolgte
die mutwillige Sprengung des Turms der in den Jahren 1898-1900
errichteten Pfarrkirche. Lediglich das Fundament an der Ecke
Pfarrkirche/Gedächtniskirche ist erhalten geblieben. Viele Jahre lang
befand sich auf dem Tabor-Platz ein Provisorium in Form eines hölzernen
Glockenstuhls. 1961 wurde der Bau des heutigen kampanileartigen
Kirchturms aus Beton nach einem Entwurf von Arch. Eberhardt Jäger in
die Wege geleitet. Errichtet wurde er schließlich in nur 26 Tagen im
sogenannten „Gleitschalsystem", wobei ununterbrochen Tag und Nacht
gearbeitet werden musste. Aufgrund dieser damals neuen Technik gibt es
keine Fugen, die Oberfläche ist vollkommen glatt. Die Turmuhr war
damals die größte in Österreich. Die Weihe des neuen, 72 Meter hohen,
zunächst schmucklosen Kirchturms mit Stahlkrone erfolgte 1964. Seit dem
Gedenk- und Jubiläumsjahr 2015 erklingt ein fünfstimmiges
Glockengeläute vom Feldbacher Kirchturm: Christus- Friedensglocke
(2.588 kg), Marienglocke (1.493 kg), Leonhardglocke (731 kg),
ÖKB-Gedächtnisglocke aus dem Jahr 1955 (469 kg) und Josefsglocke (313
kg).
Die charakteristische, bunte Bemalung erhielt der Kirchturm 1987 nach
dem Entwurf des Künstlers Gustav Troger. Diese stand unter dem Motto
„Viele Farben - ein Turm, viele Menschen - eine Pfarre", sie wurde von
Jugendlichen aus der Pfarre durchgeführt. Mehrere tausend Farbfelder
mit 38 verschiedenen Farben bilden eine Einheit. Damit steht der
Kirchturm als Symbol für ein Miteinander Leben in Vielfalt und einen
respektvollen Umgang in der Gemeinschaft keiner wird ausgestoßen,
keiner ist mehr wert und jeder ist für das große Ganze notwendig.
Derart etablierte er sich als weiteres Wahrzeichen der Stadt Feldbach.

Das Heimat. Museum der Stadt Feldbach befindet sich im Tabor, der gegen
Ende des 15. Jahrhunderts als Schutzburg für die Bevölkerung errichtet
wurde. Als kleines Universalmuseum beherbergt es verschiedene
Sammlungen, die das Leben in der Südoststeiermark von der Steinzeit bis
in die jüngste Vergangenheit darstellen. Eine Vielzahl von besonderen
Exponaten, wie der Nagelmann, die historische Schulklasse, eine Ölkuh
oder eine alte Schusterwerkstätte, laden zum längeren Verweilen ein und
machen den Besuch zu einem Erlebnis.
Entdecken Sie, was eine bäuerliche Familie früher gegessen hat. Wie
haben die Menschen gekocht? Welche Fische lebten in der Raab? Und
erwandern Sie das Heimat. Museum treppauf, treppab
SAMMLUNGEN: Volkskunde, Handwerk und Gewerbe, Geologie und Mineralogie,
Archäologie, Bildung und Kultur, Stadtgeschichte, Zeitgeschichte,
Fischereimuseum, Schneidereimuseum und Feuerwehrmuseum.

WEITERVERARBEITUNG: MEHL, SCHROT & ÖL
Tierische und menschliche Muskel- sowie Wasserkraft stellten bis zur
Elektrifizierung der Südoststeiermark die einzige Antriebsmöglichkeit
zur Weiterverarbeitung der Rohstoffe dar. Dies zeigt auch die Sammlung
der vorliegenden Mühlen, Anken und Wasserstampfen aus der Zeit um 1950.
Diese Werkzeuge waren im Wesentlichen seit Beginn der Neuzeit in dieser
Form im Einsatz, bis sie durch moderne Maschinen ersetzt wurden. Die
Vermahlung des Getreides und das Pressen von Ölen (aus Kürbiskernen,
Raps oder Lein und spezielle Öle etwa aus Nuss oder Mohn) erfolgte
schon lange von Mühlen an Mur und Raab sowie an deren Zuflüssen.
Darüber hinaus hatten viele Bauern Geräte zum Handbetrieb auf ihren
Höfen: Etwa Greissstöcke, mit denen Buchweizen (Heiden) und Hirse
enthülst, oder Handmühlen, mit denen kleinere Mengen Mehl gemahlen
werden konnten. Mit den Reblern wurden per Hand die Körner von den
Maiskolben gebrochen, danach in kleinen Mengen zu Hause oder in
größeren Quantitäten in den Mühlen verschrotet. Polenta („Sterz“,
„Tommerl") oder Hirsebrein (auch Zutat für die Wurstherstellung)
bildeten die Hauptnahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung. Erdäpfel
standen erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Speiseplan.

HANDWERK
Die Südoststeiermark war wie die meisten ländlichen Regionen
Österreichs bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von lokalen
Handwerkern geprägt. Ihre Handelsziele beschränkten sich auf die nahe
gelegenen Regionalzentren, nur selten in die Städte Graz oder
Maribor/Marburg sowie nach Ungarn. Schneider, Sattler, Seiler, Schuster
und Lederer sowie Wagner, Fassbinder, Schmiede und Schlosser versorgten
die Region mit den wichtigsten Bedarfsgütern. Durch die 1859 erlassene
Gewerbeverordnung, die das überholte Zunftwesen beendete, erfuhr das
Handwerk eine neuerliche Blüte. Besonders die Wagner und Schmiede waren
für den Fuhrwerksverkehr an der Handelsroute durch das Raabtal nach
Ungarn wichtig. Ihre Bedeutung wurde erst durch das Aufkommen der
Eisenbahn eingeschränkt, später durch die überregionale Versorgung mit
Massenkonsumgütern fast vollständig zurückgedrängt. Die Eisenbahn
eröffnete vielen Handwerksbetrieben neue Bezugsquellen für
Betriebsmittel und Rohstoffe sowie Exportmöglichkeiten für ihre Waren.
Heute findet man diese Handwerke nur noch in Kleinstbetrieben, die sich
auf hochqualitative Maßanfertigungen oder Reparaturen spezialisiert
haben.

Gegen Ende des stürmischen 15. Jahrhunderts, wohl aus unmittelbarem
Anlass der Zerstörungen durch Andreas Baumkircher, wurde der Feldbacher
Tabor als quadratische befestigte Häuseranlage im Bereich der
Pfarrkirche errichtet. In Ermangelung einer Stadtbefestigung bot er
Zuflucht für die Bevölkerung, wozu weitere Verstärkungen, Wassergräben
und Palisaden beitrugen. Unrühmliche Berühmtheit erlangte der Tabor als
Verwahrungsort der rund 100 Beschuldigten während der Feldbacher
Hexenprozesse 1673-75. In den 1870er Jahren wurde der östliche Teil
wegen der Errichtung der Franz-Josef-Straße, vom Hauptplatz in Richtung
des neuen Bahnhofs führend, abgetragen, der Rest gilt im Vergleich mit
anderen Anlagen als gut erhalten.

Im Jahr 1952 richteten Leopoldine Thaller und Anna Gamerith ein erstes
Museum ein. In der Folge erweiterte sich die Sammlung stetig. Heute
gibt es im Großteil der erhalten gebliebenen Gebäude in 41 Räumen das
Heimat.Museum im Tabor, welches das Leben in der Südoststeiermark von
der Steinzeit bis in die jüngste Vergangenheit darstellt. Es bestehen
die Abteilungen Volkskunde, Handwerk und Gewerbe, Geologie und
Mineralogie, Archäologie, Bildung und Kultur, Stadtgeschichte,
Zeitgeschichte, Fischerei, Schneiderei und Feuerwehr.

BURGEN & SCHLÖSSER
Nach der Erhebung der Steiermark zum Herzogtum 1180 (Markgraf Otakar
IV.) begann in der Südoststeiermark der Ausbau von Burgen und
Wehranlagen. Auf diese Bauphase weisen viele Ortsbezeichnungen hin, wie
etwa Hausberg, Hauskogel, Schlössl, Schlossriegel, Burgstall, Burg oder
Wart(h). Bestehende Befestigungsanlagen wurden hierbei ausgebaut oder
neue gegründet: etwa Schloß Achaim in Rohr/Raab, am Kuruzzenkogel in
Burgfeld bei Fehring oder die Burg der Zebinger am Jungberg bei
Obergnas. Die Turmburg Alt Gleichenberg spielte in der Landesgeschichte
eine besondere Rolle, denn sie musste nach der Verschwörung des
Steirischen Adels auf Anordnung des Böhmenkönigs Ottokar II. (Přemysl)
neben anderen wichtigen Burgen des Landes geschleift werden. Ab dem
späten 15. Jahrhundert erfolgte aufgrund von inneren Unruhen sowie
Einfällen von außen („Kuruzzen" und Osmanen) der Bau von Taboranlagen.
Die bekanntesten und heute noch sichtbaren Bauten entstanden in
Fehring, Straden, Kirchberg oder Feldbach. Oberflächenfunde aus dem 14.
und 15. Jahrhundert geben einen Einblick in das alltägliche Leben um
diese Befestigungsanlagen herum.
Ein Säbel mit arabischer Aufschrift - der später von einem Bauern in
Risola einer friedlichen Verwendung zugeführt wurde - ist ein beredtes
Zeugnis für die Kämpfe zwischen dem Osmanischen Reich und den
Habsburgern. Zwischen Mogersdorf und Sankt Gotthart fand eine der
entscheidenden Schlachten des 4. Österreichischen Türkenkrieges 1663/64
statt. Zum Festungsgürtel kamen in der Neuzeit noch Schlösser wie jene
in Hainfeld oder Hohenbrugg an der Raab hinzu. Sie dienten neben der
Landesverteidigung vorwiegend der Verwaltung oder dem Landaufenthalt
des Adels.

Frühe Burgen in der Oststeiermark
Als Folge der zweiten deutschen Landnahme und der Ausbildung von
Territorialherrschaften und örtlicher Gewalten entstanden im
Mittelalter in der Oststeiermark zahlreiche Burgen unterschiedlicher
Größe. Viele von ihnen sind scheinbar spurlos verschwunden, andere sind
nur in spärlichen Resten als Ruinen vorhanden, manche wurden durch
viele Umbauten verändert. Nur einige lassen ihre ursprüngliche Form
noch heute erkennen. So sind aus der Blütezeit kaum Burganlagen in
ursprünglichem Zustand erhalten.
Chronologie:
9. bis 10. Jahrhundert - Holzburgen
An der Wende des 9. Jh. errichtete man bereits Holzburgen. Davon zeugen
heute noch die Erdaufschüttungen einzelner Turmhügelburgen.
11. Jahrhundert - Erste Steinburgen
In der Steiermark entstanden mehrere Steinburgen. Es waren vielfach
Wohn- und Wehrtürme zur Straßen-, Brücken- und Talsicherung. Der
mächtige Wehrbau von Kapfenstein wird 1065 erstmals genannt.
12. Jahrhundert - Felsenburgen
Sie wurden auf schwer zugänglichen Felsgipfeln erbaut. Es sind anfangs
wehrhafte Wohntürme mit Kapelle und Ringmauerwerk, die bald durch
eigene Wehrtürme (Bergfried) und gesicherte Wohnbauten (Palas)
erweitert wurden. Typische Beispiele dafür sind die Riegersburg, die
einstige Burg „Alt Gleichenberg" („Meixnerstube") und Bertholdstein
(die Burg der Emmerberger) in Pertlstein von 1170.
13. Jahrhundert - Ritterburgen
Noch vor 1250 begann man die Burgen gegen die bei den Angriffen aus dem
Osten verwendeten Bogenwaffen, Armbrust und Brandpfeile, zu sichern.
Vorgeschobene Türme, Wehrgänge an den Ringmauern und zwingergesicherte
Anlagen entstanden, möglichst von Waldhängen abgesetzt. Der Wehrbau
entwickelte sich zur klassischen Ritterburg. Die „Burg Hagegk" am
Greinerkogel in Tagensdorf wird 1273 durch die Nennung von Ulrich
Hagecker erwähnt. Die Turmburg („Das versunkene Schloss") am Hauskahr
in Pöllau bei Paldau entstand 1247 unter dem Geschlecht der Zebinger.
Im Jahre 1275 wird der Wehrbau Hainfeld (Wasserschloss) in Leitersdorf
erstmals als bescheidener Edelsitz der Hainfelder genannt. Im 13.
Jahrhundert entstand auch der Wehrbau Acheim in der KG Rohr. Ein
beachtlicher Vierflügelbau mit Türmen wurde unter dem Geschlecht der
Walseer erbaut. Während der Habsburgerzeit wechselten viele Burgen ihre
Besitzer. König Ottokar ließ einige steirische Burgen schleifen,
darunter auch „Alt Gleichenberg".
14. Jahrhundert - Zwingerburgen
Aus den einfachen Burgbauten entwickelten sich in gotischer Zeit
Abschnittsburgen mit Zwingern, Höfen, Wehrtürmen, Torbauten und zum
Teil ausgedehnten Vorburgen. Burgen sind jetzt nicht mehr nur Straßen-
und Talsicherungen, sondern Herrschaftsmittelpunkte. Das
österreichische Landrecht von 1300 regelt den Burgbau bis in
Einzelheiten. Zu Beginn des 14. Jh. begann Ulrich von Walsee gegenüber
den Resten der alten Burg Gleichenberg („Meixnerstube") mit dem Bau der
Burg Neu-Gleichenberg. Die Burg Glojach am Ochsenhalt wird 1305 mit
Leopold von Glojach erstmals genannt.
15. Jahrhundert - Herrschaftsburgen
Man versucht in der Zeit der Spätgotik (1400 bis 1530) die Burgen durch
Vorwerke und Verstärkung der Mauern gegen die aufkommenden Feuerwaffen
zu schützen. Die Burg der Zebinger am Jungberg in Obergnas wird 1423
„Purgstall" genannt. Herzog Ernst belagerte im Jahre 1412 die
Riegersburg.

EIGENPRODUKTION & HANDEL
In Gemeinschaftseinrichtungen der Bauern wie der „Brechelhütte" (zum
Brechen der Flachsrispen) oder der „Haarstube" (zur Bearbeitung von
Flachs) wurden die Rohstoffe (Flachs und Wolle) weiterverarbeitet. Die
Webstühle der Weber sowie die in fast allen Haushalten stehenden
Spinnräder waren die Werkzeuge für den nächsten Arbeitsschritt. Dies
spiegelt die typische regionale Selbstversorgung wider: Leinen, Wolle,
Leder und Felle blieben lange die wichtigsten Grundwaren für die
Bekleidung.
Gehandelt wurden meist nur Luxusprodukte: Mitte des 14. Jahrhunderts
gab ein Kaufmann aus Feldbach etwa bei einem Geschäftsabschluss neben
Geld auch sechs Ellen Löwener/Leuvener Tuch an. Eine Ware, die selbst
im europäischen Handel als wertvoll galt. Lokale Handelsbeziehungen für
teure Stoffe reichten bis Marburg/Maribor. Erst die industrielle
Revolution ab dem Ende des 18. Jahrhunderts in Europa und die
Beschleunigung des Transportes durch die Eisenbahn erhöhten die
Produktionsmenge von Stoffen. Diese konnten sich nun nicht nur Adelige,
reiche Bürger und Großbauern, sondern auch einfachere Leute leisten.
Der Blaudruck eroberte auch die Kleidertruhen der Bauern. Das führte zu
einer radikalen Änderung der Bekleidung der ländlichen Bevölkerung
innerhalb relativ kurzer Zeit.

Hallstattzeitliches Hügelgrab vom Gniebinger Hügelgräberfeld, Grabhügel M, Zentralbestattung

Münzen - das römische Geld
Römische Münzen sind in vieler Hinsicht aussagekräftige Fundstücke. Sie
stellen einen wichtigen Datierungsanhaltspunkt dar, da sie erst nach
ihrer Prägung in die Erde gelangt sein können und so einen
frühestmöglichen Zeitpunkt zur Datierung von Schichten,
Grubenverfüllungen oder auch Gräbern angeben (terminus post quem). Auch
geben sie Auskunft über wirtschaftliche Verhältnisse und spiegeln gut
politische Ereignisse wider (z. B. Kriege), die Auswirkungen auf das
Wirtschaftsleben mit sich brachten. Fundmünzen aus Siedlungen stellen
in der Regel zufällige Verlustfunde dar, die die Dauer und Dichte des
Geldverkehrs wiedergeben.
Römische Münzen zeigen auf ihrer Vorderseite ein Porträt des Kaisers
oder eines Angehörigen des Kaiserhauses, sie geben in Beischriften
(Legende) ihre offiziellen Namen und Titel, die Dauer ihrer
Regierungszeit und das Prägejahr an. Die Rückseite schmücken zumeist
Darstellungen von Göttern und Göttinen.
Bereits seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. war die römische Münze zur
Weltwährung geworden. Während bis an die Zeitenwende der Silberdenar
die wichtigste Münze darstellte, begann unter Kaiser Augustus (27 v. –
14 n. Chr.) auch erstmals die Prägung von Bronze- und Kupfermünzen. Dem
Kaiser oblag hierbei die Ausmünzung von Gold- und Silberprägungen, der
Senat war für die „niederwertigen" Prägungen aus Buntmetall
verantwortlich.
Die von Augustus eingeführten Nominale hielten sich bis ins 3. Jh. n. Chr.:
1 Aureus (Gold) = 25 Denare (Silber)
1 Denar = 4 Sesterzen (Messing/Bronze)
1 Sesterz = 2 Dupondien (Messing/Bronze)
1 Dupondius = 2 Asse (Kupfer)
Unter Kaiser Caracalla wird mit dem sog. Antoninian (Doppeldenar) ein
Nominal geprägt, das schließlich zum Hauptzahlungsmittel wird und den
Denar verdrängt. Der Silbergehalt der Antoniniane beträgt auf Grund der
enormen Inflation stark ab am Ende des 3. Jhs. nur mehr wenige
Prozente! 294 n. Chr. wird er von Kaiser Diocletian durch den Follis
ersetzt, einer Bronzemünze, die nur mehr einen Überzug aus Silber
hatte. Die Inflation bewirkte wieder einen rapiden Gewichtsverlust, so
dass unter Constantius II. 346 n. Chr. zwei weitere Bronzenominale
eingeführt wurden (Maiorina und Centenionalis), die den Follis rasch
verdrängten. Der geringe Anteil an Edelmetall in den Münzen des 3. und
4. Jhs. bewirkte, dass wesentlich ältere hochwertigere Münzen noch
länger in Umlauf waren.
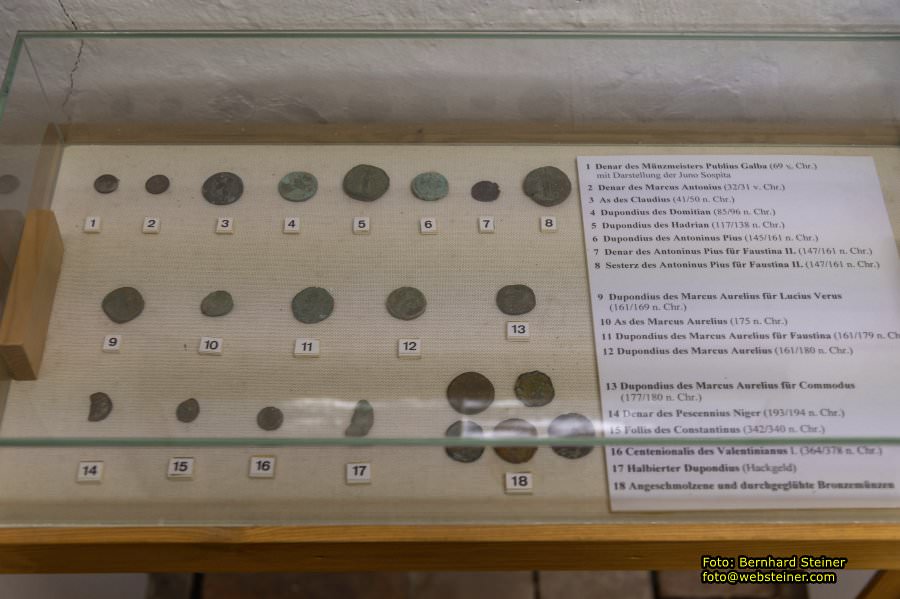
Die Fundmünzen vom Saazkogel
Die zahlreichen Funde römischer Münzen auf dem Saazkogel geben ein
gutes Zeugnis für die Entwicklung und die existenz eines
differenzierten Wirtschaftslebens zur Römerzeit ab. Das gesamte
Münzmaterial umfasst 62 Einzelfunde, deren Prägedaten sich von 69 v.
Chr. bis ca. 395 n. Chr. erstrecken. Eine Häufung tritt dabei zwischen
69 und 168/169 n. Chr. auf. Der Großteil der Münzen stammt aus den den
archäologischen Grabungen im Vicus am Südhang des Saazkogels, wenige
Stücke von der Grabung am Gipfel neben der Laurentiuskirche, der Rest
besteht aus Oberflächenaufsammlungen mittels Metalldetektor.
Die frühesten Münzen sind zwei römisch-republikanische Stücke des
ersten vorchristlichen Jhs., ein Legions-Denar des Marcus Antonius von
32/31 v. Chr. und ein Denar des Jahres 69 v. Chr. Beide Münzen weisen
stärkere Abnutzungserscheinungen auf, da sie vermutlich noch bis an den
Beginn des 2. Jhs. n. Chr. in Umlauf waren.
Münzen ab flavischer Zeit treten in einem relativ regelmäßigem
Verlustspektrum auf. Man wird also ab dem letzten Viertel des 1. Jhs.
n. Chr. von einem regelmäßigen römischen Geldverkehr vor Ort sprechen
dürfen., da ab dieser Zeit alle für die täglichen Geschäfte relevanten
Buntmetall-Nominalien vorhanden sind. Mit Hadrian (117-138 n. Chr.)
beginnt das Fundniveau stark anzusteigen und erreicht gleichzeitig auch
seinen höchsten Stand. Die Zusammensetzung der Nominalien wird immer
unterschiedlicher, zu Buntmetallmünzen treten vereinzelt Siberdenare.
Dies kann vermutlich auf ein ausgeprägtes und gut entwickeltes
Wirtschaftsleben im Vicus bezogen werden.
Nach 169 n. Chr. bricht die Zufuhr neuer Münzen weitgehend ab, d. h.
der Geldbedarf vor Ort ist auf Grund äußerer Umstände zurück gegangen.
Zeitlich deckt sich dieser Vorgang mit jenem der historischen
Überlieferung zu den Markomannenkriegen. Vielleicht könnte man einen
unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Versiegen des Geldzustroms und
dem wirtschaftlichen Niedergang des Vicus als Folge der
Kriegsereignisse herstellen. Die Präsenz der wenigen Einzelstücke nach
192 n. Chr. ist sicher nicht mehr mit regelmäßigem Geldverkehr vor Ort
erklärbar. Aus der Zeit nach 180 n. Chr. liegen nur mehr zwei Denare
vor, sowie insgesamt fünf Prägungen aus dem 4. Jh. n. Chr. Dabei
handelt es sich um zwei Folles von 313 und 324/340 n. Chr., zwei
Maiorinen und einen Centenionalis der valentinischen Zeit. Das 3. Jh.
n. Chr., das in den meisten vergleichbaren römerzeitlichen Siedlungen
an sich am stärksten ausgeprägt ist, ist am Saazkogel - wie auch im
benachbarten Vicus von Gleisdorf - nicht vertreten.

Wegen der Fülle der Bestände kann man von einem kleinen Universalmuseum
sprechen. Dazu kommen immer wieder Sonderausstellungen. Im sog.
„Sparkassensaal im Tabor” finden Veranstaltungen statt, und es wurde
dort jüngst eine neue Darstellung der Stadtgeschichte, die bis in die
2020er Jahre hineinreicht, eingerichtet. Ein großer Teil der Gebäude
ist heute im Besitz der Stadtgemeinde Feldbach, welche diese auch
erhält. Die Betreuung der Sammlung erfolgte viele Jahre lang durch den
Südoststeirischen Verein für Heimatkunde.

Herren-Schneiderwerkstätte um 1940

„KRIEGER" IN GEFANGENSCHAFT
Im Bewegungskrieg in Ost- und Südosteuropa geraten zwischen 1914 und
1917 Millionen Soldaten in Gefangenschaft. Allein 2,1 Millionen
Angehörige der Habsburgerarmee fallen in russische Hand, umgekehrt
befinden sich rund 3 Millionen Angehörige der Zarenarmee in Lagern
Österreich-Ungarns und Deutschlands. Sie alle müssen nach den
völkerrechtlichen Vereinbarungen behandelt werden. Anfänglich sind alle
Heeresverwaltungen mit der übergroßen Zahl der zu Versorgenden
überfordert, Vorbereitungen gibt es keine. Überall wird improvisiert;
Lebensmittel, Heizstoffe oder sanitäre Anlagen fehlen - teilweise mit
verheerenden Folgen. Rasch werden die Gefangenen der 1915 erst richtig
anlaufenden Kriegswirtschaft zugeführt.
Im Herbst 1914 wird auch in der Steiermark fieberhaft nach geeigneten
Unterbringungsorten für Gefangene gesucht. Feldbach wird aufgrund
seiner günstigen Lage und des Eisenbahnanschlusses ausgewählt. Noch vor
dem Jahreswechsel 1914/15 beginnt der Bau eines Lagers östlich von
Feldbach. Anfänglich fürchtet man in der Bevölkerung Seuchen, die
Gefangenen werden als Gefahr für die Sicherheit und die Versorgung
gesehen. Bald aber entdeckt man die Möglichkeiten: Auf dem riesigen
Lagerareal können sichere Pachteinkünfte gewonnen werden, die
Gefangenen arbeiten am Ausbau der Infrastruktur. Umgekehrt finden auch
Zivilisten in den Werkstätten oder als Wachmannschaft Beschäftigung.

TIERISCHE RÜCKKEHRER UND EINWANDERER AN DER RAAB
Die Tierwelt hat sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder
verändert. Es ist Teil der Evolution, dass Tiere neue Lebensräume
besiedeln. In jüngster Zeit verändern Eingriffe des Menschen aber Flora
und Fauna besonders intensiv. Dies führt zur Verdrängung bis hin zur
vollständigen Ausrottung, oder auch zur Verbreitung von Tieren in für
sie fremden Lebensräumen. Manche neue Arten wurden absichtlich zur
Nutzung eingeführt, einige sind ungewollt entkommen und verwildern.
Als Neozoen werden jene
Tierarten bezeichnet, die in einem bestimmten Gebiet nicht heimisch
sind und erst nach 1492 - also der Entdeckung Amerikas – unter direkter
oder indirekter Mithilfe des Menschen in dieses Gebiet gelangt sind.
Eine neue Tierart gilt als etabliert, wenn sie über einen Zeitraum von
mindestens 25 Jahren oder über drei Generationen hinweg freilebend
existiert. Als invasiv werden jene Neubürger bezeichnet, die heimische
Tierarten verdrängen oder ihren Lebensraum verändern. In Österreich
sind über 500 Neozoen bekannt, davon gelten 300 Arten als etabliert.
Nur etwa zehn Prozent dieser Arten stellen aus naturschutzfachlicher
Sicht eine Bedrohung für die heimische Artenvielfalt dar. Etwa 30
Prozent der Neozoen führen zu negativen wirtschaftlichen Konsequenzen.
Dank verschiedener Maßnahmen zum Schutze von natürlichen Lebensräumen
kommt es vermehrt in den letzten Jahrzehnten zur Rückwanderung von
eigentlich bereits verdrängten, heimischen Tierarten. Auch
geopolitische Veränderungen, wie etwa der Fall des „Eisernen
Vorhanges", können tierische Bewegungsräume wieder öffnen. Auch wenn
die Rückkehr dieser Tiere grundsätzlich erfreulich ist, kommt es
aufgrund gewisser wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen
teilweise zu Konflikten.

Im Schaufenster kann nicht alles sein! Bitte, treten Sie zwanglos in den Laden ein!

Schuster bleib bei deinen Leisten!


Die Raab entspringt in 1200 m Seehöhe auf der Passailer Alpe, einem
Teil der Teichalpe, deren höchste Erhebung der Osser ist (1549 m). Die
Wässer, die vom Nord- und Westhang des Osser abfließen, gehören dem
Flußgebiet der Mur an, die zahlreichen Quellen des Ost- und Südhanges
bilden die Raab. Die Raab durchfließt als Gebirgsbach den Raabgraben,
des Passailer Becken und die Raabklamm in einer Länge von ca. 25 km.
Nach der Einmündung des Raabnitzbaches wird der Fluß bei Gleisdorf ein
ruhig dahinfließendes Gewässer, von mitgeführtem Lehm oft dunkelbraun
gefärbt. Von der dunklen Farbe ihres Wassers hat die Raab
wahrscheinlich auch den Namen bekommen. Bis zur Bundesgrenze münden 49
kleinere Seitenbäche und bei St. Gotthard fließt die 110 km lange
Lafnitz, über Jahrhunderte Grenzfluß zwischen Österreich und Ungarn, in
die Raab.
Unmittelbar vor der Bundesgrenze nimmt die Lafnitz bei Dobersdorf die
115 km lange Feistritz auf. Die Raab neigt mit geringerem Gefälle dazu,
Mäander auszubilden. Die ersten Flußmäander sind im natürlichen
Flußlauf ab St. Margarethen a.d.R. erkennbar. Im Abschnitt
Hohenbrugg-Jennersdorf nimmt die Mäandrierungstendenz immer mehr zu. In
weiterer Folge wendet sich die Raab in einem großen Ost-Nordbogen der
Donau zu.
Sie durchfließt in einer Länge von 189 km die Kleine Ungarische
Tiefebene und mündet nach insgesamt 285 Flußkilometern bei Györ (Raab)
in den südlichen Wieselburger Donauarm.
Bedeutung der Namen einiger Nebenbäche:
RAAB: geht auf illyrisch "Arabon" als Ableitung zu "arabas" =
dunkelbraun, dunkel, oder auf den illyrisch-kymrischen Wortstamm "araf"
= sanft, zurück.
FEISTRITZ: geht auf den slawischen Wortstamm "bister" = reißender Bach, Wildbach, zurück.
LAFNITZ: 864 "Labenza" genannt, wird auf die keltische Wurzel
"albantia" = Weißenbach, zusammenhängend mit lateinisch albus = weiß,
zurückgeführt und erhielt später eine slawische Endung.
RITTSCHEIN: geht auf den slawischen Wortstamm "recina" = kleiner Fluß zurück.
ILZ: wird vom slawischen Grundwort "ilo" = Lehmbach abgeleitet.
Fischfang mit Schnur und Angel

Junger Fuchs (Rüde) - Canis vulpes
Ende April, Anfang Mai wölft die Füchsin. Als Nahrung sind kleine Mäuse gefragt

BÄUERLICHES ARBEITEN
Arbeiten in der landwirtschaftlich geprägten Südoststeiermark um 1900
hat wenig mit der romantisierten Darstellung des Landlebens zu tun, wie
sie immer wieder konstruiert werden. Die Arbeitsmethoden auf den Höfen
waren hoffnungslos veraltet, die Produktion kleinräumig strukturiert
und wenig effektiv. Mit über die Jahrhunderte kaum weiterentwickelten
Geräten schufteten Menschen und Tiere solange Tageslicht verfügbar war.
Wegen des permanenten Mangels an Arbeitskräften wurden Kinder ab den
frühsten Jahren, Erwachsene bis ins hohe Alter, auch Haustiere wie
Ziegen, Hunde oder junge Rinder für schwere Arbeiten eingesetzt. Erst
langsam waren Schritte zur Modernisierung gesetzt worden: Bekannt sind
etwa die Robotpatente von Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef II.
oder die Gründung der Steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft
durch Erzherzog Johann. 1848 erfolgte die endgültige Aufhebung der
Untertänigkeit der Bauern von der Grundherrschaft („Bauernbefreiung").
Sie gerieten nun aber durch die kapitalintensiven Investitionen in
andere Abhängigkeiten. Lokale Innovatoren, wie etwa die Firma Krobath,
begannen zu Ende des 19. Jahrhunderts durch technische Neuerungen die
Arbeit zu erleichtern. Dies war aufgrund der zunehmenden Landflucht
auch dringend notwendig. Trotzdem ist bis heute landwirtschaftliches
Arbeiten weiterhin mit schwerer körperlicher Anstrengung und langen
Arbeitszeiten verbunden.

Zu Ende des 19. Jahrhunderts dominieren große Haushalte: Mägde und
Knechte, Zieh- und Adoptivkinder, Saisonarbeiter, Wanderhandwerker oder
Ausgesteuerte leben unter einem Dach. Verbesserte sanitäre
Einrichtungen, der medizinische Fortschritt, das immer besser
ausgebaute Sozialsystem, der Ersatz von Muskelkraft durch Maschinen,
immer weiter entfernte Arbeits- oder Ausbildungsplätze lösen diese
Haushalte auf. Die engere „Patchwork"-Familie, die direkten Nachbarn
und der selbst gewählte Freundeskreis werden zu den primären
Bezugspunkten.
Telefon und Auto ermöglichen, dass man auch über weite Strecken mit
seinem Umfeld in Kontakt bleiben kann. Einrichtungen zur
Kinderbetreuung und Seniorenheime entstehen nun auch in der noch
ländlich geprägten Südoststeiermark. Immer mobiler werdende
Kommunikationsmittel ermöglichen in dieser räumlich entgrenzten Welt
trotzdem eine Verdichtung der persönlichen Beziehungen. Die engen
persönlichen sozialen Netzwerke über gesellschaftliche Organisationen,
ein breiter Bekanntenkreis und Nachbarschaftshilfe bleiben in den
verhältnismäßig kleinen Orten der Südoststeiermark weiterhin bestehen.

Leopoldine Thaller ist die Begründerin des Museums im Tabor in
Feldbach. Sie wurde am 14. Jänner 1915 in New York geboren, da ihre
Eltern noch vor dem 1. Weltkrieg von Österreich in die USA emigrierten.
Als Jugendliche wanderte Leopoldine mit ihren Eltern in den 1930er
Jahren wieder zurück nach Österreich und kam in die Nähe von Feldbach.
Leicht war es für die damalige junge Dame nicht. Leopoldine musste ihre
Freundinnen und ihre gewohnte Umgebung zurücklassen. Es dauerte einige
Jahre bis sie die permanente Übersiedelung in die Südoststeiermark
akzeptiert hatte. Um ihre Identität zu finden, beschäftigte sie sich
mit ihrer neuen Heimat, deren Kultur und deren Geschichte.

Aus der Identitätssuche heraus entstand ihre Leidenschaft - das Sammeln
von Dingen, die damals für viele nur noch zum Wegwerfen bestimmt waren.
Sie legte einen Bestand von bäuerlichen Arbeitsgeräten an und fand in
Anni Gamerith eine Partnerin. Gemeinsam widmeten sie sich der
Erforschung der Vergangenheit, wobei für die beiden Damen die Bewahrung
und die Rettung historischer und volkskundlicher Gegenstände aus dem
Bezirk Feldbach zum besonderen Anliegen wurden. Die erste Besprechung
fand am 2. Dezember 1948 mit Bürgermeister Dr. Viktor Notar und
Vertretern der Stadtgemeinde statt. Schon am 15. Dezember 1948 rief der
Feldbacher Bürgermeister die Bevölkerung um Überlassung von musealen
Gegenständen auf. Die Bezirkshauptmannschaft genehmigte am 1. Juli 1949
eine öffentliche Sammlung von Geld- und Sachspenden in Feldbach und in
den Pfarrgemeinden. Über 3466 Schilling wurden einbracht. Die
Unterbringung der Sammelstücke ermöglichte Stadtpfarrer Josef Lückl im
Tabor. Der Zugang zu den von der Pfarre zur Verfügung gestellten
Räumlichkeiten wurde am 23. April 1949 von der Firma Reininghaus
erlaubt. Auch Landeskonservator Dr. Walter Frodi half beratend bei den
baulichen Maßnahmen und Univ. Prof. Dr. Hanns Koren bei der Adaptierung
der Räume. Die Krönung ihrer Bemühungen erlebte Leopoldine Thaller mit
der Gründung und Eröffnung des Heimatmuseums im Feldbacher Tabor am 18.
Mai 1952. 1962 wurde ihr von der Stadt Feldbach die Dankplakette
verliehen und bis zum Jahre 1966 leitete die Urheberin Leopoldine
Thaller das Museum.


HISTORISCHE SCHULKLASSE
Diese hölzernen Schulbänke aus der Volksschule Hohenbrugg-Weinberg
fanden bis nach dem Zweiten Weltkrieg Verwendung. Der damalige
Schulalltag ist nur schwer mit dem heutigen vergleichbar: In den
Klassen waren viele Kinder unterschiedlichen Alters und
Entwicklungsgrades zusammengepfercht. Nur wenige kamen in den Genuss
einer weiterführenden Ausbildung an einer Hauptschule, einer
Berufsschule oder gar einem Gymnasium. Erst spät kamen berufsbildende
Schulen, Realschulen und Realgymnasien hinzu. Mit strenger
Disziplinierung wurde seit der Einführung der Schulpflicht durch Maria
Theresia versucht, eine Grundalphabetisierung zu erreichen: Lesen,
Schreiben und Rechnen sollten die Einwohner der Habsburgermonarchie
„kontrolliert" den aufklärerischen Prinzipien zuführen.
Diese Basiskenntnisse dienten auch als Grundlage zur Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion. Darüber hinaus wurde im Unterricht das
nationale und religiöse Bewusstsein geschärft sowie eine Unterordnung
in die staatliche Struktur eingedrillt. Für Jungen bildeten Disziplin
und Gehorsam die Basis einer vormilitärischen Grundausbildung.
Kritisches Diskutieren und eigenständiges Denken fanden erst ab Mitte
des 20. Jahrhunderts mit einer neuen Lehrergeneration Eingang in den
schulischen Alltag.

LEBZELTEN, KERZEN & HONIG
Kerzen bildeten bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts neben dem
Kienspan, den Öl- und Spirituslampen die Hauptlichtquelle. Feldbach
wurde erst 1911 elektrifiziert, die letzten abgelegenen Bauernhöfe der
Oststeiermark bekamen erst in den 1950er/60er Jahren einen
Stromanschluss. Neben dem zur Kerzenherstellung verwendeten Wachs
stellte auch der von den Bienen hergestellte Honig einen wichtigen
Erwerbszweig dar. Lebzelten/Lebkuchen, Met und Honig waren auch
Festspeisen für besondere Anlässe und Feiertage. Während des gesamten
Jahres wurden sie auf Märkten und Kirchtagen verkauft. Ab 1850 verlor
der Honig mit Beginn der industriellen Produktion von Zucker
schrittweise seine Stellung als wichtigster Süßstofflieferant.
Das Kirchenjahr strukturierte nicht nur das religiöse Leben, sondern
bestimmte mit seinen Hochfesten, Fast- und Feiertagen auch den Alltag.
Kerzen erleuchteten die Kirchen, in der Weihnachtszeit bildeten
Lebzelten beliebte Geschenke. Darüber hinaus versprachen Wallfahrten
Seelenheil und strukturierten das Kirchenjahr. Ziele waren überregional
vor allem Maria Zell und Maria Trost, regional Maria Fieberbründl,
Maria Schnee oder Maria Eichkögl. In den Wallfahrtsorten siedelten sich
Lebzelter an, Verkaufsstände rings um die Kirchen boten Kerzen an. Die
religiösen Wanderungen waren zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wie
Erinnerungsplaketten und -münzen zeigen.

GEOLOGIE & MINERALOGIE
Ein älterer Vulkanismus (16 Mio. Jahre) brachte Trachyte,
Trachyandesite und Andesite hervor, im jüngeren Vulkanismus (5,3-2,6
Mio Jahren) entstanden Basalte, Nephelinite und Tuffe. Basalt wird noch
heute im Steinbruch Mühldorf oder in Wilhelmsdorf am Stradnerkogel,
Kalzite werden in Weitendorf bei Wildon abgebaut. Die häufig
vorkommenden Kristalle (Olivine und Feueropale) entstanden durch
Umwandlung von Vulkangestein. Landschaftlich charakteristisch sind auch
die Ergebnisse explosionsartiger Vulkanausbrüche, wie etwa die
Burgfelsen von Riegersburg und Kapfenstein. Belege für die vulkanische
Vergangenheit sind auch die Thermalquellen und Säuerlinge. Die heißen
Quellen bilden sich nicht nur aus Reservoirs aus früheren Erdzeitaltern
sondern auch aus einsickerndem Wasser. Der Kurort Gleichenberg mit
seiner Heilquelle war bereits im 19. Jahrhunderts berühmt und wurde
seit den 1980er Jahren durch Thermen in Radkersburg oder Loipersdorf
ergänzt.
Sandgruben, versteinerte Schnecken und Muscheln sind Reste von Meer und
Brackwasser in dieser Region. Als sich das Wasser schrittweise
zurückzog, streiften Mammuts oder Dinotherien durch die
Sumpflandschaften. In Mataschen bei Mahrensdorf zeugen versteinerte
Bäume und verschiedene Pflanzen von den dichten Urwäldern. Das heutige
Erscheinungsbild der Südoststeiermark wurde im Laufe der letzten
Million Jahre vor allem durch die Raab und ihre Nebengewässer
(Rittschein, Feistritz, Lafnitz etc.) sowie die Mur und ihre Zuflüsse
(Ottersbach, Limbach/Lendva, Kutschenitza/Kučnica etc.) geformt.

Feldbach war und ist wichtiger Brückenpunkt an der Raab für die
Nord-Süd-Verbindungen und die West-Ost-Verbindungen. Im Bahnhof
Feldbach trifft die steirische Ostbahn mit der Landesbahn aus Bad
Gleichenberg zusammen. Mehr als 5.000 Personen werden täglich mit den
Zügen auf der Ostbahnstrecke Fehring – Graz transportiert.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne diese Videos antun:
Stadtpfarrkirche Feldbach, August 2024
Heimat.Museum im Tabor Feldbach, August 2024