web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Steirisches Feuerwehrmuseum
Groß Sankt Florian, August 2024
Feuer und Kunst – eine „explosive“ Mischung ... Zu
finden mitten im weststeirischen Groß St. Florian im malerischen
Markushof. Du erlebst die Geschichte der steirischen Feuerwehr, siehst
Oldtimer-Raritäten, eine kleine, aber feine Römersammlung und laufend
Kunst- und Kulturausstellungen.
WIE ALLES BEGANN...
Ursprünglich dominierten bei einem Brand Chaos, Angst, Panik und
Verzweiflung. Mit dem Auftauchen der Feuerwehr änderte sich das. Sie
brachte Ordnung in das Chaos und gab den Menschen ein Gefühl der
Sicherheit. Eine wichtige Rolle für die Entstehung von Freiwilligen
Feuerwehren spielten die 1811 von Friedrich Ludwig Jahn gegründeten
Turnvereine. Einerseits brachten die Mitglieder die nötige körperliche
Kondition mit, andererseits versuchten sie sich auch in der
Öffentlichkeit nützlich zu machen. Die Gründung der ersten Freiwilligen
Feuerwehren in Österreich erfolgte 1857 unter der Leitung des
akademischen Turnlehrers Franz Thurner in Innsbruck. Bis 1870 hatten
sich in den österreichischen Kronländern 38 Freiwillige Feuerwehren aus
den bis 1862 verbotenen Jahnschen Turnvereinen gebildet.
Am 19. März 1865 formierten sich die Grazer Turner als Erste in der
Steiermark zur „Freiwilligen Turnerfeuerwehr". Jeder Feuerwehrmann
hatte die Kleidung und Ausrüstung aus eigenen Mitteln zu beschaffen.
Charakteristisch für die Ängstlichkeit der Obrigkeit dieser Zeit war,
dass die k.k. Statthalterei zwar nichts gegen die Löscharbeiten
einzuwenden hatte, wohl aber gegen das Tragen der Beile als „Waffen".
Außerdem erachtete man auch das gemeinsame Nachhausegehen von der
Brandstätte als „unstatthaft". Doch die Zeit war reif für eine
grundlegende Neuorganisation der Brandbekämpfung. Die technischen
Verbesserungen, wie etwa die Erfindung der Dampfspritze von John
Ericson 1828, erforderten ein immer qualifizierteres Personal.

Signalhorn - Horn für Alarm- und Kommandozeichen

Doppelkolbenpumpe - Selbstansaugende KNAUST-Kolbenpumpe für 4-Mann-Bedienung.
Die Pumpe konnte auch zur Löschwasserförderung (200 bis 400 Liter in der Minute) verwendet werden.
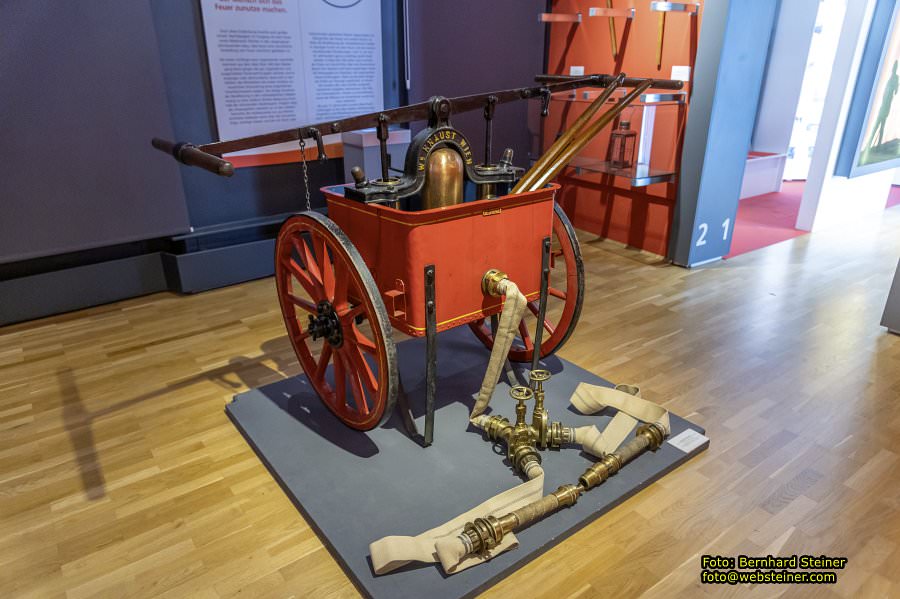
BRANDRAUCH! BITTE NICHT EINATMEN
Das Lebenslicht des Menschen brennt...
ohne Nahrung - 30 Tage
ohne Wasser - 3 Tage
ohne O2 - 3 Minuten
Lange Zeit hatte die Feuerwehr keinen Schutz vor schädlichem Rauch und
Qualm auf Brandstellen. Im Gegenteil, es galt als Mut- und
Bewährungsprobe, weitgehend ungeschützt in brennende Gebäude
einzudringen. Man nahm höchstens seinen „Löschbart" zwischen die Zähne.
Als die ersten Rauchhelme zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt
wurden, änderte sich die Lage. Bis zur Einführung von Atemschutzmasken
und umluftunabhängigen Atemschutzgeräten war der Rauchhelm die einzige
Möglichkeit, in verqualmte Räume einzudringen. Die Entwicklung der
ersten Filtergeräte fällt in die Zeit des Ersten Weltkrieges. 1916
wurden sie im „Gaskrieg" eingesetzt. Die großflächige Anwendung
erfolgte im Zweiten Weltkrieg. Die „Gasmaske" war nicht nur
Ausrüstungsgegenstand der Soldaten, sondern auch Schutzgerät im zivilen
Bereich. Mit fortschreitender Technik veränderten sich sowohl Material
und Form der Masken. Neben dem Pressluftatmer fanden die
„Sauerstoffschutzgeräte" im Feuerwehrwesen Anwendung. Heute wird
zwischen dem leichten Atemschutz mit Filtergeräten und dem schweren
Atemschutz mit Isoliergeräten unterschieden.
* * *
Magirus Rauchhelm
Der Rauchhelm war bis zur Erfindung der Atemschutzmasken die einzige Möglichkeit in verqualmte Räume einzudringen.

Tragkraftspritze FOX III
Tragkraftspritzen werden zur Wasserbeförderung mit möglichst hohem
Druck verwendet. Mit ihr werden überlicherweise Tanklöschfahrzeuge von
Gewässern wie Flüssen oder Löschteichen aus gespeist, um so die
Löschwasserversorgung bei der Brandbekämpftung sichern zu können.
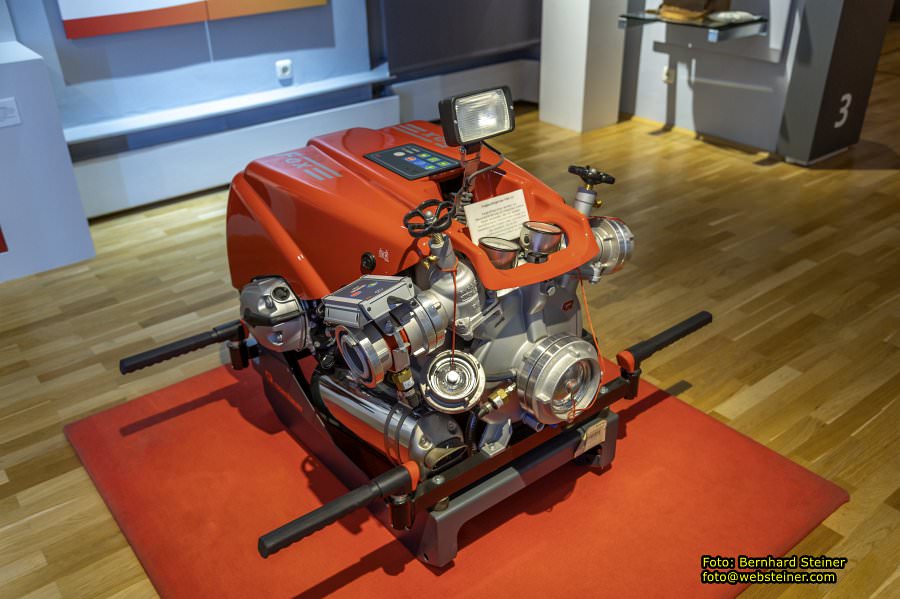
DAS FEUER & DER MENSCH
Seit vierhunderttausend Jahren kann der Mensch sich das Feuer zunutze machen.
Doch diese Entdeckung brachte auch großes Unheil. Nachlässigkeit im
Umgang mit dem Feuer sowie Missbrauch führten in den vergangenen
Jahrtausenden dazu, dass kaum eine menschliche Ansiedlung vom Feuer
verschont geblieben ist. Die ersten Anfänge einer organisierten
Löschhilfe stammen aus dem alten Rom. Mit dem Niedergang Roms gingen
die gut organisierten und ausgerüsteten Feuerwehrtruppen verloren und
es vergingen viele Jahrhunderte, bevor sich in den Städten des
Mittelalters die ersten Ansätze zur neuerlichen Entwicklung eines
organisierten Feuerlöschwesens zeigten. Die stetige Zunahme der
Bevölkerung in den mittelalterlichen Städten zwang zu einer äußerst
dichten Bebauung innerhalb der schützenden Stadtmauern. Folglich stieg
die „Feuergefahr" drastisch an. In den Städten herrschte die
Holzbauweise vor, aus Steinen errichtete Gebäude waren eher die
Ausnahme. Enge, winklige Gassen und die mit Stroh oder Holzschindeln
gedeckten Dächer begünstigten ein Übergreifen des Feuers auf andere
Häuser. So lebte die Bevölkerung der mittelalterlichen Städte in
ständiger Furcht vor dem Feuer und den daraus resultierenden
Plünderungen. Vom 12. bis zum 14. Jahrhundert gab es unzählige große
Stadtbrände.
In diese Zeit fällt daher auch erstmals der Erlass von Vorschriften
über eine feuersichere Bauart von Häusern und Feuerungsanlagen sowie
die Herausgabe von Gesetzen, den sogenannten „Feuer-Ordnungen". Darin
wurde jeder Bürger bei Strafe zur Vorsorge verpflichtet. Im Brandfall
mussten alle, nach Zünften aufgeteilt, bestimmte Aufgaben übernehmen.
Mit Hilfe von Feuerpatschen, Decken und Einreißhaken sowie der Bildung
von Eimerketten wurde das Feuer bekämpft. Bis zum 17. Jahrhundert
wurden diese Feuerordnungen in fast allen Städten Mitteleuropas
eingeführt und Pflichtfeuerwehren in Form von Lösch- und Brandgilden
oder Löschcorps gebildet.

STEIRISCHES FEUERWEHRMUSEUM Groß St. Florian
IN WÜRDIGUNG DER VERDIENSTE UM DAS FEUERWEHRWESEN GEWIDMET
DER LANDESFEUERWEHRVERBAND STEIERMARK
LEBRING. IM SEPTEMBER 2020
Steirische Florianiplakette in GOLD

FORTSCHRITT IM FEUERWEHRWESEN
Die Entwicklung der steirischen Freiwilligen Feuerwehren vollzog sich
bemerkenswert rasch. 1871 waren beim ersten Landesfeuerwehrtag schon
zwanzig Feuerwehren vertreten. Nur neun Jahre später vertrat der
Steirische Landesfeuerwehrgauverband bereits 182 Freiwillige
Feuerwehren. Die Ausbildung sowie die technischen Geräte wurden je nach
den finanziellen Mitteln verbessert. Nach der Jahrhundertwende hatte
sich der Feuerwehrgedanke endgültig durchgesetzt und bestätigt. Die
Jahre vor dem Ersten Weltkrieg brachten eine Reihe einschneidender
Änderungen mit sich. Nicht nur in organisatorischer, sondern auch in
sozialer Hinsicht gab es Neuerungen. So wurde eine allgemeine
Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Landesfeuerwehrverbandes
eingeführt.
Schon nach kurzer Zeit spielten die Feuerwehren eine wichtige
gesellschaftliche Rolle als gemeinschaftsbildende Organisation. Ein
schwerer Schlag für die Freiwilligen Feuerwehren waren allerdings die
Verluste ihrer Kameraden während der beiden Weltkriege. Angesichts der
wirtschaftlichen und politischen Lage gestaltete sich der Wiederaufbau
schwierig. Die Zwischenkriegszeit war von Improvisationskunst
gekennzeichnet. Aber so konnte nach und nach wieder ein
flächendeckender Brandschutz aufgebaut werden. Heute ist das
Feuerwehrwesen in Österreich Landessache. Die Organisation der
Feuerwehr in der Steiermark ist durch das „Steiermärkische
Feuerwehrgesetz" geregelt. Die Feuerwehren sind einheitlich gestaltete,
technisch entsprechend ausgerüstete Einrichtungen. Sie sind
verpflichtet, bei Gefahren, Brand- und Katastrophenfällen sowie
Elementarereignissen, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen drohen,
Hilfe zu leisten.


Dienstgrade

Alarmhorn, Leihgeber: FF Großlobming
Feuerwehrgurt, Feuerwehrbeil und Krückenspritze, Leihgeber: FF St. Margarethen
Wasserscheffel, Leihgeber: BTF ÖBB Knittelfeld

Petroleum-Sturmfackel, Leihgeber FF Großlobming
Trinkhorn, Leihgeber: FF Kleinlobming

Feuerwehrschwerter und -säbel
Anfänglich stellten sich die Behörden gegen die Uniformierung der
freiwilligen Feuerwehren und das Tragen von Feuerwehrschwertern und
-säbeln. Vor allem das Kriegsministerium argumentierte anfangs, dass
die Uniformierung und die Dienstgradabzeichen der Feuerwehren zu sehr
der Armeeuniformierung entsprachen. Das Tragen von Feuerwehrschwertern
und -säbeln legte man als „Waffenbesitz" aus und verbot es prompt. Dies
führte schließlich dazu, dass man den Rücken der Feuerwehrsäbel mit
Sägezähnen versah und die Seitenwaffe als „Werkzeug" deklarierte.
Letztlich konnten die Feuerwehren aber durch ihre Leistungen auch die
ärgsten Skeptiker überzeugen und die Verordnungen des Innenministeriums
legalisierten schließlich das Tragen der Seitenwaffen für
Feuerwehrangehörige.
Leihgeber: FF Kleinlobming, FF St. Lorenzen, FF Preg

Der Silberbecher (Skyphos)
Replik Villa Grünau

R75 Tragkraftspritze
Die Fertigung eigener Motoren neigt sich Mitte der 50er dem Ende zu.
Verantwortlich dafür ist ein Motor von VW. Ein leistungsstarker und
betriebsicherer 4-Takt Industriemotor mit 1.100 ccm, der im Gegensatz
zu den wassergekühlten Rosenbauer-Motoren luftgekühlt ist. Die erste
Tragkraftspritze mit VW-Motor wird 1954 auf den Markt gebracht: Die
„VW70". Sie wird kurz darauf vom Nachfolgermodell „RVW75" abgelöst.
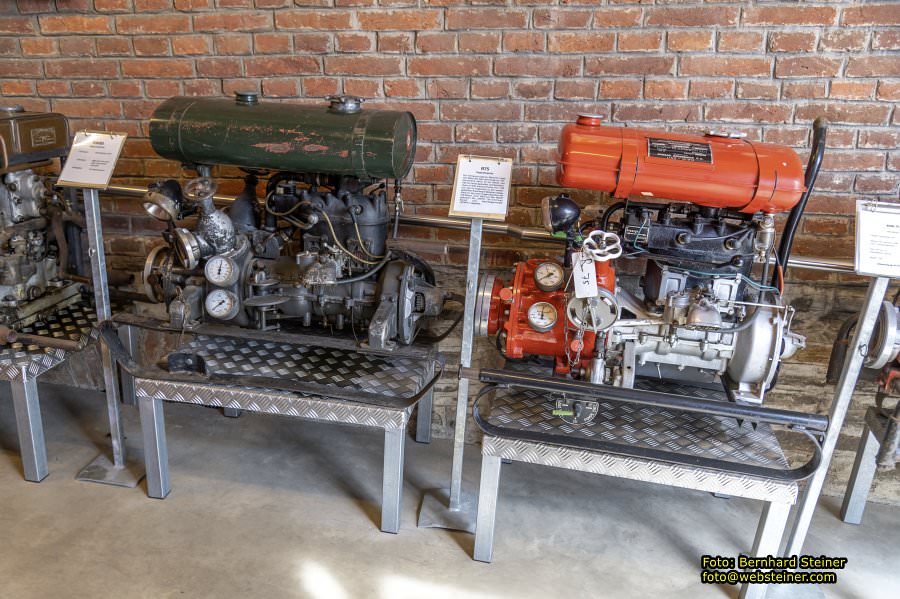

Feuerwehrzille
Die Feuerwehrzille ist ein Wasserfahrzeug zum Personen- und
Materialtransport. Sie wird durch Rudern oder Schieben fortbewegt.
Gerudert wird stromabwärts, gestochen stromaufwärts. Zillen, die
österreichische Feuerwehren im Wasserdienst heute einsetzen, werden
einheitlich nach den Baurichtlinien des Österreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes konstruiert. Die Feuerwehrzille ist 7 m lang
und besteht aus Fichtenholz. Durch die Verwendung von dicken
Holzbrettern oder entsprechenden Platten ist dieses typische
Flachwasserboot sehr robust und kann deshalb auch in überschwemmten
Gebieten eingesetzt werden, wo man aufgrund des trüben Wassers
Hindernisse, die sich unter der Wasseroberfläche befinden und für die
Bootshaut gefährlich sind, nicht ausmachen kann. Außerdem kann die
Zille nicht nur als einzelnes Boot zum Einsatz kommen, sondern auch im
Verbund als Fähre, Arbeitsplattform oder als basisbildende
Schwimmkörper für Behelfsbrücken.
Das Wort Zille stammt wahrscheinlich aus dem Slawischen und wird
entweder isoliert oder in zusammengesetzter Weise verwendet. Zille wird
im gesamten bayrisch-österreichischen Alpenraum, auf der Donau, aber
auch auf der Elbe verstanden. Im westeuropäischen Raum hingegen kommt
er gar nicht vor. Dieser Bootstyp - je nach Größe - wurde für die
verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt: die Jagd, den Fischfang, vor
allem aber für den Transport von Menschen und Handelsgütern aller Art.
Leihgeber Zille Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark Leihgeber
Schiffsstange, Ruder, Rettungsring, Einsatzjacke „Wasserdienst" Max
Aufischer

JAWA Kraftrad
Firmenmäßige Bezeichnung: JAWA 350/634 - 4
Erzeuger: Fa. MOTOKOW, Praha/CSSR
Fahrgestellnummer: 14121
Motornummer: 15404
Erstmalige Zulassung: 05.03.19
Abgemeldet am: 14.04.1992
Wieder angemeldet am: 25.06.1992
Zulassungsbesitzer: FF Hart bei Graz
Abgemeldet am: 30.04.1996

Opel Blitz LF 8 - Feuerwehr Rüst- und Mannschaftswagen mit eingebautem Spritzaggregat
Viertakt-Vergasermotor, Baujahr: 1953, 6 Zylinder, 2473 l Gesamthubraum
Erzeuger: Adam Opel AG, Rüsselsheim/Main
62 PS bei 3700 U/min, Expansionsdämpfer, Hinterradantrieb, Innenbackenbremse
Leihgeber: FF Stallhof bei Stainz
Löschwasser-Außenlastbehälter Typ „Bambi-Bucket"
Löschwasser-Außenlastbehälter des Typs „Bambi-Bucket" sind für den
Einsatz am Lasthaken geeigneter Hubschrauber besonders gestaltete und
zugelassene Wasserbehälter. Im Lagerzustand befinden sie sich in einer
speziellen Transporttasche inklusive Tragegeschirr und (Fern-)
Steuergerät. Sie sind faltbar und können somit auch an Bord des
Hubschraubers zum Einsatzort transportiert werden. Beim Transport am
Boden sind keine besonderen Hilfsgeräte notwendig. Der
zusammen-geklappte „Bambi- Bucket" öffnet sich während der Befüllung
mit Löschwasser selbsttätig. Er kann im Schwebeflug durch das
Eintauchen in Flüsse oder Seen direkt in der Nähe des Waldbrandgebietes
nach jedem Wasserabwurf schnell wieder neu mit Wasser aufgefüllt werden.
Leihgabe FF Aigen im Ennstal

Flugplatzlöschfahrzeug (FLF 4)
Baujahr: 1970
Motor Magrius Deutz, 150 PS
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h
Gesamtgewicht: 10.600 kg
Tankvolumen Wasser: 3.500 Liter
Tankvolumen Schaum: 350 Liter
Feuerlöschpumpe: Klöckner & Humbold
Pumpenleistung: 2.400 Liter / min
Monitorleistung: 1.600 Liter / min
Gesamtgewicht: 10.600 kg
Schnellangriff: 2 x 30 Meter
Leistung Schnellanriff: 400 Liter / min
Leihgeber: Flughafen Graz Betreibs GmbH
Das FLF war das 2. Löschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr Graz. Es war in Betrieb von Juli 1971 bis 2004.

VW T2, KLF
Baujahr: 1970
Max. Nutzlast: 915 kg
Leistung: 46 PS
Motor: Viertakt-Vergasermotor
Leihgeber: BTF LKH Graz II
Dieses Einsatzfahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Glauning
St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark 1970 als KLF in den
Dienst gestellt. Nach 23-jähriger Einsatzzeit bei der FF Glauning wurde
das KLF 1993 für die Betriebsfeuerwehr des damaligen
Landesnervenkrankenhauses Graz mit 27.400 km angekauft.
2011 konnte es die schweren Einsatzgeräte der Betriebsfeuerwehr nicht
mehr aufnehmen und hatte somit 41 Einsatzjahre geschafft. Es wurde ein,
der Zeit entsprechend ausgestattetes, MZF mit einem 4,5t Fahrgestell
angeschafft. Das KLF erfüllt noch gute Dienste und steht der BtF als
Oldtimer zur Verfügung!

Mercedes L 1500 S
Baujahr: 1941
Aufbau: Firma Rosenbauer
Maximale Nutzlast: 1000 kg
Hubraum: 2594 ccm, 60 Ps, Viertakt-Vergasermotor, 6 Zylinder
Das Fahrgestell dieses leichten Löschgruppenfahrzeuges LLG (nach 1943
LF8) wurde von Daimler-Benz ab Mitte 1941 gebaut und von verschiedenen
Firmen wie Flader, Hermanns oder Rosenbauer aufgebaut. Aufgrund der
geringen Nutzlast konnte die Tragkraftspritze nicht in den Aufbau
eingeschoben, sondern musste in einem Einachsenanhänger mitgeführt
werden. Dieses LLG wurde 1941 an die Gaufeuerwehrschule Graz
ausgeliefert und diente dort als Schulungsfahrzeug. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde es in Rot umlackiert, die eingebauten Geräteladen
entfernt und nach der neuen Taktik einer Tragkraftspritze eingeschoben.

Austro Daimler (später Steyr) Feuerwehr Rüst- und Mannschaftswagen
Viertakt-Vergasermotor, 4 Zylinder, 3620 l Gesamthubraum, 55 PS, Expansionsdämpfung, 4-Radantrieb
Innenbackenbremse, hydraulisch, Eigengewicht 3180 kg, Baujahr: 1937, Erzeuger: Steyr-Daimler-Puch AG
Leihgeber: FF Bruck an der Mur

Schutzanzug aus Asbest um 1900
In der Neuzeit fand Asbest erstmals in den 1820er Jahren eine
ernsthafte Anwendung. Die Fasern wurden zu feuerfester Kleidung für
Feuerwehrleute verarbeitet. Als „Hitze- (Teil) Schutz" kommen vorerst
Hauben aus Asbest in Verwendung, in weiterer Folge auch Asbestmäntel.
Doch mit zunehmendem Asbestverbrauch stiegen auch die
Gesundheitsgefahren. Bereits um 1900 wurde die Asbestose als Krankheit
entdeckt. 1943 wurde Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastungen als
Berufskrankheit anerkannt und seit 1970 wird die Asbestfaser offiziell
als krebserzeugend bewertet.

Betriebsfeuerwehr Reininghaus
Die Betriebsfeuerwehr Reininghaus wurde als freiwillige
Fabriksfeuerwehr von Gustav von Reininghaus und Direktor Cajetan
Herberger ins Leben gerufen und gehört zu den Ältesten der Steiermark.
Aufzeichnungen zeigen Gefahren, mit denen anno dazumal zu rechnen war,
wie Vorgänge in der Spirituosenfabrik und auch der Funkenflug durch
Dampflokomotiven. Da man schon immer Wert auf zeitgerechte Ausrüstung
legte, wurde im Jahre 1909 eine Dampfspritze gekauft, welche liebevolle
„Martha" genannt wurde. Diese Spritze kam nicht nur am eigenen
Werksgelände zum Einsatz, sondern man half mit ihr im gesamten Grazer
Raum aus.
Nach 1945 wurde die Braustätte nach Puntigam verlegt, wo nach einem
Brand im Hubertussaal der Ruf nach einem verstärkten Engamement bei der
Betriebsfeuerwehr laut wurde. Seit 1958 sorgte eine ständig, während
der dienstfreien Zeit tätige, dreiköpfige Bereitschaft für den
kontinuierlichen Brandschutz im Betrieb. In den Jahren 1962 bis 1975
wurde Ausrüstung verbessert, was 1976 bei einem Großbrand in der
Likörfabrik zu tragen kam, da zusammen mit der Berufsfeuerwehr ein
Übergreifen auf andere Objekte verhindert werden konnte. Durch den
Verkauf der Brüder Reininghaus Ges.m.b.H. kam es zu verschiedenen
Rationalisierungen, denen auch der Bereitschaftsdienst zum Opfer fiel.
Am 23. September 1998 wurde die Betriebsfeuerwehr Reininghaus aufgelöst.
Brauerei Reininghaus
Am Steinfeld stand ein altes Mauthaus wo Lorenz Schaup mit den
Bierbrauen begonnen hat. 1853 kamen die beiden Brüder Johann Peter und
Julius Reininghaus aus Isenburg bei Westfalen nach Graz und kauften das
Haus mitsamt der Brauerei von dem damaligen Besitz der Familie
Königshofer. Zum Zeitpunkt der Übernahme dieser winzigen Brauerei am
westlichen Stadtrand von Graz verzeichnete diese einen Ausstoß von
gerademal 2300 Hektolitern. Bereits 1892 hatten die beiden Brüder den
Betrieb so weit ausgebaut, dass ungefähr die hundertfache Menge Bier
gebraut werden konnte. Dieser beachtliche Aufschwung war auch bei Hof
nicht unbemerkt geblieben, sodass Kaiser Franz Josef dem technisch
innovativen Johann Peter Reininghaus im Jahre 1883 einen Adelstitel
verlieh.
Reininghaus war aber auch ein weithin bekannter Förderer der Künste. So
ist es unter anderem ihm zu verdanken, dass auf Grund seiner
großzügiger Unterstützung Peter Rossegger als der wichtigste steirische
Heimatdichter anzusehen ist. Die beiden Weltkriege trafen auch die
Brauerei Reininghaus schwer. Jedoch gerade in dieser Krisenzeit fällte
Dr. Peter Reininghaus eine zukunftsweisende Entscheidung. Er erwarb
einen wesentlichen Anteil der ersten Grazer Aktienbrauerei, dem
Braubetrieb Puntigam.Diese Zusammenarbiet der beiden bedeutensten
Grazer Biermarken hält bis zum heutigen Tag an.
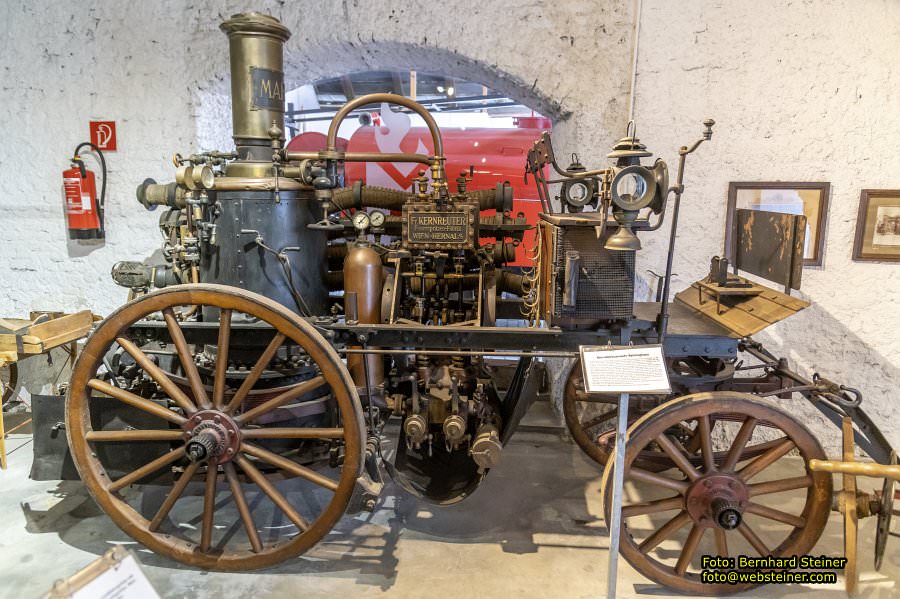
Pferdebespannte Landfahrspritze mit Zwei-Kolben-Handdruckspritze, Wenderohr und Kufen
Konstrukteur: Johann Föltl, Baujahr: 1844, Ort: Graz, Leihgeber: FF Aflenz

„Pumpenwagen mit RW 80"
1928 wurde die erste Motorspritze für die Feuerwehr Flatschach
angeschafft. Dabei fiel die Wahl auf die Motorspritze der Marke Union
mit dem entsprechenden Pumpenwagen. Die Fianzierung wurde durch den
Beitrag des LFV mit 1800 Schilling, Gemeind Flatschach mit 2000
Schilling und der Feuerwehr Flatschach mit 2376 Schilling
sichergestellt. Im Eisatz- oder Übungsfall wurde der Pumpenwagen mit
Traktoren der Landwirte gezogen die Mitglieder der Feuerwehr waren.
1948 kam es zum Ankauf der TS RW80 von der Firma Rosenbauer.
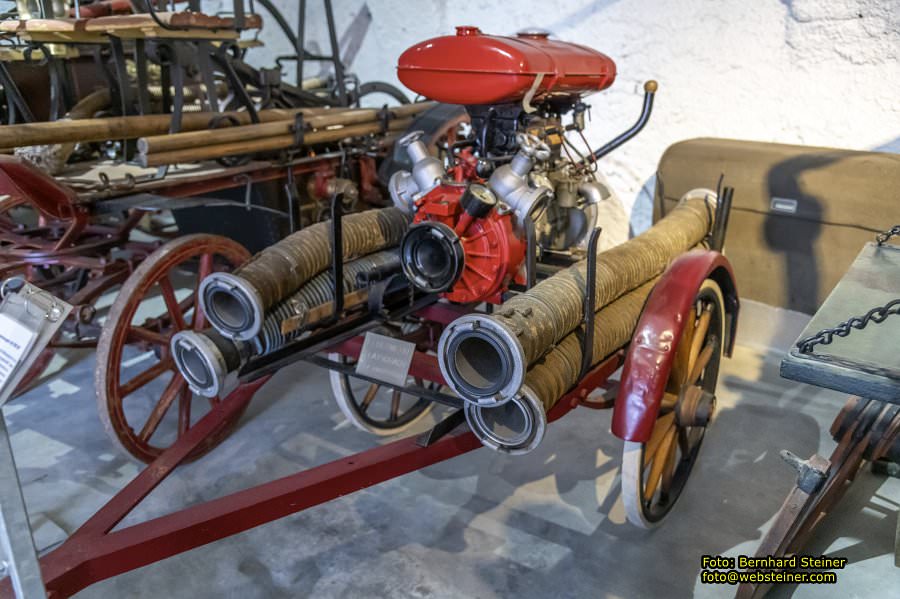
Pferdebespannte Landfahrspritze mit Zwei-Kolben-Handdruckspritze und Schlauchhaspel
Baujahr: Um 1900, Leihgeber: FF Oberschwarza

Pferdebespannte Landfahrspritze
Baujahr: 1911m Leihgeber: FF Pausendorf, Patent: R. Cermark, Teplitz im B. und Wien, KK Priv. Feuerlöschgerätefabrik
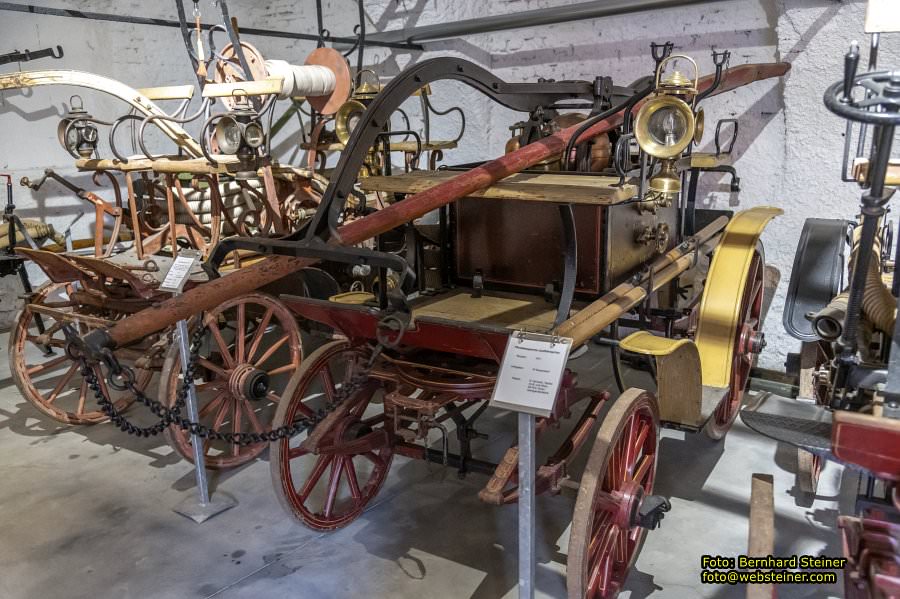
„Landfahrspritze, Bj. 1901"
Diese voll funktionsfähige Aprotzspritze aus dem Jahr 1901 wurde 1986
von der FF Schladming angekauft und von Wilhelm Pomberger aufwändig
restauriert.
Baujahr: 1901, Fahrgestell: E.C. FLADER Sorgenthal/Böhmen, Gesamtgewicht: 980 kg, Motorleistung: 2-4 PS
Leihgeber: FF Schladming

VON DER HANDDRUCK- SPRITZE ZUR DAMPFSPRITZE
Um 1600 wurde die Feuerspritze „wiedererfunden".
Pferdebesitzer waren verpflichtet, für eine vereinbarte Zeitspanne
Pferde zur Verfügung zu stellen. Mit der Erfindung der Dampfmaschine
durch James Watt wurde die Dampfkraft auch bald für den Betrieb von
Feuerspritzen verwendet.Davor standen nur Stockspritzen, Eimer,
Einreißhaken, Decken und andere einfache Geräte zur Verfügung. Durch
die weitaus sichereren Motorspritzen verloren die Dampfspritzen
zunehmend an Bedeutung. Mit der Verbesserung der Fahrzeugtechnik kam
auch das Ende der Pferde im Feuerwehrdienst. Die Versorgung der Tiere
gestaltete sich zusehends schwieriger - das Futter war teuer und die
Pferde im Winter durch die Kälte wenig einsatzfähig. Außerdem konnten
sie die schweren Dampfspritzen kaum mehr ziehen.


Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: