web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Globenmuseum
der OeNB, Jänner 2023
Globen- und Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek
Weltweit einzigartig ist das Globenmuseum mit mehr als 250 Exponaten im
prachtvollen Ambiente des Palais Mollard. Das Esperantomuseum
präsentiert neben der mehr als 100-jährigen Geschichte des Esperanto
auch außergewöhnliche Plansprachen wie das Klingonische aus der
Fernsehserie „Star Trek“.

Das Esperantomuseum der Österreichischen Nationalbibliothek ist
weltweit eines der ältesten Sprachmuseen und eine der bedeutendsten
Einrichtungen seiner Art. Seit der Gründung im Jahr 1927 verfügt das
Esperantomuseum über eine umfangreiche Bibliothek, die 1990 die
Bezeichnung Sammlung für Plansprachen erhielt. Eine über 90-jährige
kontinuierliche Sammeltätigkeit ließ die weltweit größte Fachbibliothek
für Esperanto, Plansprachen und Interlinguistik entstehen.
Die Erzählung vom Turmbau zu Babel in der Genesis stellt die
Sprachenvielfalt als Strafe Gottes dar. Dieser Mythos war seit jeher
Inspiration und Herausforderung, die verlorene Einheit durch die
Schaffung einer universalen Sprache wiederzuerlangen. Im Laufe der Zeit
wurden Hunderte so genannter Plansprachen entworfen, von den
philosophischen Systemen des 17. und 18. Jahrhunderts über die
Welthilfssprachen des 19. und 20. Jahrhunderts bis zum Klingonisch der
Fernsehserie Star Trek in unseren Tagen. Diese Fülle dokumentiert die
Sammlung für Plansprachen der Österreichischen Nationalbibliothek, die
größte ihrer Art weltweit.

Nationalsozialismus: Die
humanitäre Grundidee des Esperanto war den Diktatoren des 20.
Jahrhunderts suspekt. Hitler titulierte Esperanto als „jüdische
Universalsprache", mit der das „Weltjudentum" die Herrschaft erringen
wolle. Esperanto-Vereinigungen wurden verboten, das Esperantomuseum
nach dem Einmarsch der Nazi-Truppen in Österreich geschlossen. Die
Bücher des Esperantomuseums sollten nach Berlin verfrachtet werden. Der
damalige Generaldirektor der Nationalbibliothek, Paul Heigl
(1887-1945), verhinderte unter dem Hinweis, dass es sich um einen
bibliothekseigenen Bestand handelt, den Abtransport.
Esperanto schädigt den deutschen
Außenhandel, es erschwert dem jungen deutschen Kaufmann im Auslande
Stellung zu erhalten, es verhindert die Ausbreitung deutscher Kultur
und schädigt die politische Machtstellung des Deutschtums.
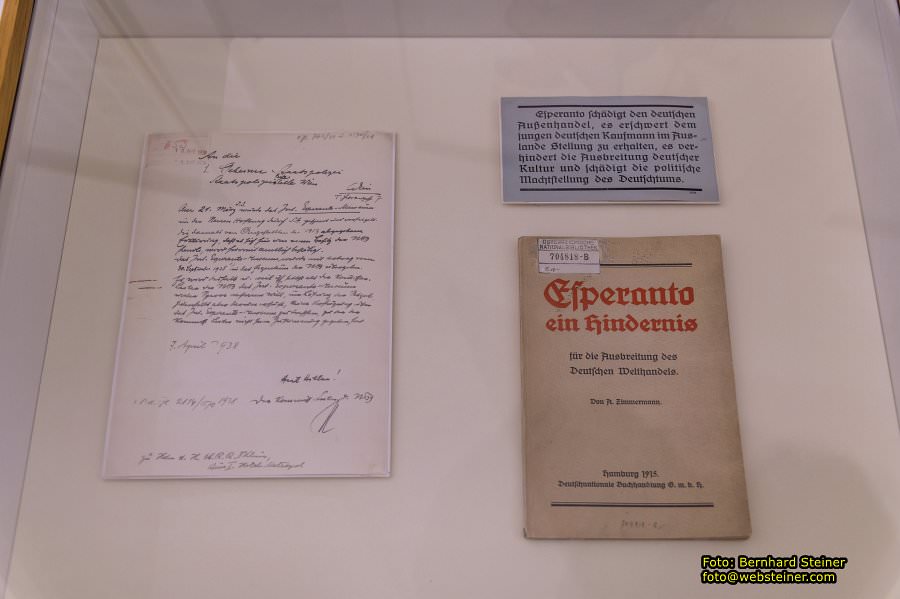
Vincenzo Coronelli (1650-1718) gilt als bedeutendster
Globenkonstrukteur und -hersteller und als würdiger Nachfolger der
erfolgreichen niederländischen Globenproduzenten aus der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts.
Er wurde am 15. August 1650 als Sohn eines Schneiders in Venedig
geboren und trat mit 15 Jahren in ein Minoritenkloster ein. Danach
studierte er Theologie und wurde 1674 zum Doktor promoviert. Coronelli
entwickelte sich in der Folgezeit zu einem vielseitigen Gelehrten; er
betätigte sich nicht nur als Theologe sondern auch als Kosmograph,
Kartograph sowie Globenkonstrukteur und er wirkte als Autor und
Herausgeber mehrbändiger Atlanten und Bücher unter anderem eines
umfangreichen enzyklopädischen Werkes. Er interessierte sich auch für
technische Wissenschaften und ihre Anwendung. Vincenzo Coronelli
kompilierte vor allem das Wissen seiner Zeit. Dabei nutzte er alle
Möglichkeiten, die sich ihm als einem hochgestellten Mitglied eines
katholischen Ordens mit hervorragenden überregionalen Beziehungen
boten. Seine organisatorischen Fähigkeiten und die Begabung. sich
Unterstützung zu verschaffen, ermöglichten ihm, sein Wissen in Form von
Büchern, Karten und Globen zu verbreiten.
1684 gründete Coronelli mit der „Accademia degli Argonauti" die erste
geographische Gesellschaft der Welt, deren Mitglieder aus ganz Europa
seine Tätigkeit finanziell unterstützten. Aus bescheidenen
Verhältnissen stammend, ermöglichten ihm seine erfolgreichen,
wissenschaftlichen Aktivitäten eine beeindruckende Karriere: 1685 wurde
er zum Kosmographen der Republik Venedig ernannt und 1701 zum
Generaloberen des Minoritenordens gewählt. Von seinen zahlreichen
Büchern sind in Bezug auf die Globen zwei hervorzuheben: die 1693
publizierten „Epitome cosmografica", eine Art Lehrbuch, dass seine
Vorlesungen in Kosmologie an der Universität Venedig zusammenfasst und
unter anderem auch eine Abhandlung über Globen enthält, und das ab dem
Jahr 1700 veröffentlichte, sehr seltene „Libro dei Globi", das die
Globussegmente aller seiner in Serie produzierten Globen beinhaltet.
Coronelli starb am 9. Dezember 1718 in Venedig. Er wurde in der Kirche
Santa Maria dei Frari beigesetzt, wo heute noch seine Grabplatte
besichtigt werden kann.
Himmelsglobus, Ø 15 cm, Vincenzo Coronelli Venedig, um 1693
Erdglobus, Ø 15 cm, Vincenzo Coronelli Venedig, um 1693

Die Globen des Vincenzo Coronelli
Wann Coronelli begann, sich erstmals mit der Herstellung von Globen zu beschäftigen, ist nicht bekannt.
Überliefert ist aus dem Jahr 1678 die Anfertigung eines (nicht
erhaltenen) Manuskriptglobenpaares für Ranuccio Farnese. Herzog von
Parma. Diese Globen, jeweils im Durchmesser von 1,75 Metern, erregten
die Aufmerksamkeit des außerordentlichen Botschafters Frankreichs in
Rom. Kardinal César d'Estrées, der ihn daraufhin 1680 mit der
Anfertigung eines prunkvollen Globenpaares für den französischen König.
Ludwig XIV., beauftragte. Zu diesem Zweck übersiedelte Coronelli nach
Paris und verbrachte dort die Jahre 1681 bis 1683. Er erhielt
vielfältige Unterstützung und Zugang zu den aktuellsten geographischen
Daten. Die Globen, jeweils im Durchmesser von 3.85 Metern, waren
wiederum Einzelstücke. In Bezug auf ihren Informationsgehalt, ihre
Konstruktion und ihre Gestaltung stellten sie Spitzenleistungen dar.
Ihre eigentliche Funktion lag jedoch im Symbolischen: sie sollten vor
allem der Verherrlichung des Sonnenkönigs dienen. In seine Heimatstadt
Venedig zurückgekehrt. begann Coronelli, auf der Grundlage der für
Ludwig XIV. entworfenen Globuskarten, ab 1686 mit der Serienproduktion
eines repräsentativen Globenpaares im Durchmesser von jeweils 110 cm.
Der Erdglobus wurde 1688 in Venedig fertig gestellt. Die erhaltenen
Exemplare unterscheiden sich nur in der Kolorierung und in der
Gestaltung der Gestelle. Von den Himmelsgloben, deren Segmente in Paris
und in Venedig gestochen wurden. existieren demgegenüber drei Ausgaben:
zwei Konvex-Versionen (Paris 1686 und Venedig 1699) und eine
Konkavausgabe (Venedig 1692).
Montierte Globen im Durchmesser von 110 cm wurden nur in Venedig und
Umgebung verkauft. Für weiter entfernte Interessenten wurden die Kugeln
und die Gestelle nach Konstruktionsplänen in der Umgebung des Käufers
angefertigt. Dann wurden die aus Venedig gelieferten Globussegmente
aufkaschiert und nach den Vorstellungen des Käufers von Hand koloriert.
Coronellis repräsentative Prachtgloben im Durchmesser von 110 cm waren
für den Adel und für kirchliche Würdenträger gedacht. Sie verkauften
sich gut und erreichten eine bemerkenswerte Verbreitung in Europa. Die
großen, attraktiven Globen wirkten nicht nur als wissenschaftliche
Instrumente und als Sinnbilder für Bildung und In-teresse an den
Wissenschaften sondern auch als Zeichen für die Einheit irdischen und
universellen Wissens und als Statussymbole. Coronelli entwarf auch
Globenpaare in kleineren Durchmessern: 1693 Erd- und Himmelsgloben im
Durchmesser von 5 und 15 cm. 1696 im Durchmesser von 48 cm und 1697 von
8,5 cm. Somit verfügte er Ende der 1690-er Jahre über die Möglichkeit,
Globenpaare unterschiedlicher Durchmesser in Serie zu fertigen und zu
verkaufen.
Himmelsglobus (konkav), Ø 110 cm, Vincenzo Coronelli, Venedig, um 1693
Erdglobus, Ø 110 cm, Vincenzo Coronelli, Venedig, um 1688

Der Himmelsglobus ist ein
Modell des scheinbaren Himmelsgewölbes, dessen Oberfläche mit einer
kartographischen Darstellung versehen ist. Dieses Kartenbild gibt die
Positionen der Fixsterne und deren Zusammenstellung zu Sternbildern
wieder. Oft sind auch astronomische Nebel und andere Himmelsobjekte
sowie Informationen zu astronomischen Phänomenen, zum Beispiel zu
Kometen und ihren Bahnen oder zu plötzlich aufgetretenen
Helligkeitsveränderungen von Sternen (Novaausbrüche) abgebildet. Von
der Erde aus wird der nächtliche Sternenhimmel von jedem Punkt aus so
wahrgenommen, als würden sich alle Himmelskörper in der gleichen
Entfernung von ihr auf der Innenseite einer Hohlhalbkugel befinden. Auf
der Grundlage des Wissens um die Kugelgestalt der Erde entstand so in
der Antike die Vorstellung eines kugelförmigen, die Erde umhüllenden
Firmaments. Der Himmelsglobus, als Modell dieser scheinbaren
Himmelskugel, bildet den Sternenhimmel jedoch auf dem Äußeren einer
Kugeloberfläche ab, wobei die Erde als im Zentrum befindlich und die
Kugel als transparent gedacht werden muss. Auf diese Weise erscheinen
die Sternpositionen und -konstellationen auf der Globuskarte
seitenverkehrt. Diese übliche Form der Darstellung wird konvex genannt.
Eine zweite Variante der Himmelsgloben zeigt die Sternpositionen und
-konstellationen seitenrichtig so, wie sie sich im Inneren der
gedachten Himmelskugel darstellen. Diese Wiedergabeform ist jedoch
problematisch, da das Bild dennoch von außen auf der Oberfläche des
Globus, und somit falsch gewölbt, betrachtet wird. Diese, als konkav
bezeichnete Variante ist daher seltener hergestellt worden.
Himmelsgloben geben, im Gegensatz zu Karten, die Beziehungen der
Positionen von Himmelskörpern, wie sie sich von der Erde aus
darstellen, unverzerrt, in ihrer richtigen gegenseitigen Lage und in
ihren Winkelbeziehungen zueinander, wieder. In ein, mit zusätzlichen
Ringen und Skalen versehenes Gestell montiert, kann mit dem
Himmelsglobus für jeden Ort der Erde und für jede Tages- und Nachtzeit
des Jahres der jeweils sichtbare Ausschnitt des Sternenhimmels
eingestellt werden. Um seine Achse gedreht, macht er den scheinbaren
Lauf der Gestirne um die Erde, mit Auf- und Untergang sowie
Kulmination, nachvollziehbar. Neben den oft sehr dekorativ gestalteten,
teilweise sogar künstlerisch anspruchsvollen, bildlichen Darstellungen
der Sternkonstellationen befinden sich auf alten Himmelsgloben häufig
auch Textinformationen. In einem, zumeist eingerahmten Textfeld, wird
der Globus bezeichnet, Autor, Hersteller, (bei Seriengloben) Verleger
und oft auch Ort und Jahr der Anfertigung angegeben. Diese
Informationen sind, neben dem Kartenbild, für die Interpretation der
Globen von großer Bedeutung. Zusätzlich werden manchmal die Quellen der
kartographischen Darstellung - Sternkataloge, Himmelskarten und
-atlanten - genannt. Weitere Texte können bestimmte astronomische
Phänomene und/oder Ereignisse erläutern oder auch Anmerkungen für die
Benützung des Globus enthalten. Das Kartenbild moderner Himmelsgloben
weist in der Regel keine Texte auf. Viele Hersteller publizierten zu
ihren Himmelsgloben Gebrauchsanleitungen, denen oft eine Einführung in
die Astronomie vorangestellt war.
„Columbus-Himmelsglobus" Himmelsglobus, Ø 33 cm
Johannes Riem/C. Luther Berlin/Stuttgart, Columbus-Verlag, um 1950
Himmelsglobus, Ø 33 cm
Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1870
Himmelsglobus, Ø 10 cm
Carl Rohrbach Berlin, Verlag Dietrich Reimer, 1896
„Navisphère" Himmelsglobus, Ø 21 cm
H. de Magnac Paris, Verlag Lorieux, um 1925
6 Himmelsglobus, Ø 68 cm
Willem Janszoon Blaeu Amsterdam, Verlag Joan Blaeu, nach 1645

Der Erdglobus ist ein Modell
der kugelförmigen Erde, das auf seiner Oberfläche mit einer
kartographischen Darstellung versehen ist. Diese zeigt die Verteilung
der Landmassen und der Meere nach dem jeweiligen Kenntnisstand. Die
meisten alten und neuen Erdgloben enthalten darüber hinaus
Informationen zur Erdoberfläche (Terrain, Gewässernetz, bedeutende
Siedlungen). Das kartographische Bild wurde und wird oft mit der
Darstellung politischer und administrativer Grenzen sowie mit
zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel zu Lagerstätten von
Bodenschätzen, Standorten bedeutender Wirtschaftszweige, Verkehrswege
sowie Kommunikationseinrichtungen ergänzt. Häufig sind auch Angaben zu
Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Meeresströmungen sowie Daten und Routen
von Entdeckungsreisen wiedergegeben. Die Vorteile von Erdgloben liegen
darin, dass sie die Oberfläche maßstabsgetreu und unverzerrt, das
heißt, längen-, flächen- und winkeltreu, wiedergeben und dass sie die
Beziehungen von Orten und die Verhältnisse von Flächen
veranschaulichen. Auf Karten hingegen ist eine gleichzeitige
unverzerrte Abbildung von Flächen und Winkeln ausgeschlossen. Globen
bieten den Überblick über die kartographische Darstellung im Verhältnis
zum Kugelkörper, was bei Karten schwer nachvollziehbar ist. Ihr
wesentlichster Nachteil liegt im relativ kleinen Maßstab der
kartographischen Darstellung. Um die Übersichtlichkeit zu
gewährleisten, beträgt der Durchmesser einer Globuskugel üblicherweise
zwischen 20 und 40 cm. Dies bedingt eine relativ starke
Generalisierung, das bedeutet, eine bewusste inhaltliche und graphische
Vereinfachung des Kartenbildes. Bei einem üblichen Globusdurchmesser
von 32 cm, der einen Maßstab von 1:40 Millionen repräsentiert,
entspricht eine Strecke von 1 cm auf dem Globus einer Entfernung von
400 km auf der Erdoberfläche. Die Abplattung des Erdkörpers an den
Polen lässt sich auf Globen gar nicht darstellen: bei dem genannten
Durchmesser würde diese auf der Globuskugel nur etwa 1 mm betragen.
Erdgloben werden in die Kategorien Karten-und Reliefgloben
unterschieden, die Kartengloben wiederum in physische und in
Themagloben gruppiert. Zu den Themagloben zählen auch Globen. die
politische Einteilungen wiedergeben. Im allgemeinen Bewusstsein sind
diese politischen Globen jedoch als die übliche Form der Erdgloben
verankert. Neben dem Kartenbild sind für den Aussagegehalt von Globen
die Beschriftung des Karteninhaltes, Angaben zu Autor, Hersteller, (bei
Seriengloben) Verleger sowie Ort und Jahr der Herstellung von Bedeutung.
Alte Erdgloben enthalten oft Textfelder, in denen Personen, denen das
Werk gewidmet wurde, sowie Quellen der wiedergegebenen Informationen,
Hinweise für die Benützung, Anmerkungen zu bestimmten geographischen
Phänomenen oder zu besonders wichtigen Ereignissen der
Entdeckungsgeschichte erwähnt werden. Diese Textfelder sowie
dekorative, bildliche Darstellungen verdecken nicht selten absichtlich
Gebiete, über die zur Zeit der Anfertigung des Globus keine oder nur
sehr wenige - und/oder unsichere Informationen vorlagen.
Auf moderneren Globen werden die dargestellten raumbezogenen Daten
abstrahiert wiedergegeben und die dazu verwendeten Kartenzeichen und
Farbsignaturen in Legenden erklärt. Viele Hersteller publizierten zu
ihren Erdgloben Gebrauchsanleitungen, denen oft eine Einführung in die
Geographie vorangestellt war.
„Erdkugel..." Erdglobus, Ø 32 cm
Joseph Jüttner/Franz Lettany Prag, 1822
Erdglobus, Ø 32 cm
Felix Lampe Berlin, Columbus-Verlag. um 1935
Kuhnerts Physikalischer Erdglobus" Erdglobus, Ø 33 cm
Kuhnert, Leipzig. Verlag Paul Räth, um 1925
Erdglobus, Ø 19 cm
Christian Gottlieb Riedig Leipzig, Verlag Schreibers Erben, 1818
„Schottes Schul- & Familien-Globus" Erdglobus, Ø 33 cm
Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co. um 1912
„Die Erdkugel nach den neuesten u. besten Quellen bearbeitet" Erdglobus, Ø 32 cm
Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1875
Erdglobus, Ø 68 cm
Willem Janszoon Blaeu Amsterdam, Verlag Joan Blaeu, nach 1645
„Globus Terrestris Novus, Loca terrae insigniora sec. praestant: Astron. et Geogr. observationes sistens"
Erdglobus, Ø 20 cm Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, um 1730 Meridianring: Replik
„Globus Terrestris juxta recentissimas observation. et navigationes"
Erdglobus, Ø 21 cm Matthäus Seutter Augsburg, um 1710

Geschichte der Globen
Erd- und Himmelsgloben sind seit der griechischen Antike bekannt.
Da jedoch der Ausschnitt der bekannten Erdoberfläche im Verhältnis zur
gesamten Erdkugel sehr gering war, wurden kaum Erdgloben angefertigt.
Die Existenz antiker Himmelsgloben, ihre Herstellung aus Stein, Metall
oder aus Holz sowie ihre Verwendung ist jedoch in zahlreichen
schriftlichen und bildlichen Quellen belegt.
Erhalten haben sich lediglich eine, der griechischen Antike
zugeschriebene, fast zwei Meter hohe Marmorstatue mit einem
Himmelsglobus und zwei kleine Metallgloben aus dem römischen Altertum.
Der arabisch/islamische Kulturkreis (der zeitlich unterschiedlich von
Spanien bis nach Indien reichte) übernahm die antike Tradition und
entwickelte diese weiter. Die ersten arabischen, zumeist aus hohlen
Metallkugeln hergestellten Himmelsgloben stammen aus dem 9. Jahrhundert.
In Europa erlangte die Lehre von der Kugelgestalt der Erde erst am
Vorabend der europäischen Expansion nach Übersee wieder Bedeutung. Sehr
wenige Objekte aus dem 15. Jahrhundert sind überliefert. Das
bedeutendste ist zweifellos der weltweit älteste erhaltene Erdglobus
aus dem Jahr 1492, der in Nürnberg von Martin Behaim (1459-1507) als
Einzelstück angefertigt wurde. Dieser Globus repräsentiert den Stand
der europäischen geographischen Kenntnisse vor den Entdeckungsfahrten
von Christoph Columbus, John Cabot und Amerigo Vespucci und zeigt den
Ozean zwischen Afrika und Asien daher noch ohne den amerikanischen
Doppelkontinent.
Im 16. Jahrhundert erlebten Erd- und Himmelsgloben im Zuge der
europäischen maritimen und kolonialen Unternehmungen als Modelle, als
wissenschaftliche Instrumente, aber auch als Lehrmittel, eine deutliche
Aufwertung. Die Serienproduktion von Globen auf der Grundlage von
Holzschnitt- und (zumeist handkolorierten) Kupferstichdrucken der
Globuskarten setzte ein. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Globen in der Regel paarweise
hergestellt: ein Himmels- und ein Erdglobus vom gleichen Hersteller, im
gleichen Stil, im gleichen Durchmesser und im gleichen Gestell.
Globen entwickelten sich im 17. Jahrhundert einerseits zu kommerziellen
Verlagsprodukten, andererseits dienten sie als symbolträchtige, barocke
Prunkobjekte, die unter anderem in den Repräsentationsräumen
geistlicher und weltlicher Autoritäten aufgestellt wurden. Im 18.
Jahrhundert ließ die Qualität der, vor allem in den Niederlanden, in
Frankreich, England, Deutschland und Italien hergestellten, kommerziell
erfolgreichen Serienprodukte nach. Die in höheren Stückzahlen
gefertigten Globen wurden jedoch erschwinglicher und fanden weitere
Verbreitung. Bedeutsame Veränderungen auf dem Gebiet der Globen
erfolgten im 19. Jahrhundert. Wurden bisher Erd- und Himmelsgloben in
der Regel als Globenpaar angefertigt, verzichteten die Hersteller ab
etwa 1850 immer öfter auf den Himmelsglobus.
Bei der Reproduktion der Globuskarten ersetzte die Lithographie den
wesentlich teureren Kupferstichdruck. Gleichzeitig wurde der Funktion
der Globen als Instrumente weniger Bedeutung zugemessen; die Montage
der Globuskugel erfolgte daher immer häufiger auf einfachen, nur mit
einer Säule versehenen Sockeln statt in den teuren vierfüßigen
Gestellen. All dies führte zu billigeren Produkten und förderte die
Verbreitung der Globen, vor allem ihre Verwendung in Schulen. Große
Serien unterschiedlicher Durchmesser wurden von nun an in vielen
Ländern produziert. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Erdglobus
zu einem industriellen Massenprodukt. Insbesondere Kunststoffgloben
sind heute in vielen Haushalten der westlichen Welt zu finden. An der
Wende zum 21. Jahrhundert wurden virtuelle, auf digitalen Technologien
basierende Globen entwickelt. Mit zahlreichen interaktiven und
multimedialen Nutzungsmöglichkeiten versehen, stellen diese eine
qualitativ neue Entwicklungsstufe in der Geschichte der
Globenherstellung dar.

Die Geschichte des Hauses Herrengasse Nr. 9
Um 1250 Seifried von Mödling
errichtet am neu geschaffenen Siedlungsgebiet an der Hochstrasse (ab
dem 16. Jahrhundert „Herrengasse") ein erstes Gebäude im Bereich der
heutigen Nummern 9-11. Sein Hof grenzt an den Friedhof der Minoriten,
die bereits ab 1224 ihre Niederlassung am Minoritenplatz haben.
1326/27 Bei den furchtbaren
Brandkatastrophen, die zwei Drittel aller Wiener Häuser einäschern,
wird auch das Haus auf der Parzelle Herrengasse 9 zerstört, das zu
dieser Zeit der Witwe Gertrude Magenpuech gehört. Es wird wieder
aufgebaut und gelangt in den Besitz von Friedrich II. von Stubenberg,
wie auch die angrenzenden Häuser im Bereich Herrengasse 11.
1440 Der „edle" Hans Pruckner,
ein Angehöriger des niederen Adels, erwirbt das Haus und stiftet es
testamentarisch der Pfarre St. Michael. Pruckner steht im Dienste von
Herzog Albrecht V., später von Kaiser Friedrich III. Seinem Vermögens-
und Inventarverzeichnis ist zu entnehmen, dass ein großer, gewölbter
Raum, mehrere Wohn- und Schlafräume, ein lang gestreckter Raum und ein
Stübchen sowie Kellerräume vorhanden sind.
1525 Bei einer Brandkatastrophe
werden mehr als 400 Häuser in der Nähe der Burg zerstört, u.a. die
Pfarrkirche St. Michael. Es ist anzunehmen, dass das Haus Herrengasse 9
ebenfalls betroffen ist und zumindest teilweise zerstört wird.
1547 Auf dem ersten Plan der
Stadt Wien von Bonifaz Wohlmut ist die Parzelle Herrengasse 9 bereits
in ihrer heutigen Form eingezeichnet.
1563 Der aus einer savoyischen
Adelsfamilie stammende Peter von Mollard erwirbt das Stiftungshaus von
der Pfarre St. Michael. Als Kämmerer Maximilians II. und oberster
Stallmeister von Kaiserin Maria genießt er hohes Ansehen und wird als
Freiherr von Reinegg in den Freiherrenstand erhoben.
1591 Die fünf Söhne von Peter
von Mollard erben das Haus nach dem Tod der Mutter. Der Älteste, Ernst,
wird zu einem der engsten Vertrauten am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag,
sein Bruder Hans hingegen dient bei Erzherzog und späterem Kaiser
Matthias, er wird Präsident des Hofkriegsrates und Oberst der Wiener
Stadtguardia. Im Haus Herrengasse 9 wird große Politik gemacht.
1609 Die erste Ansicht des Hauses Herrengasse 9 ist auf dem Vogelschauplan des Jacob Hufnagel überliefert.
1695 Ferdinand Ernst von
Mollard beauftragt den italienischen Architekten Domenico Martinelli
mit einem barocken Um- und Ausbau des Hauses. Das Haus wird um ein 4.
Geschoss aufgestockt, es entstehen der dreigeschossige Quertrakt im Hof
samt Kapelle und eine große Treppenanlage. Der
schmale Verbindungsgang im Piano Nobile wird mit mythologischen
Ölmalereien ausgestattet, die Andrea Lanzani zugeschrieben werden.
1733 Zahlreiche Baumängel sind
überliefert, u.a. muss das stark verfallene Dach erneuert werden. Die
Reparaturarbeiten führt kein geringerer als Lucas von Hildebrandt durch.
1760 Das Palais wird von Franz
Wenzel Graf Clary und Aldringen für seine aus Teplitz - dem heutigen
Tschechien - stammende Adelsfamilie als Wintersitz erworben. In ihrem
Besitz bleibt es bis 1922.
Um 1780 Im Palais Clary trifft sich regelmäßig die als „Tischrunde Josefs II." bekannte Gesellschaft hoher Wiener Adeliger.
1810 Fürst Carl Clary richtet
im zweiten Obergeschoss eine der bedeutendsten Privatbibliotheken Wiens
und eine Sammlung von Kupferstichen und Zeichnungen ein. Teile der
Originalausstattung finden sich später in den Depots des Schlosses der
Familie Clary in Teplitz.
1879/81 Das Haus wird generalsaniert, Heizungs- und Sanitäranlagen werden installiert, die Fassade wird renoviert und umgestaltet.
1900 Ab Anfang des 20. Jahrhunderts werden Teile des Hauses vermietet, u.a. an die Königlich Bayerische Gesandtschaft.
1922 Die Anglo-Österreichische
Bank erwirbt das Palais, tauscht es mit dem Land Niederösterreich und
erhält dafür das Palais Geymüller (Wallnerstrasse 8), in dem das
Niederösterreichische Landesmuseum seit 1911 untergebracht war.
1924 Nach der Renovierung des
Gebäudes erfolgt die Wiedereröffnung des Niederösterreichischen
Landesmuseums am neuen Standort in der Herrengasse.
1944 Am 10. September 1944 wird der hintere Teil des Hauses durch einen Bombentreffer schwer beschädigt.
1947-51 Nach umfassenden Bauarbeiten wird das Museum im Dezember 1951 wieder eröffnet.
1986-88 Direkt unter dem Palais werden umfangreiche U-Bahnbauarbeiten (U3) durchgeführt.
1999 Der Bund erwirbt das
Palais Mollard vom Land Niederösterreich, das Niederösterreichische
Landesmuseum findet seinen neuen Standort in der Landeshauptstadt St.
Pölten.
2002 Am 20. November 2002
findet der Spatenstich für Umbau und Generalsanierung des Gebäudes für
die Österreichische Nationalbibliothek nach Plänen von Architekt
Gerhard Lindner statt.
2005 Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wird das Haus im Herbst 2005 eröffnet als zukünftiger Sitz von:
Esperantomuseum und Sammlung für Plansprachen (Erdgeschoss)
Globenmuseum (1. Obergeschoss)
Beletage | Veranstaltungsräume (2. Obergeschoss)
Musiksammlung (3.-5. Obergeschoss)

Armillarsphären sind seit der
Antike bekannte astronomische Instrumente zur Bestimmung der Positionen
von Himmels-körpern. Sie können aber auch als Modelle zur Darstellung
der astronomischen Koordinatensysteme verwendet werden. Seit dem 16.
Jahrhundert werden Ringkugeln im Inneren manchmal mit geozentrischen
oder heliozentrischen Modellen des Sonnensystems versehen.
Geozentrische und heliozentrische Armillarsphäre, Ø 30 cm, Andreas Spitzer, Wien, 1764

Planetarien sind
nicht-maßstabsgetreue Modelle des Planetensystems. Bei diesem
Instrument wird durch Drehen der Kurbel eine kreisförmige Bewegung der
Planeten Merkur, Venus, Erde (mit Erdmond), Mars, Jupiter (mit vier
Monden), Saturn (mit sieben Monden) und Uranus (mit sechs Monden) um
die Sonne bewirkt. Das Modell kann mit den beiliegenden Zusatzgeräten
auch als Tellurium oder Lunarium verwendet werden.
Astronomisches Modell (Planetarium, Tellurium, Lunarium), London, Firma Ebsworth, 1794

Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek präsentiert
die weltweit umfangreichste öffentlich zugängliche Sammlung von Globen
und globenverwandten Instrumenten. Es ist auch die einzige Institution,
in der spezifisch Erd- und Himmelsgloben, Globen des Erdmondes und
verschiedener Planeten sowie den Globen verwandte Instrumente erworben,
erforscht und ausgestellt werden. In Österreich befinden sich weitere
bedeutende Globensammlungen in öffentlichem und in kirchlichem Besitz
sowie mehrere beeindruckende Privatkollektionen. Universitäre und
außeruniversitäre Forschung an und über Globen lässt sich in Österreich
bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Heute bezieht die Wissenschaft
auch die Entwicklung virtueller Globusmodelle auf der Basis digitaler
Technologien mit ein.
Wien ist Sitz der Internationalen Coronelli-Gesellschaft für
Globenkunde, einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit Mitgliedern
in allen Kontinenten, die sich die Aufgabe gestellt hat, die
Beschäftigung mit dem Globus als spezifische kartographische
Ausdrucksform, mit seiner Geschichte sowie seiner Stellung im
soziokulturellen Kontext zu pflegen und zu befördern. Das enge
Zusammenwirken des Globenmuseums der Österreichischen
Nationalbibliothek mit der Globenforschung, der Internationalen
Coronelli-Gesellschaft und Privatsammlern macht die Stadt Wien zu einem
international bedeutenden Zentrum der Globenkunde.

Astronomisches Instrument mit Uhrwerk und drehbarem Himmelsglobus
Himmelsglobus, Ø 21 cm, Daniel Scheyrer, Steyr?, 1624

Kaminuhr mit drehbarem Erdglobus, Erdglobus, Ø 19 cm, um 1903
Globus: Berlin, Verlag Peter J. Oestergaard, Uhr: Hersteller unbekannt

„Räth's Welthandels- u. Weltverkehrsglobus", Maßstab 1:20.000.000
Thema- und Relief-Erdglobus, Ø 63,7 cm Leipzig, Verlag Paul Räth, um 1928
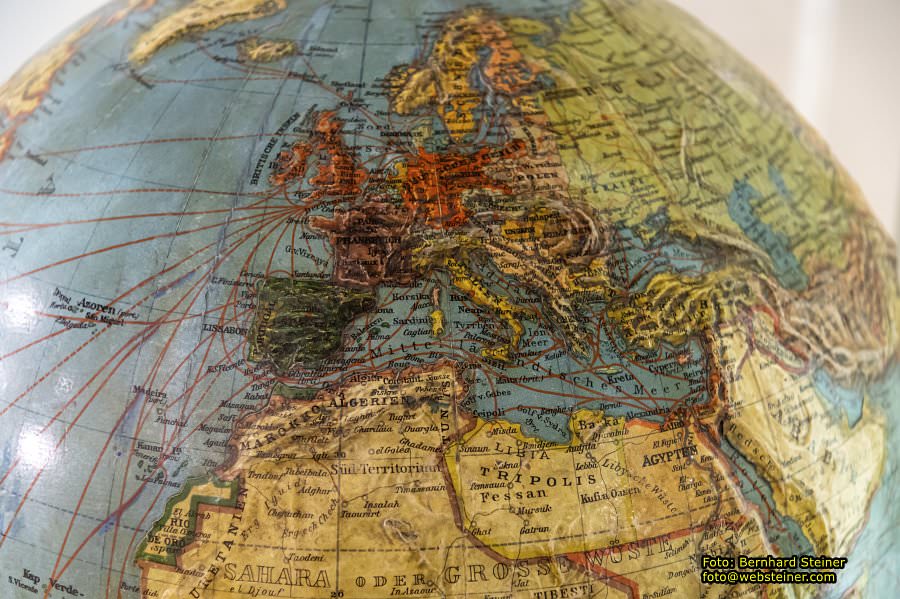
Globen und Globenkunde in Österreich
Von der Mitte des 18. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
wurden in Österreich Globen erzeugt und theoretische und praktische
Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet des Entwurfs und der
Herstellungsmethoden geleistet. Berühmt sind die Globen des ersten
österreichischen Globenherstellers, des Tiroler „Bauernkartographen"
Peter Anich (1723-1766). Im 19. Jahrhundert wurden in Österreich
qualitativ hervorragende Erd- und Himmelsgloben entworfen und in Serie
erzeugt. Spitzenprodukte stammen insbesondere von Joseph Jüttner
(1775-1848). Ende des 19. Jahrhunderts produzierten die Firmen
Schöninger in Wien und Felki in Prag zehntausende Globen in mehreren
Sprachversionen und deckten so vor allem den Lehrmittelbedarf von
Schulen. Darüber hinaus erzeugten die kartographischen Verlage Freytag
& Berndt und Eduard Hölzel bis in die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts Globen. In den 1930-er Jahren entwickelte Robert Haardt
(1884-1962) in Wien den sogenannten „Rollglobus", der jedoch nicht in
Österreich sondern in Deutschland produziert wurde.

Unter dem Begriff „Globenkunde" wird die Beschäftigung mit den Globen
als kartographische Ausdrucksformen, aber auch mit ihrer kultur-und
wissenschaftshistorischen Rolle und Bedeutung zusammengefasst. Dabei
werden vor allem die Geschichte, Erzeugung und Nutzung der Globen, aber
auch die an ihrer Herstellung beteiligten Personen und Firmen
untersucht. Studien zum Entwurf und zur Fertigung der Globuskarten,
ihrer Grundlagen und ihres Informationsgehaltes sowie Vergleiche mit
anderen kartographischen Produkten sind anspruchsvolle Teilgebiete der
Globenkunde. Weitere wichtige Aspekte stellen die bibliographische
Erfassung und exakte Beschreibung der alten Objekte und die Entwicklung
und Verbreitung von Methoden ihrer Erhaltung und Restaurierung dar. Neu
ist die Beschäftigung mit virtuellen Globen.
In Österreich wurde und wird seit dem 19. Jahrhundert sowohl
universitär als auch außeruniversitär auf dem Gebiet der Globenkunde
geforscht. 1952 gründete sich in Wien der Coronelli-Weltbund der
Globusfreunde
(heute: Internationale Gesellschaft für Globenkunde). Diese
Gesellschaft vereinigt Wissenschaftlerinnen, Sammlerinnen,
Museumskuratorinnen, Restauratorinnen und Händlerinnen aber auch viele
Institutionen und Bibliotheken, die Globen besitzen. Sie veröffentlicht
unter dem Titel „Der Globusfreund", bzw. in der englischsprachi gen
Version „Globe Studies", die einzige globenspezifische Fachzeitschrift.
Ende der 1940-er Jahre wurde in Wien das weltweit erste (private)
Globusmuseum gegründet und wenige Jahre später das Globenmuseum der
Österreichischen Nationalbibliothek eingerichtet. Von diesen Museen
gingen wichtige Impulse auf dem Gebiet der Sammlung und Dokumentation
der Globusobjekte aus.

„The Universal Globe...", Erdglobus, Ø 30 cm
Chicago, Verlag George F. Cram, um 1900
„Joslin's Six Inch Celestial Globe...", Himmelsglobus, Ø 15 cm
Gilman Joslin, Boston, 1840
„Loring's Celestial Globe ...", Himmelsglobus, Ø 30 cm
Josiah Loring, Boston, 1833

Robert Haardt und sein privates Globusmuseum
Der Wiener Privatgelehrte Ing. Robert Haardt (1884-1962) machte es sich
zur Lebensaufgabe, die Öffentlichkeit für die wissenschaftlich,
technisch und kulturgeschichtlich interessanten sowie kunsthandwerklich
oft anspruchsvoll gestalteten Globusobjekte zu sensibilisieren. Eines
seiner Hauptziele ab den 1930-er Jahren lag in der Errichtung eines
staatlichen Museums, in dem alte Globen zentralisiert und einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert werden würden. Obwohl Haardt auf namhafte
Unterstützung zählen konnte, wurde sein Vorhaben bis zum Ende der
1940-er Jahre nicht realisiert. Daraufhin richtete er in seiner Wohnung
im vierten Wiener Gemeindebezirk ein privates „Globusmuseum" ein, in
dem neben seiner eigenen Sammlung auch Leihgaben aus öffentlichem
Besitz präsentiert sowie Sonderausstellungen veranstaltet wurden.
Robert Haardt gab nicht nur der Forschung über alte Globen wichtige
Impulse - er wirkte auch unermüdlich für die Verbreitung von Globen in
der Bevölkerung und insbesondere für die Verwendung dieser
anschaulichen Modelle im Schulunterricht. Robert Haardt erlangte
darüber hinaus Bedeutung als Erfinder des achslosen, mit Einrichtungen
zum direkten Ablesen von Entfernungen und Winkeldifferenzen versehenen,
sogenannten „Rollglobus". 1952 initiierte er in Wien die Gründung des
„Coronelli-Weltbundes der Globusfreunde" und wirkte bis zu seinem
Ableben als dessen Präsident.

Das Kabinett der Sammlerinnen und Sammler
Alte Globen sind sowohl Zeugnisse historischer geographischer und
astronomischer Vorstellungen als auch aufwändiger künstlerischer
Gestaltung und kunsthandwerklicher Fertigung. Ihre Herstellung diente
der Dokumentation und Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse aber
auch repräsentativen und dekorativen Zwecken. Heute sind sie vor allem
als wertvolle und attraktive Sammlerstücke, als Ausstellungsobjekte und
als Quellen für historische Forschung von Bedeutung. Das Kabinett der
Sammlerinnen und Sammler präsentiert Globen aus vier bedeutenden Wiener
Privatsammlungen, die dem Globenmuseum als Dauerleihgaben zur Verfügung
gestellt wurden. Auf diese Weise werden vier individuelle Annäherungen
an das Objekt Globus dokumentiert.

Mondgloben
Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ermöglichte die Erfindung des
Fernrohres den Sternenhimmel, aber auch die Oberfläche des Erdmondes
genauer zu betrachten. Die Beobachtungsergebnisse der Astronomen wurden
auf Karten dokumentiert. 1750 verfasste und veröffentlichte der in
Nürnberg und Göttingen wirkende Astronom und Kartograph Johann Tobias
Mayer (1723-1762) eine Publikation über die Serienfertigung von
„Mondkugeln". Von Mayer sind einige Segmente für einen Mondglobus,
nicht jedoch ein montierter Globus überliefert. Der früheste erhaltene
Mondglobus stammt von John Russel (1745-1806), einem englischen Maler,
der 1797 in London eine geringe Anzahl von Exemplaren unter Verwendung
gestochener Segmente herstellte. Die Serienfertigung von Mondgloben
wurde in Wien eingeleitet. Auf der Grundlage der Karten von Johann
Heinrich von Mädler und Wilhelm Beer entwarf Josef Riedl, Edler von
Leuenstern (1786-1856), die Segmente für einen Mondglobus, der ab 1849
vom Wiener Globenfabrikanten Franz Schöninger produziert wurde. Riedls
Mondgloben sind heute außerordentlich selten. Aufgrund der gebundenen
Rotation des Mondes um die Erde kann von dieser aus immer nur eine
Seite seiner Oberfläche gesehen werden; die andere Hälfte blieb bis zur
Umrundung durch Weltraumfahrzeuge unbekannt.
Das Kartenbild des in den 1880-er Jahren von dem Pariser Astronomen
Camille Flammarion (1842-1925) in Zusammenarbeit mit Casimir Marie
Gaudibert (1823-1901) entworfenen Serienglobus weist auf der
Vorderseite 343 nummerierte Formationen auf, die auf der Rückseite
alphabetisch geordnet aufgelistet sind. Im Zuge der sowjetischen und
der US-amerikanischen Raumfahrtunternehmungen zur Erforschung des
Mondes ab den späten 1950-er Jahren nahm die Mondkartographie, aber
auch die industrielle Herstellung von Mondgloben einen markanten
Aufschwung. Die Umrundung des Erdtrabanten durch die sowjetische
Weltraumsonde „Luna 3" im Oktober 1959 ermöglichte erstmals die
Übermittlung von, allerdings noch unvollständigen, photographischen
Aufnahmen der Rückseite. Diese Bilder waren die Grundlage für den
ersten, vom staatlichen Sternberg-Institut in Moskau produzierten und
veröffentlichten Mondglobus, der zumindest einen Teil der bis dahin
unbekannten Seite des Mondes wiedergeben konnte. Wenige Jahre später
waren durch weitere Weltraumunternehmungen die Lücken geschlossen.
Insbesondere nach der Landung der ersten Menschen auf dem Mond wurden
in den späten 1960-er und frühen 1970-er Jahren zahlreiche Mondgloben
in unterschiedlicher Qualität produziert. Mit dem vorläufigen Ende der
auf die Erforschung des Mondes ausgerichteten Raumfahrtprogramme
erlahmte jedoch rasch das Interesse der Öffentlichkeit an Mondgloben.
Heute sind nur noch wenige Exemplare käuflich zu erwerben.

Erdglobus, Ø 10 cm Berlin, Verlag Ludwig Julius Heymann, um 1890
Erdglobus, Ø 15 cm, Berlin, Verlag Ludwig Julius Heymann, 1885-1895
Erdglobus, Ø 33 cm, Berlin, Verlag Dietrich Reimer (E. Vohsen), 1907
„Universal-Globus", Erdglobus, Ø 21 cm, Arthur Krause, Leipzig, Verlag Paul Räth, um 1920
Erdglobus, Ø 33 cm, R. Neuse, Berlin, Verlag Paul Oestergaard, 1909
„Die Erdkugel", Erdglobus, Ø 24 cm, Berlin, Verlag Ernst Schotte & Co., um 1875
„Mang's neuer Erd-Globus", Erdglobus, Ø 33 cm, Stricker...., Stuttgart, Verlag Adolf Mang, um 1906

„Globus Terrestris", Erdglobus, Ø 10 cm
Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, Verlag Weigel und Schneider, um 1795
„Globus Coelestis Novus...", Himmelsglobus, Ø 32 cm
Johann Gabriel Doppelmayr Nürnberg, Verlag Christoph Weigel und Schneider, um 1790

Das Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek
1953 verfügte das Unterrichtsministerium die Einrichtung einer
staatlichen Globensammlung, organisatorisch und räumlich angeschlossen
an die Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek am
Josefsplatz. Die in öffentlichem Besitz befindlichen Globen aus Robert
Haardts Globusmuseum wurden in die Kartensammlung transferiert und
gemeinsam mit dem Globenbestand der Bibliothek ab April 1956 öffentlich
zugänglich gemacht. Kontinuierlich und systematisch wurde der Bestand
der Globensammlung erweitert, nach und nach errang die Sammlung den
Charakter eines Museums unterstützt von privaten Sammlern, die mehrere
seltene Globen als Leihgaben zur Verfügung stellten. 1986 wurden für
das Globenmuseum im Gebäude der Österreichischen Nationalbibliothek am
Josefsplatz neue Räumlichkeiten adaptiert, die erstmals zeitgemäße
konservatorische Ansprüche erfüllten und die Präsentation der Globen -
einem didaktischen Konzept folgend - erlaubten.

In dem 2005 im Palais Mollard neu eröffneten Globenmuseum werden den
Besucherinnen und Besuchern Globen als spezifische kartographische
Ausdrucksformen aber auch als Objekte von hoher künstlerischer und
handwerklicher Qualität vorgestellt. Neben den alten, wertvollen und
unantastbaren Objekten wird zum ersten Mal auch ein virtueller Globus
präsentiert. Der Bestand des Museums umfasst mehr als 420 Objekte
(2005). Er wird durch Ankäufe kontinuierlich erweitert. Das
Hauptgewicht der Sammlung liegt bei den vor 1850 angefertigten Objekten
- in dieser Hinsicht handelt es sich um die weltweit zweitgrößte
Kollektion nach der des National Maritime Museum in Greenwich (UK).
Interessierten, die an und über Globen aus dem Museumsbestand forschen
möchten, steht in der Studiensammlung des Globenmuseums ein
Benutzerraum zur Verfügung. Globenspezifische Fachliteratur wird von
der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek gesammelt
und kann dort von den Bibliotheksbenützerinnen und -benützern
konsultiert werden. Teil des Globenmuseums im Palais Mollard ist das
„Kabinett der Sammlerinnen und Sammler", in dem Dauerleihgaben aus vier
bedeutenden Wiener Privatsammlungen individuelle Formen der
Beschäftigung mit Globen in heutiger Zeit nachvollziehbar machen.

Globen als Instrumente
Erd- und Himmelsgloben wurden in der Vergangenheit auch als wissenschaftliche Instrumente verwendet.
Qualitativ hochwertig und präzise gearbeitet sowie mit zusätzlichen
Messeinrichtungen (Horizontring. Meridianring. Höhenquadrant,
Stundenring und Stundenzeiger sowie Kompass) ausgerüstet, dienten sie
als Analogrechner, mit denen zahlreiche geografische und astronomische
Fragestellungen mit ausreichender Genauigkeit durch Direktablesen ohne
langwierige Rechnungen gelöst werden konnten.
Alte Anleitungen zum Gebrauch der Globen enthalten oft Listen derartiger Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten, zum Beispiel:
- Ermittlung der Position der Sonne innerhalb der Ekliptik für einen bestimmten Tag und einen bestimmten Ort
- Bestimmung von Sonnenauf- und Sonnenunter-gang und somit auch der
Tageslänge sowie der Zeit der Dämmerung für einen bestimmten Ort
- Bestimmung der Entfernung zweier Orte der Erdoberfläche mittels Zirkel oder Messskala
- Ermittlung der Himmelsrichtung von einem Ort zu einem anderen
- Bestimmung der Positionen von Himmelskörpern
- Bestimmung des Zeitpunktes von Auf- und Untergang bestimmter Sterne für einen bestimmten Ort
- Bestimmung der Zirkumpolarsterne für einen bestimmten Ort
- Bestimmung von Sternen, die an einem bestimmten Ort nie sichtbar werden.
Diese wissenschaftliche Funktion ging im 19. Jahrhundert verloren.
Seitdem werden Globen zumeist ohne die dafür notwendigen
Messeinrichtungen hergestellt.

Besondere Globustypen
Globen weisen eine erhebliche Bandbreite in Bezug auf Größe und
Gestaltung sowie auf ihren Verwendungszweck auf. Riesengloben mit
Durchmessern von mehr als 10 Metern dienten zum Beispiel als
Wahrzeichen für Weltausstellungen; Miniaturgloben wurden als
Sammlerstücke hergestellt. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen
mechanische Weltmodelle mit beweglichen Erd- und Himmelsgloben. Ein
Uhrwerk treibt die Zeiger an und dreht gleichzeitig die Globuskugel.
Bewegliche, Sonne und Mond darstellende Metallscheiben geben die
jeweiligen Standorte dieser Himmelskörper auf dem Firmament an.
Einfache mechanische Uhren mit sich drehenden Globen wurden um 1900
hergestellt.
Im 18. Jahrhundert waren so genannte Taschen- oder Sackgloben beliebt.
Himmel und Erde symbolisierend, wird die Erdkugel von einem Futteral
umschlossen, auf dessen Innenseite die Segmente eines Himmelsglobus
eingeklebt sind. In Größe, Robustheit und Gestaltung auf das
Zielpublikum abgestimmt, zeigt das Kartenbild eines im 19. Jahrhundert
gefertigten Kinderglobus Menschen, Tiere, Pflanzen, Schiffe,
Reiserouten und Meeresungeheuer.

Aufgrund hoher Herstellungskosten war die Verwendung von Globen in
allgemeinen Schulen vor dem Zeitalter der industriellen
Massenproduktion nicht möglich. Aus diesem Grund wurden im 19.
Jahrhundert billigere Globustypen entwickelt:
Faltglobus | Sechs auf biegsamen Karton aufkaschierte Globussegmente
werden mittels dünner Fäden so gespannt, dass ein kugelähnlicher Körper
entsteht.
Aufblasbarer Globus | Dieser
wurde auf Basis dünnen und mit dem Kartenbild bedruckten Papiers bzw.
luftdichter Seide gefertigt und gemeinsam mit einem Blasebalg und einer
Anleitung zum Gebrauch verkauft.
Aufspannbarer Globus | Ein
regenschirmähnlicher Mechanismus ermöglicht die Entfaltung der, aus
einem mit der Globuskarte bedruckten textilen Material bestehenden
Oberfläche zu einem kugelähnlichen Körper.
Als Lehrmittel für den Geographieunterricht dienten folgende Globustypen:
Induktionsglobus | Zur
Vermittlung von Grundbegriffen der Geographie oder Astronomie konnten
beispielsweise das Gradnetz oder Lagebeziehungen von Kontinenten bzw.
Sternbildern zueinander mit Griffel oder Kreide direkt auf die
Oberfläche der Globuskugel aufgezeichnet und später wieder abgewaschen
werden.
Aufklappbarer Globus | Neben
seiner Verwendung als „gewöhnlicher Globus" erleichterte dieser - in
Halbkugeln zerlegt und mittels zweier im Inneren angebrachter Haken an
die Wandtafel gehängt - das Verständnis für die Kartenprojektion.
Erdglobus mit Kugelhaube | Dieser veranschaulicht geographische Phänomene, die mit dem Lauf der Erde um die Sonne zusammenhängen.
In den 1930-er Jahren entwickelte Robert Haardt (1884-1962) den so
genannten „Rollglobus mit Haardt-Erdmesser". Rollgloben lassen sich,
entweder auf Kugeln oder in einem Gestell auf Filzstreifen gelagert, in
alle Richtungen drehen und bieten so einen ungehinderten Blick auf alle
Erd-und Himmelsgegenden. Mit einer Messskala können Entfernungen und
Winkeldifferenzen direkt abgelesen werden.
Eine vollkommen neuartige Entwicklung wurde erstmals gegen Ende des 20.
Jahrhunderts realisiert. Immaterielle, virtuelle Globen auf der
Grundlage digitaler Programme und Daten ermöglichen nicht nur die
Darstellung und Bearbeitung aktueller raumbezogener Sachverhalte, sie
können auch mit interaktiven Funktionen ausgestattet werden.
