web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Herz-Jesu-Kirche Graz
Pfarrkirche Graz-Herz Jesu, September 2024
Die Herz-Jesu-Kirche bzw. Pfarrkirche Graz-Herz Jesu ist eine im neugotischen Backsteinstil erbaute römisch-katholische Kirche im 2. Grazer Bezirk St. Leonhard. Das 1881–1887 erbaute Gebäude hat den dritthöchsten Kirchturm Österreichs und zählt zu den bedeutendsten Bauten des Historismus in der Steiermark.

Im Jahr 1875 rief der aus Südtirol stammende Fürstbischof Johann
Baptist Zwerger, ein großer Herz-Jesu-Verehrer, erstmals zum Bau einer
Herz-Jesu-Kirche für Graz auf. Die Kirche sollte ein Pfarrzentrum für
das damals rasch wachsende Gründerzeitviertel im heutigen Bezirk St.
Leonhard werden und gleichzeitig ein bedeutendes Denkmal der
Herz-Jesu-Verehrung darstellen.

Nach langen Diskussionen über den Baustil (der Bau einer Kirche nach
Art der Wiener Votivkirche musste aus Kostengründen verworfen werden)
wurde schließlich der aus Graz stammende Georg von Hauberrisser,
Architekt des Münchner Rathauses, mit der Errichtung der Kirche im
neugotischen Backsteinstil nach Art der norddeutschen Kirchen im Stil
der Backsteingotik beauftragt. Die Grundsteinlegung erfolgt 1881, im
Jahr 1885 wurde Dachgleiche gefeiert und 1887 der hohe Turm
fertiggestellt. Am 5. Juni 1891 wurde die Kirche geweiht, aber erst am
10. Oktober 1902 zur Pfarrkirche erhoben.

Die Kirche und der im gleichen Stil errichtete Pfarrhof sind von einem
Park umgeben und sichtbar von den Idealen der Romantik beeinflusst. Um
trotz des tiefliegenden Bauplatzes ein monumentales Erscheinungsbild zu
erreichen, wurde die Kirche zweigeschossig in Form einer Unterkirche,
die sich in Arkaden zum Park öffnet, und einer darüberliegenden
Oberkirche errichtet. Der Südwestturm der nicht exakt geosteten Kirche
ist mit 109,6 m der dritthöchste Kirchturm Österreichs, nach den Türmen
des Wiener Stephansdoms und des Mariä-Empfängnis-Doms in Linz.
Die Wasserspeier, die Windrose und die steinernen Kreuzblumen sind charakteristische Details der Außenfassaden.

Um möglichst vielen Personen freie Sicht auf den Altarraum zu bieten,
wurde die Kirche als gerichtete Wegkirche mit Seitenkapellen,
stützenfreiem Innenraum und in die Hochschiffwände integrierten
Pfeilern erbaut. Das strenge Erscheinungsbild des großen freien
Innenraums wird durch farbige Fenster und Wandfresken aufgelockert. Der
innen vorherrschende einheitliche Gesamteindruck ist der Tatsache zu
verdanken, dass Hauberrisser jedes noch so kleine Detail selbst
gestaltet hat und die originale Ausstattung vollständig erhalten
geblieben ist.

Aufgeteilt an den Außenwänden der Seitenkapellen befinden sich die
vierzehn Bilder der Kreuzwegstationen, die der Wiener Maler Josef
Kastner 1893-1894 schuf. Wie Karl Karger hatte auch Kastner in
Münchenstudiert und stand dadurch in näherem Kontakt mit Hauberrisser,
der die Bildformate der auf Kupferplatten gemalten Leidensszenen
festlegte. Die 14 auf Kupferplatten gemalten Kreuzwegbilder, die sich
an den Außenwänden der Seitenkapellen befinden, wurden vom Wiener Maler
Josef Kastner gestaltet.

KREUZKAPELLE
Altar (errichtet 1895)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstelter, Peter Neuböck
Reliquien: S. Timothei, Episc. et M. e. S. Primi M.
Der gestufte Altaraufbau (Kalk San Girolamo) wird von der großen
Kreuzigungsgruppe Brandstetters beherrscht. Unter dem Kreuz Maria
Magdalena, daneben Maria und Johannes. Das geschnitzte Hochrelief über
der Mensa zeigt die Abendmahlszene (Ausführung: Peter Neuböck).
Das Wandgemälde (Entwurf K. Karger 1904, Ausführung M. Goldfeld) bildet
in dieser Kapelle den landschaftlichen Hintergrund zur großen
Kreuzigungsgruppe. Das Bild zeigt die Stadt Jerusalemzur Zeit Christi
nach den Darstellungen von Piglheim und Sattler, über den Wolken der
hl. Geist in der Gestalt der Taube und Gottvater im Strahlenkranze,
anbetende Engel zu beiden Seiten des Kreuzes. An der linken Seitenwand
eine Holzbüste des hl. Judas Thaddäus (Ausführung Neuböckjun., 1933).
Unweit davon verweist eine Inschrift auf die letzte Ruhestätte Bischof Zwergers, die sich in der Unterkirche befindet.
Am Pfeiler gegenüber das Epitaph des Bildhauers Hans Brandstetter, ausgeführt im Jahre 1934 von seinem Sohn Wilhelm Gösser.

Auf Wunsch des Architekten Hauberrisser wurde der Wiener Genre- und
Historienmaler Karl Karger mit der Herstellung der Wandgemälde
beauftragt. Karger schuf daraufhin Kartons, nach denen seine Schüler
Johann Lukesch und Max Goldfeld die Gemälde 1886–1906 ausführten. Die
12 Wandbilder an den Seiten des Hauptschiffs und an der nördlichen
Presbyteriumswand bilden einen geschlossenen Zyklus, der vorne rechts
mit der Anbetung Christi durch Hirten und Könige beginnt und mit der
Kreuzigung Christi endet. Jedem Bild ist ein erklärendes Bibelzitat
beigefügt.

ANTONIUSKAPELLE
Altar (errichtet 1903)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter
Stifter: Antonie de Poliansky
Reliquien: S. Chrysotomi et S. Anastasiae
Flügelaltar auf Steinunterbau (Kalk San Girolamo). Die mit
Metallapplikation versehenen Altarbilder sind von Karl Karger
ausgeführt. Im Mittelbild die Version des hl. Antonius von Padua, links
das Wunderder Verehrung der heiligen Hostie, rechts das Wunder der
Fischpredigt. Im Sprengwerk die Plastiken des hl. Franziskus (links)
und des hl. Antonius v. Ilbenstadt (rechts). In der Mitte die Madonna
mit dem Kind unter einem Baldachin. Die Statuetten und das Altarkreuz
fehlen.
Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1904, Ausführung M. Goldfeld) zeigt
den heiligen Antonius von Padua, knapp vor seinem Tode, die Stadt Padua
segnend.

NEPOMUKKAPELLE
Altar (errichtet 1899)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter
Ornamentik: B. Gorendschek
Fassung: W. Sirach
Tischlerarbeiten: J. Roßmann
Stifter: Johann Großschädl.
Reliquien: S. Cypriani et S. Sabinae
Flügelaltar auf Steinunterbau (Kalk Ungarischrot, Sütte). Im Schrein
plastische Darstellung vom Tod des hl. Johannes Nepomuk. Der Leichnam
wird aus den Fluten der Moldau geborgen. Im Hintergrund die Karlsbrücke
in Prag. Im Sprengwerk reliefierter Engel mit leerem Spruchband,
darüber die Statue des Auferstandenen. Auf den Altarflügeln Tafelbilder
von Karoline Schwach: Maria Magdalena de Pazzis (links) und Antonius
der Einsiedler (rechts). Neben dem Altarkreuz Statuetten der Heiligen
(v.l.n.r.) Antonius des Einsiedlers, Maria, Johannes und Maria
Magdalena de Pazzis.

Auf Wunsch des Architekten wurde der Wiener Genre- und Historienmaler
Karl Karger mit der Herstellung der Wandgemälde beschäftigt, die nach
Hauberrissers Plan die horizontale Komponente zur aufstrebenden
Architektur darstellen sollten. Karger, der auch für das Wiener
Burgtheater zwei Kolossaldeckengemälde geschaffen hatte, schuf die
Kartons nach denen seine Schüler Johann Lukesch und Max Goldfeld ab
1896 die Ausführung an Ort und Stelle mit Kaseinfarben übernahmen. Die
Bilder geben als geschlossener Zyklus die wichtigsten Ereignisse aus
dem Leben Jesu wieder und sind mit einem entsprechenden Zitat aus der
Heiligen Schrift versehen.

Die Glasfenster der Herz-Jesu-Kirche stellen eines von wenigen komplett
erhaltenen Ensembles neugotischer Glaskunst in Österreich dar. Von den
nach Entwürfen Hauberrissers gestalteten Fenstern entstanden die
figuralen Kunstverglasungen in der Glasmalereianstalt Neuhauser in
Innsbruck, die einfacheren Verglasungen teilweise in Graz. Auf den
figuralen Fenstern sind wesentliche Inhalte christlicher Glaubenslehre
dargestellt, etwa die Dreifaltigkeit sowie die Heiligen und der
auferstandene Christus.
Das große Radfenster (Durchmesser 8,50 m) über dem Hauptportal stellt
den Triumph der göttlichen Liebe dar. Im Mittelpunkt der Auferstandene,
umgeben von Engeln, im Kreise rundum in vierzehn Medaillons die Bilder
der Heiligen (von oben im Uhrzeigersinn beginnend) Petrus, Aloisius,
Josephus, Rupertus, Johannes Nepomuk, Florian,
Magdalena, Leopoldus, Johannes Ev., Anna, Franziskus, Maria, Johannes
Bapt. und Stephanus. Den ornamentalen Hintergrund bilden Ranken mit
Sonnenblumen.

Die sechseckige Kanzel ruht auf einer stärkeren Mittelsäule und sieben
schlanken Säulen, die auch die Treppe tragen. In den Feldern der
Kanzelbrüstung sind Reliefbüsten der vier Evangelisten zu sehen, an den
sechs Ecken des achteckförmigen Schalldeckels stehen Engel mit einem
Spruchband (Discite a me, quia mitis sum et humilis corde – ‚Lernt von
mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen‘, Mt 11,29), und an
der Unterseite des Schalldeckels ist die Taube als Symbol des Heiligen
Geistes dargestellt.

Der nach gotischen Konstruktionsprinzipien errichtete basilikale
Wegraum ist funktionell und konstruktiv gegliedert. Das Hochschiff als
breiter, stützenfreier Gemeinderaum, das mit einem 5/8-Chorschluss
endende Presbyterium, die niederen seitlichen Kapellenräume für die
Nebenaltäre und die Taufkapelle im Turmgeschoss sind entsprechend ihrer
funktionellen Bedeutung klar akzentuiert. Die Folge der
kreuzrippengewölbten Joche (sechs im Schiff, zwei im Presbyterium) und
der seitlichen mit Blattkapitellen versehenen Dienste ergibt eine
rhythmische Betonung der Längsachse. Die unter dem rückwärtigen Joch
eingezogene Musikempore bildet das innere Pendant zur äußeren Halle vor
dem Haupttor.

Die Orgel wurde 1889 bis 1891 von der Orgelbaufirma E. F. Walcker &
Cie. erbaut. Das Instrument hatte zunächst 36 Register auf zwei
Manualen und Pedal mit pneumatischen Trakturen. 1941 erweiterte Walcker
das Instrument um ein drittes Manualwerk (Rückpositiv) und stellte die
pneumatische Traktur auf elektro-pneumatischen Betrieb um. 1991 wurde
das Instrument durch die Erbauerfirma generalsaniert. Es hat heute 51
Register auf drei Manualen und Pedal. 2014 fand auf Initiative des
jährlich an der Orgel stattfindenden Orgelfrühlings eine
Generalsanierung durch die Firma Rieger statt.
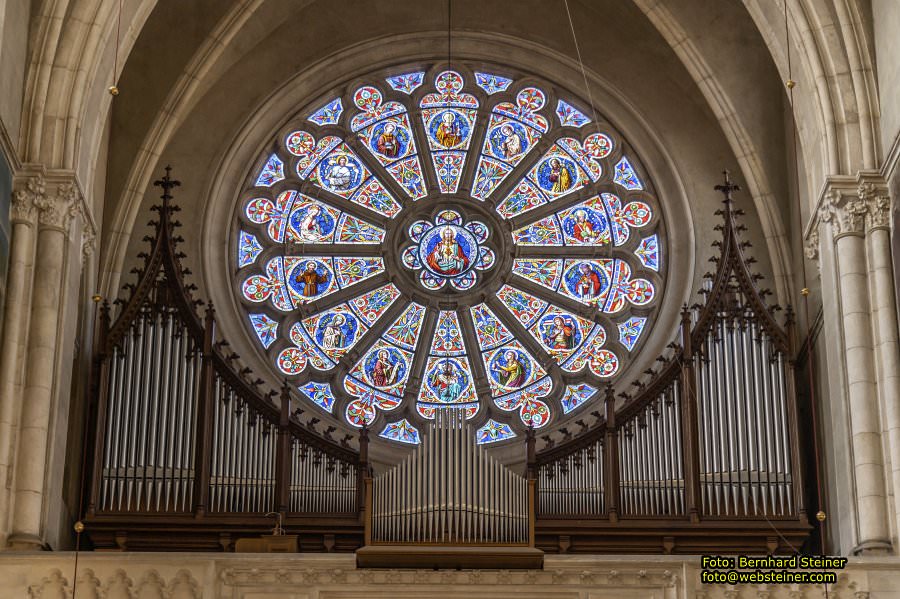
Durch eine breite Stufenanlage wird der Sockel eines großen Spitzbogens
am Übergang zum Presbyterium gebildet. Durch ein höheres Fußbodenniveau
als im Schiff und durch ein wenig abweichende Materialwahl wird die
Altarzone hervorgehoben.
Der neue, von Gustav Troger gestaltete Altar

Im Zuge der Vorbereitung auf die Hundertjahrfeier der Kirche im Jahr
1991 kam es zu einer Neugestaltung der Altarzone der Kirche. Im Sinn
der Liturgiereformen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde, um den
ursprünglichen Hochaltar unverändert erhalten zu können, ein kleinerer
zusätzlicher Altar auf einem vorgelagerten, vom Architekten Heinrich
Tritthart entworfenen Podium errichtet. Dieser sogenannte Volksaltar
wurde nach einem Entwurf des steierischen Künstler Gustav Troger
angefertigt, so wie auch ein neuer Ambo und gläserne Kerzenleuchter.

Der ursprüngliche, dem Herzen Jesu geweihte Hochaltar ist als
Baldachinaltar gestaltet. Im vorderen Giebelfeld des Altarbaldachins
ist ein von einer Dornkrone umwundenes Herz zu sehen, und ein
durchbrochener Dachaufsatz birgt die Statue des auferstandenen, auf
sein geöffnetes Herz weisenden Erlösers.
Das Herz-Jesu, Symbol der göttlichen Liebe

KANZEL
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter
Als Zentrum der Wortverkündigung aus optischen und akustischen Gründen
im Bereich der vorderen Bankreihen errichtet. Die oktogonale Kanzel
ruht auf einer stärkeren Mittelsäule (Grisignana-Bianco,
Hippuriten-Kalksandstein, Buje) und sieben schlanken Außensäulen
(Lienbacher Kalk, Adnet / Hallein) die auch die leicht ausgerundete
Kanzeltreppe tragen. Die Brüstung des Aufganges ist in Maßwerkform
durchbrochen, in den Feldern der Kanzelbrüstung Reliefbüsten der vier
Evangelisten mit ihren Symbolen. Der Antritt zur Kanzeltreppe ist durch
eine Fiale betont und mit einem geschmiedeten Gitter verschließbar.
Über der Kanzel der ebenfalls oktogonale Schalldeckel, mit
krabbenverzierter vergoldeter Metallkonstruktion. An den Ecken sechs
Engelstatuen mit einem Spruchband: „Discite a me quia, mitis sum et
humilis corde“. „Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig
von Herzen“. (Matth. 11,29)
An der Unterseite des Schalldeckels Metallappliken und die Taube als Symbol für den hl. Geist.

FRANZ-XAVER-KAPELLE
Altar (errichtet 1894)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter
Tischlerarbeit: J. Roßmann
Stifter: Infant Don Alfonso mit Marie de las Nives
Reliquien: S. Petri et Pauli et S. Francisci Xav.
Der in der Form gotischer Reliquienschreine geschnitzte Altaraufsatz
ruht auf einem niederen Unterbau (Kalk Ungarischrot, Sütte). Als
mittlere Figurengruppe der hl. Franz Xaver, einen Inder taufend, links
der hl. Ildefons, rechts der hl. Antonius von Padua. Die Relieffelder
zeigen den hl. Franz Xaverals Prediger (links) und den Tod des hl.
Franz Xaver (rechts), vier kleine Brustreliefs die Heiligen (v.l.n.r.)
Ferdinand, Elisabeth, Peter und Ignaz, in der Mitte das Wappen des
Stifters mit dem Schriftband „Alfonso de Borbon y Austria-Este, Infante
de Espana“. Im Sprengwerk des Altarschreines die Statue des hl. Jakob.
Über der Mensa fehlen das Kreuz und die Statuen der Heiligen Johannes,
Maria, Isidor und Barbara.
Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1906, Ausführung J. Lukesch) über der
Kanzeltreppe zeigt Gott als Weltenlehrer auf dem Thron, umgeben von den
sieben Leuchtern aus der Apokalypse und den Emblemen der vier
Evangelisten. Im unteren Teil des Bildes die Apostelfürsten Petrus und
Paulus und die vier großen Kirchenlehrer, St. Gregorius Magnus und St.
Ambrosius (links). St. Augustinus und St. Hieronymus (rechts). Auf den
emporführenden Stufen die Inschrift: „Mehrmals und auf verschiedene
Weise hat einst Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet, am
letzten hat er in diesen Tagen zu uns durch den Sohn geredet (Hebr.
1,1). Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht“
(Hebr. 111, 15).

JOSEFSKAPELLE
Altar (errichtet 1891)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: Jakob Gschiel sen.
Fassung: J. Wiwoda
Stifter: C. Hocevar, Krain
Reliquien: S. Andreae Apost., S. Matthaei Apost., Ex pallio S. Joseph
In der Mitte des mit drei Baldachingiebeln abgeschlossenen
Retabelaltares (Grisignana-Bianco, Hippuriten Kalksandstein, Buje) die
Statue des hl: Josef, flankiert von den Statuen der hl. Theresia
(links) und des hl. Alfons von Liguori (rechts). Die Relieffelder über
der Mensa stellen die Vermählung Mariens mit Josef (links) und die
Flucht nach Ägypten (rechts) dar.
Das Wandbild (Entwurf: K. Karger 1902, Ausführung M. Goldfeld) zeigt
den Tod des hl. Josef. Die Seitenwand ist mit einer, einen Wandteppich
vortäuschenden Bemalung (Entwurf: G. Hauberrisser) versehen.

MARIENKAPELLE
Altar (errichtet 1891)
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: H. Brandstetter
Stifter: Anton Decleva, Maria de Campi
Reliquien: S. Joachim, S. Anna, S. Lucae Evang., S. Agnetis V.M.
Retabelaltar (Kalkstein Grisignana-Bianco, Buie) mit zentraler
Marienstatue in der Darstellung der Unbefleckten Empfängnis. Die
Reliefdarstellungen darunter zeigen Szenen aus dem Alten Testament: Die
Verheißung des Erlösers im Paradies (links) und Judiths Heimkehr mit
dem Haupt des Holofernes (rechts). Den oberen Abschluss des
Altaraufbauesbilden die Statuen der drei Erzengel (v.l.n.r.) Gabriel,
Michael und Raphael.
Der kleine 4/6 Chorschluss der Marienkapelle ist mit drei figuralen
Fenstern versehen. Die zwei Medaillons zeigen Maria in Freude und Leid
mit ihrem göttlichen Sohn. In den ornamentalen Hintergrund sind
Lilienblüten eingebunden. Das dritte figural gestaltete Fenster enthält
in den Medaillons marianische Symbole. (Stifter: Andreas Krainz,
Theresia Hohenlohe, Stefan Irsch)
Die Sockelwände sind mit einer, textile Wandteppiche vortäuschenden Bemalung nach dem Entwurf von G. Hauberrisser versehen.

Das Wandgemälde (Entwurf: K. Karger 1901, Ausführung: M. Goldfeld,
Stifter: Maria de Campi) stellt die Krönung der Muttergottes dar.
Darunter das Gebet „Salve regina...“

In Erinnerung an den größten Förderer des Kirchenbaues, beim Eingang in
die Taufkapelle links das Epitaph des Grafen Leopold Baron von
Lilienthal (* 23. 12. 1811, + 30. 11. 1889) der sein nicht
unbeträchtliches Vermögen für die Errichtung der Herz-Jesu-Kirche zur
Verfügung gestellt hatte und ohne dessen Hilfe der Bau der
Herz-Jesu-Kirche wohl nicht zustande gekommen wäre. Lilienthal
unterstützte auch andere diözesane Bauvorhaben dieser Zeit mit
finanzieller Zuwendung. Das Hochrelief von Hans Brandstetter zeigt
Lilienthal betend vor dem Gekreuzigten.
Baron Lilienthal, der große Förderer des Baues der Herzesu-Kirche, erlebte die Vollendung der Kirche nicht mehr.

TAUFKAPELLE
Entwurf: G. Hauberrisser
Bildhauerarbeiten: Jakob Gschiel sen.
Das Baptisterium im Turmgeschoß wird durch das auf einem Stufenunterbau
errichtete Taufbecken (Kainacher Marmor) mit darüber befindlichem
Baldachin, beherrscht. Um den Eintritt des Getauften in die
Gemeinschaft der Kirche zu verdeutlichen ist das Taufbecken von einer
Brüstung (Kalk Grisignana-Bianco, Buje) auf Säulen (schwarz-gelber
Kalkstein, Port d‘Oro bei La Spezia) umgeben. Das Taufbecken selbst ist
durch eine reliefierte Holzabdeckung vor Verunreinigung geschützt.
Neben dem Taufstein ein Tabernakel zur Aufbewahrung derheiligen Öle.
Der giebelförmige krabbenbesetzte Baldachin mit Kreuzblumen (Kalk
Grisignana-Bianco, Buje) wird von auf Konsolen ruhenden Säulen
(Knollenkalk, Veronarot) getragen. An der Rückwand des Baldachins die
reliefierte Darstellung der Taufe Jesu im Jordan, an der höchsten
Stelle der Kapelle, im Gewölbeauge die schwebende Taube als Zeichen des
Heiligen Geistes.

Die Fernsterverglasung zeichnet sich durch ihren starken Symbolgehalt
in Beziehung zur Taufe aus. Das Fenster im Blickfeld beim Eintritt in
die Kapelle zeigt im Dreipass den heiligen Geist in Taubengestalt, der
die Taufunschuld verleiht. Taufsymbole bilden die aufstrebenden Lilien
als ornamentaler Hintergrund und die sechs Bilddarstellungen: Der Fisch
des Jonas mit dem Regenbogen des Friedens, der zur Sonne aufstrebende
Adler, der Brunnen der Wiedergeburt, der Leuchter der heiligmachenden
Gnade, das Lamm auf der guten Weide und der Hirsch an der
Wasserquelle.
Das Fenster gegenüber dem Taufbrunnen führt die
Auswirkungen des Taufsakramentes vor Augen. Der Baum der Erkenntnis
umgibt die einzelnen Bildmedaillons: Im Dreipass das siegreiche Kreuz
mit dem Mond - dem Heidentum, und der Sonne - dem Christentum. Himmel
statt Hölle, dem Gericht entrissen durch das Kreuz und die
Auferstehung zum ewigen Leben sind die Symbolinhalte der sechs Medaillons.

GRÖSSENORDNUNG
Turmhöhe bis zur Kreuzspitze: 109,60 m über Baugrundniveau
Oberkirche: Schiffbreite 13 m, Schifflänge 43,5 m, Gesamtlänge 62 m, Gesamtbreite (mit Kapellen) 23,60 m, Scheitelhöhe 24 m
Unterkirche: Breite 13 m, Länge 47 m, Scheitelhöhe 6 m, Fußboden 1,75 m unter Niveau

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: