web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Graz Museum Schlossberg
Museum am Grazer Schloßberg, August 2024
Im Graz Museum Schlossberg gibt es nicht nur den schönsten und weitesten Blick auf die Stadt, hier erfährst du auch alles über die Geschichte des Grazer Hausberges. Auf einem interaktiven Bildschirm kannst du in historische Bilder eintauchen, ein multimediales Schlossberg-Modell in der unterirdisch gelegenen Kasematte gibt Einblick in das Innere des Berges mit seinem Stollensystem. Im Wundergarten mit schattenspendenden Hainbuchen können Kinder die Geschichte der Fabelwesen erkunden, die auf dem Schlossberg beheimatet sind.

Uhrturm - Herrscher über die Zeit
Schon im Mittelalter befand sich am südlichen Rand der Burganlage ein
Wachturm. Der heute 29 Meter hohe Turm erhielt im 16. Jahrhundert fast
zeitgleich mit dem Landhaus und der Burg eine erste Uhr. Neben
hölzernen Wehrgängen und einem steilen Zeltdach prägen seine
Erscheinung übergroße, aus allen Himmelsrichtungen sichtbare
Ziffernblätter mit Stunden- und Viertelstundenzeiger. Er hatte keine
militärische Bedeutung, sondern war Feuerwachturm und Zeitgeber. Die
Grazer*innen stellten ihre Uhren nach seinem 12-Uhr-Schlag. So setzte
sich für den Magistrats- oder Bürgerturm genannten Bau die Bezeichnung
Uhrturm durch. Von der Bürgerschaft vor der Sprengung gerettet, wurde
er schließlich zum Wahrzeichen von Graz.

Der schwerste Kerker der Monarchie
Kaiser Josef II. erklärte Graz 1782 zur offenen, unbefestigten Stadt.
Die Festung verlor gänzlich ihre militärische Funktion. Auf dem
Schlossberg hatten sich schon immer Kerker befunden. Aus politischen
oder religiösen Gründen Inhaftierte befanden sich im Hauptmannsgebäude
und im Glockenturm. Nun wurde die gesamte Anlage zum Staatsgefängnis
umgebaut. Schwerverbrecher*innen wurden in den Kellern und Kasematten
angeschmiedet, erlitten Hunger und Torturen. Sie wurden jedoch schon
1809 verlegt, als Napoleons Truppen auf Graz marschierten. Nach der
Schleifung der Festung waren von den Gebäuden nur noch Ruinen übrig. In
den 1930er-Jahren wurde in dem verfallenen zweigeschoßigen Keller des
Hauptmannsgebäudes eine als „Kasematte" bezeichnete Freilichtbühne
eingerichtet, die noch heute genutzt wird.

Genießen Sie im Graz Museum Schlossberg die schönste und weiteste
Aussicht auf die Stadt Graz. Auf einem interaktiven Bildschirm in der
Kanonenhalle kann dabei nicht nur das Rad der Zeit zurückgedreht,
sondern auch in historische Stadtbilder eingetaucht werden. In der
Ausstellung wird alles über die bewegte Geschichte des Schlossberges
erzählt. Und im unterirdisch gelegenen Gewölbe der Kasematte gibt ein
multimediales Schlossbergmodell Einblicke in das Innere des Berges mit
seinem kilometerlangen Stollensystem.


WIR* wird zu MIR* - im Graz Museum Schlossberg
WIR* wird zu MIR* - eine Reise zum Thema Frieden durch die Stadt Graz
MIR* eine sichtbare Fackel, ein Objekt als „Redestab", das von Ort zu
Ort reist und so zum Teil des Stadtbildes wird. Immer wieder tauchen
die Buchstaben auf, für kurze Momente, für mehrere Wochen, als
leuchtend-großer Schriftzug oder kleines Abbild davon, an oder in
Institutionen, im öffentlichen Raum oder in privaten Wohnzimmern.
Flankiert von Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, Vorträgen,
Ausstellungen und Performances über Frieden.
Die Idee ist aus der aktuellen Zeit geboren. Was kann man heutzutage
tun, um der Ohnmacht zu begegnen? Wie reagieren auf multiple Krisen,
auf Kriege? Wie in der Kunst agieren? In einer Mikrowelt wie Graz?
Kulturinstitutionen, Vereine und Partner innen machen es sich zur
Aufgabe, mit den Mitteln der Kunst und des Diskurses den Frieden in den
Fokus zu rücken, das Wort zurückzuerobern und neu zu besetzen. Ein
offener Dialog, der Menschen vereinen soll. Den Auftakt machte im
Februar das Schauspielhaus Graz, weitere Partner*innen sind HDA Haus
der Architektur, Kunsthaus Graz, manuskripte, Oper Graz, Schaumbad
Freies Atelierhaus Graz, Steiermärkische Landesbibliothek, Theater im
Bahnhof, TU Graz (Institut für Wohnbau).

Die Kanonenhalle
Die Grazer Bevölkerung wurde bis in die erste Hälfte des 18.
Jahrhunderts mit einer Alarmglocke von der Stallbastei vor Bränden
gewarnt. Sie befindet sich noch heute auf dem Dach dieser Halle. Damals
wurden in der Kanonenhalle die „Vier Evangelisten" aufgestellt und
später durch sechs kleinere Geschütze ersetzt. Damit alarmierte der im
Kanonierhaus stationierte Feuerwächter die Stadt, wobei die Anzahl der
Schüsse anzeigte, in welchem Viertel ein Brand ausgebrochen war. Noch
bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden bei Feuer Kanonenschüsse
abgegeben, wodurch die Stallbastei die Namen „Kanonenbastei" und
„Alarmbatterie" erhielt. Die Kanonen, die heute hier zu sehen sind,
wurden bei der Einrichtung des Garnisonsmuseums 1981 aufgestellt.
Zwei Regimentsgeschütze, 17./18. Jh. (Wandlafetten 1740er-Jahre;
Geschützrohre vermutlich Dreißigjähriger Krieg, 1618-1648), Holz,
Eisen, Leder Familie Arbesser-Rastburg
Zwei französische Feldkanonen, 18./19. Jh. (Geschützrohre 1792/93,
erbeutet von der österreichischen Armee in den Napoleonischen Kriegen),
Holz, Bronze, Eisen, Leder Stadtgemeinde Bruck/Mur


Paulus Fürst: Abbildung der Vornehmen Festung und Statt Gratz in der Steyermarkt, 1667
Kupferstich auf Papier, Reproduktion, Original: 31,5 x 40,5 cm, Graz Museum

Der hl. Thomas ist einer der zwölf Apostel.
Er trägt die Beinamen „Zwilling" (von Jesus Christus), „Zweifler" und
„ungläubiger Thomas", da er die Auferstehung Christi zunächst
anzweifelte. Auf diesem Altarblatt ist er mit flammendem Herzen
dargestellt, das symbolisch für die Gottesliebe steht. Auch auf den
Altaraufsätzen sind Heilige zu sehen: links Michael und Thomas, rechts
Johannes der Täufer und Josef.
Unbekannt: St. Thomas, Ende 17. Jh. Öl auf Leinwand Graz Museum
Unbekannt: Altaraufsätze der Thomaskapelle, 17. Jh., übermalt im 19.
Jh. Holz, bemalt, vergoldet und versilbert; Zinn, Graz Museum

Hackher-Löwe - Triumphzeichen eines Verlustes
Nach der Kriegserklärung des österreichischen Kaiserreiches gegen
Frankreich im April 1809 befahl Erzherzog Johann die Befestigung und
Bemannung der Schlossberganlage. Unter dem Kommandanten Major Franz
Hackher zu Hart zog eine Garnison von 913 Mann ein. Während die Stadt
am 31. Mai kampflos übergeben worden war, wurde die Übergabe des
Schlossbergs verweigert. Französische Truppen versuchten, ihn mit
Sturmangriffen und Artilleriebeschuss einzunehmen - ohne Erfolg. Nach
der Niederlage der österreichischen Truppen bei Deutsch-Wagram musste
am 23. Juli jedoch auch die Schlossbergfestung aufgegeben werden. Die
Franzosen befahlen ihre Schleifung. Anfang 1810 standen nur noch der
Uhrturm, der Glockenturm und die Thomaskapelle. Major Hackher wurde
dennoch als Held gefeiert. Ein Jahrhundert später wurde ihm auf dem
obersten Schlossbergplateau ein Denkmal errichtet: der Hackher-Löwe.
Zum 100-jährigen Gedenken an die Schlossbergverteidigung entwarf der
Bildhauer Otto Jarl 1909 ein Denkmal zu Ehren Major Hackhers. Es zeigt
einen zum Angriff gegen Nordwesten sprungbereiten Löwen. 1943 wurde es
als „Adolf-Hitler- Metallspende" eingeschmolzen. Später entschied sich
die Grazer Bevölkerung für eine Wiederherstellung des alten Denkmals
durch Wilhelm Gösser. Der neue Löwe in alter Gestalt wurde 1966
eingeweiht.
Otto Jarl: Entwurf für das Löwen-Denkmal Major Hackhers auf dem Schlossbergplateau, o. J.
Ton, glasiert, Graz Museum

Blick gegen Westen

Schlossbergbahn - Technik im Einklang mit der Natur
Die Nutzung des Schlossberges als Ausflugsziel verlangte nach neuen
Wegen auf den Berg und nach Gastronomieangeboten. 1887 begannen
Untersuchungen für eine Standsellbahn und unterschiedliche
Trassenführungen mit dem Ziel, das Landschaftsbild weitgehend zu
bewahren. Der Gemeinderat beauftragte einen privaten Investor, die
Trasse am steilen Westhang anzulegen, wo sie vom Kaiser-Franz-Josef-Kai
bis auf das Plateau beim Glockenturm führt. Sie überwindet eine
Steigung von 60% und einen Höhenunterschied von fast 110 Metern. 1894
wurde die mit Dampf betriebene Schlossbergbahn für Fahrgäste
freigegeben und an der Bergstation das Schlossbergrestaurant eröffnet.
Seit der Elektrifizierung um 1900 wurde die Bahn wiederholt technisch
adaptiert. Heute ist sie eine moderne Standseilbahn mit verglasten
Wagen und barrierefreien Zugängen.
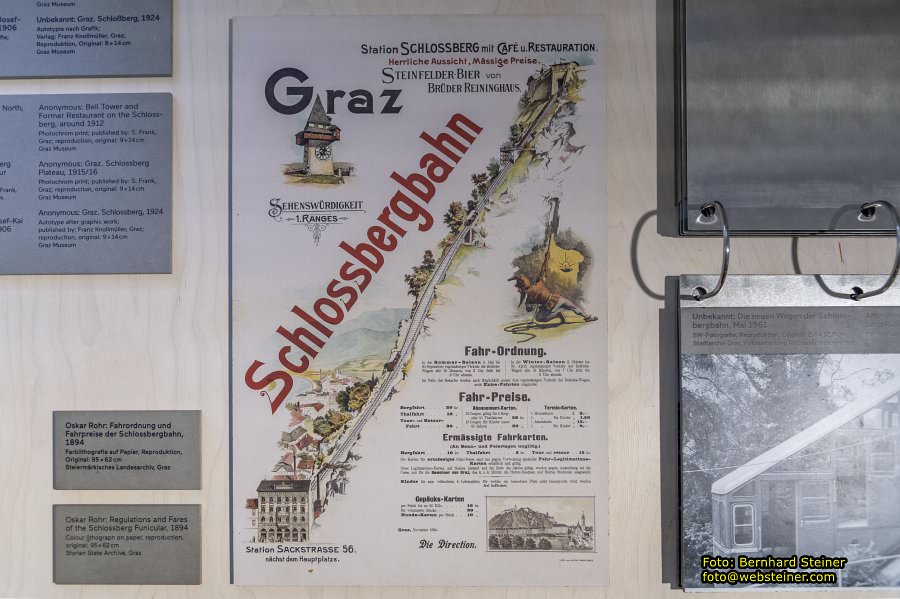
Der Schlossberg als Burg und Festung
Die Bedeutung der Stadt Graz war eng mit ihrer militärischen Funktion
und diese mit dem Schlossberg verknüpft. Auf dem Schlossberg befand
sich vermutlich seit dem 8. Jahrhundert eine Burg. Sie schützte den
Marktplatz, aus dem 1180 der politische Mittelpunkt des neu
geschaffenen Herzogtums Steiermark und die zeitweise Residenz der
Herrscher des Heiligen Römischen Reiches wurde. Unter Kaiser Friedrich
III. erfuhr Graz im 15. Jahrhundert eine Blütezeit und die Burg am Berg
wurde zum „Schloss". Im 16. Jahrhundert fand die nachhaltigste
Veränderung statt: Der Herrschersitz wurde zu einer befestigten
Militäranlage aus- gebaut. Nun hatte der Schlossberg nicht nur die
Stadt zu schützen. Er war auch Teil einer europäischen Kette von
Festungen, die gegen die Expansion des Osmanischen Reiches errichtet
wurde. Die Grazer Schlossbergfestung wurde jedoch bis zu den
Napoleonischen Kriegen 1809 niemals angegriffen. Die Folge dieser
einzigen militärischen Auseinandersetzung um den Schlossberg war die
Schleifung seiner Festungsbauten. Damit begann die Umgestaltung des
Schlossberges in seine heutige Gestalt.


Ägyptisches Tor - Sehnsucht nach elysischen Gefilden
In der südlichen Festungsmauer der Stall- oder Kanonenbastei befindet
sich das sogenannte Ägyptische Tor zur Kasematte. Das markante
Steinportal mit Rundpfellern geht auf den Juristen und
Ziegelfabrikanten Bonaventura Hödl (1776-1848) zurück. Dieser erwarb
gemeinsam mit seiner Frau Karoline um 1820 ein Grundstück unterhalb der
Bastei und mietete auch die Kasematte. Das Ehepaar gehörte somít zu den
ersten Privatpersonen, die am Schlossberg über Besitz verfügten. Ihre
Gartengestaltung mit Lauben und exotischen Pflanzen ist Sinnbild für
eine nach der verklärten Heiterkeit und Harmonie des „Südens"
gerichteten bildungsbürgerlichen Sehnsuchtskultur. Ende des 19.
Jahrhunderts wurde der Zugang zum Portal mit einer Pergola versehen,
wodurch die viel zitierten „hängenden Gärten von Graz" entstanden.

Stall- oder Kanonenbastei - Monument des Bollwerks
Das Graz Museum Schlossberg befindet sich auf der 1547 fertiggestellten
Stallbastai, die heute den charakteristischsten Überrest der einstigen
Festung bildet. Zu ihren Bereichen gehören ehemalige Wirtschafts- und
Militärbauten - wie die Kasematte, die auch als Lager und Kerker
diente. Als Verbindung der Kasematte mit den darüberliegenden Räumen
haben sich runde Dampfluken erhalten, die der Entlüftung und später der
Versorgung der Gefangenen dienten. Nach 1809 wurde ein neuer
Gebäudeteil angebaut. Kanoniere schlugen bel Feuer mit Kanonenschüssen
Alarm, wodurch die Bastei ihren zweiten Namen erhielt: Kanonenbastei.
Von hier aus sowie vom Glocken- und Uhrturm überblickten die
Feuerwächter die Stadt und warnten mittels Glockengeläut, Laternen,
Fackeln und Körben vor Bränden. Von 1981 bis 2012 befand sich hier das
Garnisonsmuseum.

Auf einem Hügel gelegener mittelalterlicher Uhrturm des 13. Jh. mit Garten und Panoramablick auf die Stadt.

Die Glocken des Uhrturms
Stundenglocke
Durchmesser: 108 cm
Gegossen 1382 von Johannes von Rottesberg, älteste Glocke von Graz
Viertelstundenglocke
Durchmesser: 42,5 cm
Gegossen um 1450
Weitere Namen: Angelusglocke
(Gottesfriedenläuten, d. i. im Mittelalter ein zeitlich begrenzter
Frieden, beispielsweise zu Marktzeiten), Armesünderglocke (Läuten bei
Hinrichtungen), Lumpenglocke (Läuten zur Sperrstunde)
Feuerglocke
Durchmesser: 90 cm
Gegossen 1645 von Andreas Schreiber

Denkmal des Infanterieregiments Nr. 27 - Wächter am Schlossberg
Der Schlossberg ist ein Ort der Erinnerung, an dem auf verdichtete
Weise durch Monumente und Veranstaltungen an historische Ereignisse und
Persönlichkeiten gedacht wird. Die Errichtung eines Denkmals für das
k.u.k. Infanterieregiment Nr. 27 „König der Belgier" war von einer
Debatte über Erinnerungskultur begleitet. Das Grazer Hausregiment war
während des Krieges gegen Frankreich 1809 Teil der Armee von Erzherzog
Johann in Norditallen, und die Versorgungstruppen verteidigten mit
Major Hackher den Schlossberg. Zum 250. Gründungsjubiläum anno 1932
plante das Regiment eine Heldenstatue am zentralen Platz beim Uhrturm.
Die sozialdemokratische Stadtverwaltung forderte den Verzicht auf
deutliche kriegerische und militante Darstellungen. Der Künstler
Wilhelm Gösser schuf schließlich eine schlichte monumentale Figur, die
nach dem Regimentsspruch „Furchtlos und treu" schützend über die Stadt
wacht.

Der Schlossberg als Landschaft und Naherholungsgebiet
Mit der Sprengung der Militäranlagen 1809 verlor Graz den Charakter
einer Festungsstadt. Vormals Sperrgebiet, wurde der Schlossberg dem
Land Steiermark übergeben und eine öffentliche Parkanlage. Neben den
Initiativen des Landes gestalteten auch Bürger*innen, die Grundstücke
erworben hatten, das Landschaftsbild. Üppige Gärten mit exotischen
Pflanzen und Alleen, romantische Lauben und neue Bauten wurden
geschaffen. Der Berg wurde zu einer idyllischen Sehnsuchtswelt mitten
in einer sich nach und nach industrialisierenden Stadt. Nach politisch
und wirtschaftlich unruhigen Jahrzehnten stand die Naturidylle am
Schlossberg für den Wunsch nach Ruhe und Frieden. Nur in den
Revolutionsjahren um 1848 wurde der Berg noch einmal militärischer
Stützpunkt, und im Zweiten Weltkrieg wurde in seinem Inneren eine
Stollenanlage als Zuflucht bei Luftangriffen errichtet. Seit er Ende
des 19. Jahrhunderts in den Besitz der Stadt übergeben worden war,
entstanden Aussichtsplätze, Gaststätten und eine Bahn auf den Berg.
Schließlich wurde der Schlossberg das zentrale Naherholungsgebiet und
geschützte Landschaftsgebiet, das er heute noch ist.

260 Stufen führen als Zick-Zack-Weg vom Schlossbergplatz den Felshang
hinauf zum Uhrturm. Die Schlossbergstiege ist eine von vier
Aufstiegsmöglichkeiten auf den Grazer Schlossberg. Sie wurde von
Kriegsgefangenen des ersten Weltkrieges in den Fels gehauen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: