web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Hainburg an der Donau
Industrieviertel (NÖ), Mai 2023
Hainburg an der Donau ist eine Stadtgemeinde im
Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich und liegt an der Donau
zwischen Wien und Bratislava im Industrieviertel. Im Nordosten der
Stadt bildet die Donau die Grenze zur slowakischen Hauptstadt
Bratislava. Einen Grenzübergang nach Bratislava gibt es von Hainburg
nicht. Des Weiteren ist Hainburg die östlichste Stadt Österreichs.

Fischertor
Viergeschoßiger Torturm aus dem 13. Jhdt., Durchbruch der Torhalle und Umbauten im 15. u. 16. Jhdt
Das Fischertor, kleinstes und jüngstes Stadttor Hainburgs war im
Mittelalter die einzige Verbindung zur Donauufersiedlung und zur Donau.

Kapelle beim Fischertor — Diese wurde 1780 zur Erinnerung an die Opfer
des Türkensturms 1683 errichtet. Von mehr als 8000 Menschen in Hainburg
(ca. 4000 Einwohner und ebenso viele Flüchtlinge aus der Umgebung)
überlebten nur etwa 100 die Eroberung der Stadt.

Dem Andenken der am 12. Juli 1683 nach Erstürmung der Stadt von den Türken niedergemetzelten Einwohner Hainburg's. (sic!)
Errichtet anlässlich der Feier des 1000 jährigen Bestandes der Stadt Hainburg 1894.

Blasonierung: „In Blau auf einem grünen Schildfuß in natürlicher
Farbgebung ein goldener schreitender rücksehender Löwe mit erhobener
rechter Pranke, hinter diesem links aus dem Schildfuß wachsend ein
silberner, schwarz gefugter, gezinnter Butterfassturm mit geschlossenem
steingefassten Portal im Unterbau und schwarzem Fenster über zwei
ebensolchen Rundöffnungen im Aufsatz.“

Beim Umbau des ehemaligen Gasthauses (1979), bestehend aus 3 Häusern
(Bausubstanz stammt aus dem 14. Jhdt.), stieß man in der Fassade auf
eine gotische Fenstergruppe. Die Verzierung des Mittelfensters „Rotes
Kreuz auf weißem Grund” lässt darauf schließen, dass hier ein Stadtsitz
des St. Georg Ritterordens war.

Die Mariensäule, die wohl schönste Rokokosäule Niederösterreichs, wurde
1749 von der Stadtrichterswitwe Elisabeth Oppitz gestiftet.

Mariensäule: 1749 von Martin Vögerl errichtet, eine Rokokosäule

Die Stadtpfarrkiche ist seit 1236 als „Jakobskirche” (Pilger und
Händelkirche) urkundlich belegt. Um 1628 wurde sie als Philipp und
Jakobskirche zur Stadtpfarrkirche. Nach dem Brand von 1683 erfolgte die
Wiedererrichtung im barockem Stil.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Hainburg an der Donau steht in der
Mitte des Hauptplatzes der Stadtgemeinde Hainburg an der Donau im
Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Die auf die Heiligen
Philippus und Jakobus geweihte Pfarrkirche gehört zum Dekanat Hainburg
im Vikariat Unter dem Wienerwald der Erzdiözese Wien.

Mit 1236 ist eine Jakobs- und Katharinenkapelle urkundlich genannt,
welche um 1400 mit einem Chor erweitert und 1628 urkundlich zur
Pfarrkirche erhoben wurde. Die frühbarocke Saalkirche mit niedrigen
Querhausarmen und einem im Kern gotischen Chor wurde 1685 geplant und
vor 1706 vollendet. Der im Osten angebaute Kirchturm wurde 1756 mit
Mathias Gerl errichtet.


Der Hochaltar aus 1713 nach einem Entwurf und mit einem Altarbild von
Hans Michael Beckhl entstand mit den Bildhauern Mathias Roth und
Jeremias Weißkopf.

Die Orgel aus 1982 ist vom Orgelbau Reinisch-Pirchner. Es gibt eine
sogenannte Türkenglocke von Ignaz Hilzer aus 1865, ein Umguss der
ehemaligen Glocke aus 1685.


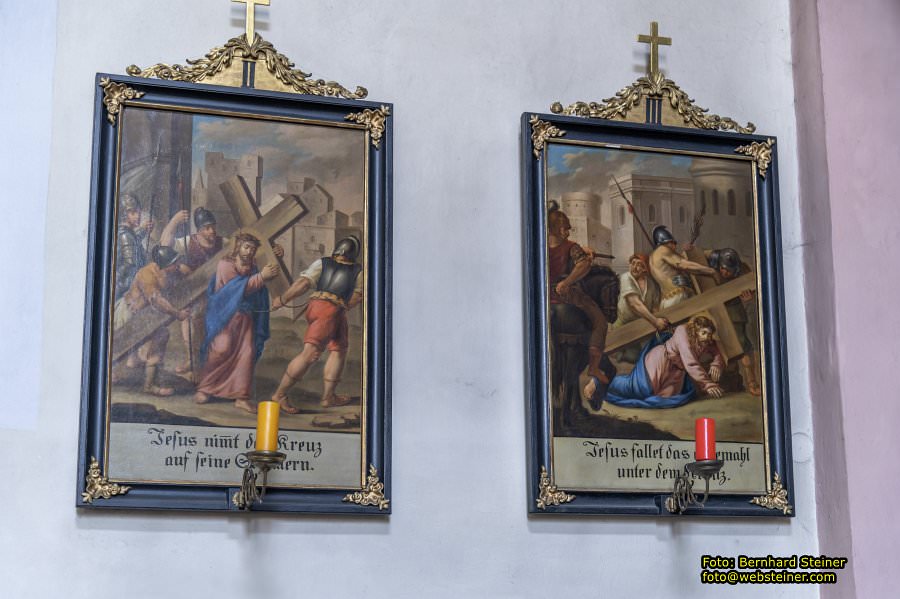

Am Vorplatz der Kirche befindet sich eine im Jahr 1749 errichtete
Rokokosäule. Gestiftet wurde die Mariensäule von Elisabeth Oppitz. Die
vier Seiten zeigen Reliefs, die Szenen aus dem Marienleben darstellen.

Wienerstraße 19, 2410 Hainburg an der Donau

Das Wienertor, markantes Wahrzeichen der Stadt, ist das größte
mittelalterliche Stadttor Europas. Die Entstehung der baugeschichtlich
höchst interessanten Torburg wird in zwei Etappen datiert. Der untere
Teil wurde in der ersten Hälfte des 13. Jhdt von der Babenbergern
errichtet, der obere Teil durch Ottokar von Böhmen in den Jahren
1267/1268.

Das Wienertor, auch Wiener Tor, ist ein Teil der Stadtbefestigungen von
Hainburg an der Donau. Es gilt als das größte erhaltene Stadttor aus
dem Mittelalter in Europa.
Das Wienertor geht vor allem auf zwei große Bauphasen des 13.
Jahrhunderts zurück, in denen ein hochrepräsentatives Doppelturmtor
errichtet und danach monumental überbaut wurde. Bereits das
Doppelturmtor war in eine der Stadtmauer vorgelegte Zwingeranlage
eingebunden. Sein Bautypus verweist ebenso wie der dossierte Sockel,
die Fallgatter und die übermannshohen „Schießscharten“ auf Anregungen
durch französische Befestigungsarchitektur. Die Werksteine der Quader-
bzw. Buckelquaderschalen sind zumindest teilweise aus römischen Spolien
gearbeitet.

Johannes Nepomuk Kapelle, Landstraße 3, 2410 Hainburg an der Donau

Der Pfarrhof wurde 1738 im spätbarocken Stil errichtet und um 1800
umgebaut. Besonders ist, dass dieser ca. 250 m von der Pfarrkirche
entfernt liegt.

Pranger der Stadt Hainburg a.d.D. auf der Freyung
'Schandsäule' in Verwendung bis 1756. Ursprünglicher Standort bei der Kirche am Hauptplatz.

Der romanische Karner stammt aus dem ersten Viertel des 13. Jhdt’s. Im
Untergeschoß war das Beinhaus, im Obergeschoß ein Altarraum für
Totenmessen.

Evangelische Martin Luther-Kirche in Hainburg an der Donau
Wolf Prix von COOP HIMMELB(L)AU entwirft evangelische Kirche
Einen besonderen Akzent aktueller Kirchenarchitektur hat die
historische Stadt mit dem evangelischen Kirchenneubau in der Alten
Poststraße 28 im Zentrum von Hainburg erfahren. Mit dem aus Hainburg
stammenden Architekten Wolf D. Prix (COOP HIMMELB(L)AU) hat sich einer
der weltweit renommiertesten Baukünstler Österreichs den
architektonischen und künstlerischen Herausforderungen des Kirchenbaus
heute gestellt.
Die Martin Luther-Kirche besteht aus einem Gottesdienstraum, einem
Gemeindesaal, einem Glockenturm sowie weiteren Büro- bzw. Nutzräumen.
Der Kirchenbau auf dem Grundstück einer nicht mehr existierenden Kirche
ist formal an die Höhenentwicklung der unmittelbaren Umgebung
angelehnt. Dach und Glockenturm variieren die Formensprache des in der
Nähe stehenden romanischen Karners der ehemaligen Martinskirche. Die
eigenwillige Geometrie zeigt eine spirituelle Symbolik, wie beim
Gottesdienstraum, dessen Form sich von einem riesigen Tisch herleitet.
Drei große Lichteinlassöffnungen sind in die Dachkonstruktion
eingebaut, die auf den vier Stahlbetonsäulen ruht, den Beinen des
„Tisches". Wolf D. Prix hat beim Entwerfen des Kirchendachs besonderes
Augenmerk auf die atmosphärische Beleuchtung des Innenraums gelegt. Für
die Kirche steht jede Lichteinlassöffnung für eine Person Gottes und
ist so Zeichen der Trinität des christlichen Gottes.
Leider ist der Kirchenraum - wie so oft bei den Protestanten - verschlossen.

Johannes Nepomuk Brunnen, Hauptpl. 24a, 2410 Hainburg an der Donau

Bäckerei Gspandl, Hauptpl. 18, 2410 Hainburg an der Donau

Die Burgruine Schlossberg stammt in ihren ältesten Teilen aus der Mitte
des 11. Jhdt’s. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 begann der
Verfall der Burg auf dem Schlossberg.

Die Heimenburg (oder „Hainburg“) ist Ruine einer Höhenburg über der
Stadt Hainburg an der Donau in Niederösterreich. Sie hat ihren Namen
der Legende nach von Heimo, dem Mundschenk von Arnulf von Kärnten, der
diesen mit dem Bau einer Kirche und einer Burg (ursprünglich im
heutigen Bad Deutsch-Altenburg) beauftragte.

Ausblick von der Heimenburg auf Hainburg an der Donau

1042 wurde die Vorgänger-Burg in Bad Deutsch-Altenburg vom späteren
Kaiser Heinrich III. zerstört. Der Chronist Hermann von Reichenau
nannte damals die „Heimenburg (Hainburg) und Brezesburg (Pressburg)
sehr volkreiche Städte“. Heinrich III. verfügte jedoch um 1050 auf dem
Nürnberger Hoftag, die Heimenburg wieder aufzubauen, jedoch diesmal auf
dem Schlossberg im heutigen Hainburg.

Altes Kasernentor
Ehemaliges Haupttor der Marc-Aurel-Kaserne an der südlichen Stadtmauer
in Hainburg an der Donau (Niederösterreich) mit Blick von der Burg.
Markant sind Spitzbogen und aufgesetzte Zinnen.

Die östlichste Stadt Österreichs liegt an der Hainburger Pforte,
eingebettet zwischen der Donau, dem Braunsberg und den Hainburger
Bergen. Nach Hainburg verlässt die Donau Österreich. Am Horizont sind
die Kleinen Karpaten zu sehen. Hainburg an der Donau und die
umliegenden Berge sind seit Siedlungszeiten strategische
Schlüsselpunkte - der Arpad-Felsen auf der gegenüberliegenden Seite der
Donau-March-Mündung, der Braunsberg mit dem keltischen Wachturm und der
Schlossberg, an dessen Fuß Hainburg liegt.

Hainburg liegt auch zwischen der geografischen Grenze der Karpaten (zu
denen noch der Braunsberg zählt) im Osten und der Donau im Norden. Der
Braunsberg ist ein 346 m hoher Kalkstock. Der mit seinem schrägen
Plateau ungewöhnlich geformte Berg war ein Stadtberg der Kelten und
trägt noch deutliche Spuren der keltisch-römischen Zeitenwende.

Die Burg überwachte den Schiffsverkehr auf der Donau nahe der Grenze
zum Königreich Ungarn. Ab 1248 wohnte hier Margarete von Babenberg, die
Schwester von Friedrich II., Herzog von Österreich und der Steiermark,
und Witwe des römisch-deutschen Königs Heinrich VII. 1252 heiratete sie
in der Pankratiuskapelle der Hainburg Ottokar II. Přemysl, König von
Böhmen, Markgraf von Mähren. Er wollte sich damit Ansprüche auf das
Erbe der Babenberger sichern. Auf ihn gehen die Ausbauarbeiten des
Wohnturmes im Jahr 1260 zurück, er hielt sich oft auf der Burg auf.
Margarethe zog sich jedoch, nachdem sie Ottokar verstoßen hatte, 1261
auf die Burg Krumau am Kamp zurück, wo sie 1266 starb. 1282 gelangte
die Hainburg in den Besitz der Habsburger, die sie von Hauptleuten
verwalten ließen. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts waren die Burg
und die Herrschaft jedoch fast immer an Adelige verpfändet.

Blick auf die Andreas Maurer Brücke, Stopfenreuth

Mit seiner 2,5 km langen Stadtmauer, drei erhaltenen Toren und 15
Türmen aus dem 13. Jahrhundert besitzt Hainburg eine der ältesten und
am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Europas. Am südlichen Ende der
ringförmigen Stadtmauer erhebt sich der 290 m hohe Schlossberg mit der
mächtigen Burgfeste. Von hier aus eröffnen sich herrliche Ausblicke auf
das historische Hainburg.

Ausblick von der Heimenburg auf Bratislava. Gut erkennbar ist Most SNP (UFO Tower).

1619/20 hielt die Burg drei Belagerungen durch Gábor Bethlen stand. Bei
der Zweiten Türkenbelagerung 1683 wurde die Burganlage gestürmt. Damals
wurden angeblich 8.432 Bürger der Stadt und Flüchtlinge aus der
Umgebung, die hier Schutz gesucht hatten, niedergemetzelt. Zwischen
1629 und 1652 hatten die Bürger von Hainburg die Pfandschaft über die
Herrschaft inne. 1703 verkaufte sie Kaiser Leopold I. an den Grafen
Johann Jakob von Löwenburg, der sechs Jahre später die Burgkapelle
instand setzen ließ. Nach 1742 trat, bedingt durch die Errichtung des
neuen Schlosses am Fuß des Schlossberges, der Verfall der als Wehrbau
wertlos gewordenen Burg ein.



Der 4-eckige Schützenturm — genannt Halterturm — stammt ebenfalls aus dem 13. Jhdt. und ist der höchste Turm der Stadtbefestigung.
Theodorapalast: Herrschaftlicher Stadtsitz aus dem 13. Jhdt. („Schützenhof"). Reste eines dreigeschoßigen Saalbaues

Alte Poststraße beim Haydnplatz

Das Ungartor ist das östliche
und älteste der Hainburger Stadttore und wurde in zwei Bauphasen des
13. Jahrhunderts errichtet. An einem viergeschossigen, schräg zur
Stadtmauer gestellten Turm wurde eine nach oben hin offene Torhalle mit
Zinnenabschluss angebaut. Die mit zahlreichen Steinmetzzeichen
gearbeiteten Buckelquader (mit ziemlicher Sicherheit stammen diese aus
Carnuntum) beim Torbau lassen auf landesfürstliche Bautätigkeit unter
Leopold VI. um 1220/30 schließen. An der Stadtseite ist rechts oberhalb
des Tores ein besonderes Detail zu erkennen: Ein längerer Quaderstein,
dessen Buckel nach der Überlieferung einen „Lindwurm" darstellen
sollen, der auch in den Sagenschatz Hainburgs eingegangen ist, jedoch
vermutlich römischen Ursprungs sein dürfte.
An Feind- sowie Stadtseite war das Tor durch Fallgatter und Torflügel
zu verschließen. Eine gemauerte Stiege, neben der ein Zwingerportal zu
sehen ist, führt an der Stadtseite nördlich des Tores auf den Wehrgang
und ins 1. Obergeschoss, von dem ein Portal auf den bergseitigen
Wehrgang führte. An diese Seite sind die Reste eines Aufganges zu einem
vermauerten Einlaß ins Erdgeschoß des Turmes zu erkennen. Vermutlich
1265/66 durch König Ottokar II. umgebaut, es gibt Hinweise auf einen
hölzenen Außenwehrgang über der Torhalle. Für den heutigen
Kraftfahrzeugverkehr war das enge Tor leider nicht geeignet und es
wurde 1962/63 etwas nördlich die Stadtmauer durchbrochen und die
Preßburger Reichsstraße dort in die Ungarstraße geleitet.

Josef Haydn - Denkmal

Der 8-eckige Wasserturm
(Götzenturm) ist einer der beiden Ecktürme der nördlichen Stadtmauer,
der in mehreren Bauphasen als mächtiger Wehrturm im Zuge der
Stadtbefestigung in den Jahren 1220/1240 vermutlich von den Herren von
Rötelstein errichtet wurde. Ursprünglich hatte er drei Geschoße.
1240/1260 wurde ein weiteres repräsentatives Geschoß mit rundbogigen
Biforenfenstern aufgesetzt. Um 1939 bekam der Turm für militärische
Zwecke einen Holzaufbau mit pyramidenförmigem Dach.
In den Jahren 2008 bis 2014 erfolgte in mehreren Etappen die
Generalsanierung des Ensembles Wasserturm mit Gesamtkosten von rund €
330.000,00, die durch Sparkasse Hainburg Privatstiftung, Land
Niederösterreich, Bundesdenkmalamt, Kulturerbe-Gesellschaft
Mittelalterstadt Hainburg und Stadtgemeinde Hainburg an der Donau
finanziert wurde.

Donaudamm an der Donaulände


Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: