web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Hallein
im Tennengau, November 2024
Hallein ist eine österreichische Stadt mit über 21.000 Einwohnern im Tennengau im Bundesland Salzburg. Sie ist die Bezirkshauptstadt des Tennengaues und die zweitgrößte Stadt im Bundesland Salzburg. Hallein wird als Salinenstadt, Keltenstadt, Industriestadt, Schulstadt und als Kulturstadt bezeichnet.

Salinenkapelle im Pfleggarten - leider geschlossen
Die Pernerinsel war im Besitz des Fürsterzbischofs. Hier befand sich
der Pfleggarten, der erzbischöfliche Lustgarten und eine Kapelle. Diese
mittelalterliche Pflegkapelle, heute als Salinenkapelle bezeichnet,
wurde durch einen schlichten Bau des 17. Jahrhunderts ersetzt. Garten
und Kapelle waren durch einen privaten Steg direkt mit dem Gebäude der
Salinenverwaltung, dem heutigen Keltenmuseum Hallein verbunden.
Hinter der Salinenkapelle ist der Sitz des „Privilegierten
Uniformierten Bürgercorps der Stadt Hallein". Die Bürger von Hallein
erhielten 1287 viele Rechte zu denen auch die Pflicht gehörte die Stadt
zu verteidigen, die Befestigungen zu erhalten und die innere Sicherheit
und die Nachtwache zu organisieren. Heute pflegt die Bürgergarde diese
Tradition und repräsentiert bei öffentlichen Anlässen nach wie vor die
Halleiner Bürger. Traditionell hält die Halleiner Bürgergarde eine
Grabwache zum Gedenken an Franz Xaver Gruber, den Komponisten des
Liedes „Stille Nacht! Heilige Nacht!", am 24. Dezember ab. MusikerInnen
der Bürgercorpskapelle, die sein Sohn Felix von 1862-84 musikalisch
geleitet hat, begleiten die Grabwache.

Das „Privilegierte, Uniformierte Bürgercorps der Stadt Hallein“, in
weiterer Folge auch als „Halleiner Garde“, „Halleiner Gardekompanie“,
„die Garde“, „Bürgergarde“ oder „Bürgercorps“ bezeichnet, ist ein
Verein welcher aus ca. 50 aktiven Mitgliedern besteht. Hauptzweck des
Vereins ist, durch Paradeausrückungen kirchliche und weltliche Feste zu
verschönern.
Das Gründungsdatum wurde auf das Jahr 1278 festgelegt. Grundlage für
dieses Datum ist eine Weisung des regierenden Erzbischof (EB) Friedrich
der 2. von Walchen wonach sich Bürger (zur damaligen Zeit hat man unter
dem Begriff Bürger ausschließlich besitzende Einwohner bzw.
Stadtadelige verstanden) zur Verteidigung der Stadt zu bewaffnen
hatten. Dem voraus gegangen war das Recht durch den Kaiser, die Stadt
Salzburg zu befestigen. Im Land Salzburg waren zu dieser Zeit alle
Städte gleichberechtigt, somit erlangte auch Hallein das Recht, die
Stadt zu befestigen.

Das Keltenmuseum Hallein ist eines der größten Museen für keltische
Geschichte und Kunst in Europa. Auch die Urgeschichte Salzburgs und die
Stadtgeschichte Halleins werden hier lebendig. Die Kombination aus
eisenzeitlichen Gräberfeldern, Siedlungsflächen und dem Salzbergbau auf
dem Dürrnberg ist einzigartig in Europa. Begehbare Stollen, Einblicke
in Grabkammern, kunstvoller Goldschmuck – Kunst und Kultur der Kelten
werden im Keltenmuseum Hallein erlebbar. Das absolute Highlight: Die
2.500 Jahre alte, keltische Schnabelkanne vom Dürrnberg mit ihren
fabelwesenartigen Raubtieren und Dämonen. Eine eigene Ausstellung im
Erdgeschoß des Hauses entführt die BesucherInnen auf eine Zeitreise in
die Urgeschichte Salzburgs. Darüber hinaus sind drei erzbischöfliche
Fürstenzimmer aus dem Jahr 1756/57 und Objekte zur Geschichte Halleins
und zum historischen Salzwesen zu sehen.

Tauernradweg am Rainerkai

Die Salzachbühne 'Freiluftarena Griesplatz' ist eine
Veranstaltungsarena im Freien. Sie befindet sich am südöstlichen Rand
der Halleiner Altstadt, grenzt auf einer Seite an die Salzach, auf der
anderen Seite an den Griesplatz. Sie entstand am ehemaligen Nordende
des Halleiner Griesrechens.

Das letzte noch in Hallein erhaltene Stadttor ist das Griestor zwischen Griesplatz und Schanzplatz.

Statue des hl. Johannes Nepomuk in einer Nische in der Fassade des Bürgerhaus Raitenaustraße 4.

Das historische Zentrum bietet eine wunderschöne Bühne für das quirlige
Stadtleben, das von Märkten, Gastgärten, großzügigen Plätzen und einer
lebendigen Kunst- und Kulturszene geprägt ist. Willkommen in einer
geschichtsträchtigen Kleinstadt mit modernem Herzen.

Rathausturm

Edmund-Molnar-Platz und Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Antonius

Um 700 v. Chr. entstand am
linken Salzachufer auf dem Ablagerungskegel des Kothaches eine
Siedlung, die als Verbindung zwischen dem hochgelegenen
Salzgewimmingsort am Dürrnberg und dem sich auf der Salzach
abspielenden Handelsverkehr gedacht war
400-100 v. Chr. Aus reichen Grabfinden geht hervor, dass Hallein die führende Salzgewinnungsstätte unter keltischer Herrschaft war.
1198 Eine erste Urkunde gibt Auskunft über den Bestand einer mittelalterlichen Siedlung auf dem alten keltischen Kulturboden.
1210 In einer Schenkungsurkunde
Erzbischofs Eberhard II über eine Salzpfanne an das Kloster St. Peter
begegnet uns erstmalig „... in Haelle quod, Mühlbach dicitur".
1301 Der Name Hallein findet sich in einer deutschen Urkunde.
1398 Das überaus
produktionsstarke Hallein setzte sich trotz einiger Einschränkungen bei
einem Vergleich mit Reichenhall an die Spitze der alpinen Salinen.
Im 15. Jh. war die städtebauliche Entwicklung abgeschlossen.
16. Jh. In der ersten Hälfte
des Jahrhunderts war Hallein für kurze Zeit Hauptquartier der Bauern.
Von den um 1600 in Betrieb stehenden Sudhäusern blieben bis Anfang des
19. Jahrhunderts nur drei übrig. Die während der Blütezeit der Stadt
entstandenen Handwerkszweige - Schiffsbau, Bierbrauerei,
Ledererzeugung, Holzwaren- und Baumwollfabrikation, eine reiche
Mühlenindustrie in Verbindung mit dem Bäckergewerbe - hielten trotz des
Rückganges des Salzabsatzes Hallein auf einem hohen wirtschaftlichen
Stand.
1654 Das neu aufgebaute
Pfleghaus am Pflegplatz war bis 1961 das Salinenverwaltungsgebäude, in
dem sich nun das Stadtmuseum Hallein befindet.
1792 Während der politischen
Umwälzungen in diesem Jahr, wobei es zu Durchmärschen von
österreichischen und französischen Truppen kam, und der Kriegswirren
von 1815, nach denen Salzburg endgültig österreichisch wurde, ging der
Salzhandel stark zurück.
1870 Eines der ältesten Gebäude, es stand in der Kuffergasse, wurde abgetragen.
1895 Eingliederung der Gemeinden Burgfried und Taxach.

1938 wurden die Gemeinden Oberalm und Dürrnberg mit Hallein vereinigt, Oberalm jedoch 1952 wieder als eigene Gemeinde errichtet.
1943 Nach dem ersten Weltkrieg
kam es zu einer großen Brandkatastrophe, der unersetzliche Bauten und
Kunstgegenstände zum Opfer fielen.
1945 Nach dem Zusammenbruch
rückten Amerikaner und Franzosen in Hallein ein. Die amerikanische
Besatzungsmacht blieb bis 1947. Der Neubeginn erfolgte praktisch vom
Punkt Null ausgehend.
1970 Ein erfreulicher Erfolg
war die Wiedererrichtung des Stadtmuseums im Unteren Griestor. Ab 1970
als „Keltenmuseum" gestaltet, hat es nun seine endgültige Heimstätte im
ehemaligen Pflegamtsgebäude der Saline.
1980 Große Feierlichkeiten
anlässlich, 750 Jahre Stadt Hallein". Zusammenhängend damit Salzburger
Landesausstellung „Die Kelten in Mitteleuropa" sowie größte
Altstadtrenovierung Österreichs, über 200 Fassaden wurden erneuert.
1991 Ankauf der Pernerinsel
samt darauf befindlichen ehem. Salinengebäuden. In diesem Bereich
seither rege kulturelle Aktivitäten; herausragende Gastspiele der
Salzburger Festspiele, Szene Salzburg und Internationale
Sommerakademie.
1993/94 2. große
Landesausstellung Thema: „Salz" Wiedereröffnung des renovierten
Stadttheaters und Stadtkinos. Abschluss der Arbeiten für die
Einrichtung und Gestaltung vieler Plätze und Straßen im Altstadtkern
als Fußgängerzone.
1999-2001 Bau der Altstadtumfahrung und Errichtung der Colloredobrücke und Ausbau des Autobahnzubringers Hallein.
2003/2004 Umgestaltung und Wiedereröffnung des Keltenmuseums.
2004 Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Salzburg im Schloss Rif.

Stille Nacht Bezirk Hallein
Dazu gehören die Pfarrgasse, die Stadtpfarrkirche, der Pfarrhof und das
Mesnerhaus. Die Kirche war der wichtigste Arbeitsort von Franz Xaver
Gruber. Er spielte dort die Orgel und leitete den Chor. Die Kirche
wurde wohl am Ende des 12. Jahrhunderts errichtet und 1347 erstmals
urkundlich erwähnt. Sie ist dem Heiligen Antonius dem Einsiedler
geweiht. Der romanische Turm brannte 1943 ab, stürzte ein und wurde
1965 durch einen modernen Turm aus Beton, entworfen von Jakob Adlhart,
ersetzt. Von der gotischen Kirche sind Chor, Apsis und Teile der
Außenmauer erhalten. Im 18. Jahrhundert ersetzte ein klassi-zistischer
Neubau von Wolfgang Hagenauer den alten Bau. Um die Pfarrkirche lag der
alte Friedhof, der 1880 aufgelöst wurde. Zahlreiche Grabtafeln von
verschiedenen Halleiner Familien aus dem 16./17. Jahrhundert erinnern
an ihre Gräber. Seit 1968 trägt der Platz zwischen dem Gruber-Wohnhaus
und der Kirche den Namen des Komponisten Franz Xaver Gruber.

Der Innenraum - ein klassizistischer Saalbau
Das Innere der Kirche überrascht durch seine Weite und seine
Gliederung. Die Innenmaße von 58 m Länge, 22 m Breite und 20 m Höhe
verhalten sich zueinander harmonisch, annähernd wie 3:1:1. Den
Raumcharakter prägen die beiden weiten, von Kuppeln überwölbten
quadratischen Joche im Langhaus. Anderen Nahtstelle in der Raummitte
sind Wandpfeiler eingeschoben, die sich blockartig durch Rundbögen
öffnen; sie erinnern an die vier triumphbogenartig durchgebildeten
Pfeilerblöcke in der Salzburger Kollegienkirche Fischer von Erlachs.
Spätgotisches Taufbecken
Aus der alten Kirche erhalten geblieben ist das aus Adneter
Rotscheckmarmor gefertigte, zwölfeckige Taufbecken. Die Inschrift in
gotischen Minuskeln weist auf sein Entstehungsjahr 1481. Den jetzigen
Standort erhielt der Taufstein erst im Zuge der letzten
Kirchenrenovierung.

Zur strengen Symmetrie, bezeichnend für den klassizistischen Stil,
tragen auch die doppelten, einander zugewandten Kanzeln sowie die
Aufstellung der Seitenaltäre in den beiden Saaljochen bei. Anstelle von
Emporen, wie sie der Vorgängerbau gehabt haben dürfte, ersetzte
Hagenauer das Hauptgesims an den Längswänden durch schmale Galerien,
die unmittelbar über die Seitenaltäre hinweg geführt sind. Auch der vom
Altbau übernommene spätgotische Chor wurde im Inneren durch das
Einfügen von vier großen Fensteröffnungen so umgestaltet, dass er an
das Presbyterium des Salzburger Domes erinnert. Die Gestaltung der
Westwand wird durch die Orgelempore bestimmt, die auf zwei dünnen
Säulen ruht.

Die Gruber-Orgel
Aus vielen persönlichen Briefen und Dokumenten im Stille Nacht Archiv
Hallein erfahren wir von Franz Xaver Grubers Engagement für die Orgeln
an seinen Arbeitsorten. Franz Xaver Gruber war als Organist und
Chorregent verantwortlich für die Begleitung und musikalische
Gestaltung der Messen in der Stadtpfarrkirche Hallein. Nach-dem Gruber
1835 nach Hallein gekommen war, sorgte er bereits 1837 für die
Reparatur der Orgel in der Stadtpfarrkirche. Carl Mauracher erhöhte die
Anzahl der Pfeifen von 600 auf 1000 und ersetzte schadhafte Teile der
Orgel. 1860 bestanden wieder Schäden an der Orgel, die durch ein Leck
im Dach der Kirche verschlimmert wurden. Franz Xaver Gruber
organisierte einen Spenden-aufruf und eine Sammlung für die Orgel. Eine
Liste der Spender ist im Stille Nacht Archiv Hallein er-halten.
Matthäus Mauracher aus Braunau reparierte die Orgel in der
Stadtpfarrkirche.

FRANZ XAVER GRUBER UND DIE HALLEINER ORGELN
Der Bau der neuen Orgel ging schleppend voran. Sohn Felix Gruber
schilderte in einem Brief, dass sein Vater vom Bett aus zur Kirche
hinübersah und den Wunsch äußerte, selbst noch die neue Orgel zu
spielen. Franz Xaver Gruber starb 1863 und erlebte die neue Orgel nicht
mehr. Sein Sohn Franz spielte 1864 bei der Einweihung der Orgel. Der
hölzerne, vergoldete Orgelkasten stammt aus dem Jahr 1704. Zum 100.
Todestag Grubers kam die Einfassung an der Brüstung der Empore mit der
Aufschrift Gruber-Orgel dazu und ein neues Instrument wurde eingebaut.
Auch die Bürgerspitalkirche in Hallein erhielt 1839 auf Betreiben von
Franz Xaver Gruber eine Orgel, damit die Schüler der Hauptschule den
Kirchengesang üben konnten. 1860 kümmerten sich Franz Xaver Gruber und
seine Söhne Franz und Felix um die Orgel in der Wallfahrtskirche auf
dem Dürrnberg. Johann Nepomuk Carl Mauracher kombinierte eine der
Vierungsorgeln aus dem Salzburger Dom mit einem Orgelkasten aus
Saalfelden zu einem neuen Instrument.
Die Orgel mit ihrem Gehäuse aus
dem frühen 18. Jahrhundert wurde 1865 erneuert; damals entstand auch
das Rundbild der als Patronin der Kirchenmusik verehrten hl. Cäcilia.
Die Aufschrift auf dem Rückpositiv erinnert daran, dass die Halleiner
„Gruber-Orgel‘“ dem von 1835 bis 1863 als Chorregent und Organist
tätigen Franz Xaver Gruber gewidmet ist (siehe auch Stille-Nacht-Museum
gegenüber der Kirche).

Die vierzehn spätbarocken Kreuzwegstationen, auf Goldhintergrund
gemalt, sind im hinteren Langhausbereich angebracht. Zwei Gedenktafeln
im Bereich der mittleren Wandpfeiler erinnern an den 1840 in Jerusalem
als Pilger verstorbenen Priester Johann Baptist Reulbach bzw. an den
1810 verstorbenen Priester und Schulkatecheten Franz Stefler.

JunggesellenAltar
Dieser Altar (links hinten) wurde um 1798 in einem etwas einfacheren
Portaltypus errichtet und ist den Pestheiligen Sebastian und Karl
Borromäus geweiht. Das Altarblatt (2. Hälfte 18.Jh.) zeigt Christus
zwischen den beiden Altarpatronen, darunter Pestkranke. Im Hintergrund
ist eine alte Ansicht von Hallein mit der Pernerinsel im
Vordergrund zu erkennen. Die Seitenfiguren stellen die hll. Joseph (mit
Jesuskind) und den Apostel Jakobus den Älteren (in Pilgertracht) dar.

Jungfrauen-Altar
Der Altar (rechts hinten) entspricht formal dem gegenüber stehenden
Junggesellen-Altar und ist zu Ehren Unserer Lieben Frau errichtet
worden; die Aufsatzkartusche trägt den Text: „Der Marianischen
Jungfrauen Versammlung“. Dazu passt das Thema des 1799 von FRANZ
NIKOLAUS STREICHER gemalten Altarbildes, der „Tempelgang
Mariens“. Es zeigt die vor dem Hohepriester kniende jugendliche Maria,
die von ihren Eltern Anna und Joachim in den Tempel gebracht wurde, um
dort Gott zu dienen und bis zu ihrer Eheschließung ein tugendhaftes
Leben zu führen. Die Altarfiguren der beiden Franziskanerheiligen Franz
von Assisi und Antonius von Padua (Lilie) sowie der hll. Barbara
(Kelch) und Katharina (Rad) oben im Auszug entstanden um die Mitte des
18. Jahrhunderts und stehen stilistisch dem Bildhauer Johann Georg
Hitzl nahe.

Pietä-Kapelle
Hier in der linken Kapelle, die früher Pruefer-Kapelle genannt wurde
(nach dem Pfarrherrn Georg Pruefer, der 1497 in seinem Testament eine
große Stiftung machte), steht auf einem kleinen Marmoraltar von 1780
eine Pietä-Gruppe im Typus Maria Weißenstein (Mitte 17. Jh.), flankiert
von den Statuen der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus; darüber im
Auszug der hl. Andreas (alle drei Statuen um 1780); die Konsolfigur
rechts zeigt den hl. Apostel Judas Thaddäus mit Keule und Christusbild.
An der rechten Wand erinnert ein stattliches barockes Marmor-Epitaph
mit Auferstehungsrelief an die Verstorbenen der Familie Torner-Hölzl
(Mitte 17. Jh.).

Die Halleiner Kirchenpatrone
Die frühchristlichen Heiligen Antonius der Einsiedler
und Hieronymus lebten im 4. Jahrhundert n. Chr. in Agypten bzw. in
Dalmatien. Antonius (nicht zu verwechseln mit Antonius von Padua)
verteilte sein Vermögen an die Armen und zog sich zum Gebet in die
Einsamkeit der Lybischen Wüste zurück. Mit Männern, die seinem Beispiel
gefolgt waren, gründete er schließlich das erste christliche Kloster.
Dargestellt ist er hier am Hochaltar (links) mit dem Teufel in Gestalt
eines kleinen Drachens, ein Hinweis auf die teuflische Versuchung, der
Antonius widerstand.
Hieronymus lebte zunächst
ebenfalls als Eremit, kehrte dann aber in die Zivilisation zurück,
studierte und gründete schließlich in Bethlehem ein Kloster. Er war der
Prototyp eines Klostergelehrten und zählt zu den vier lateinischen
Kirchenvätern. Hier am Hochaltar (rechts) wird er als asketischer
Eremit mit Buch und Totenkopf dargestellt.
Beide waren von großer Bedeutungfür das christliche Mönchtum — „zwei
für Gottbegeisterte Aussteiger“, jeder auf seine Art radikal in seiner
Entscheidung, „ein neues Leben zu beginnen, ein Leben der Nachfolge
Christi in absoluter Bedürfnislosigkeit“.

Den im Jahr 1778 von Louis GRENIER nach dem Vorbild des Salzburger Domhochaltares entworfenen Halleiner Hochaltar
führte der Steinmetz JOHANN ANTON HÖGLER 1795 bis 1799 in
unterschiedlichen, großteils Adneter Marmorsorten aus. Als
Hochaltarbild wünschte man sich in Hallein von Erzbischof Colloredo
zunächst das Hochaltarblatt des Domes, das damals.noch in der Residenz
hing — allerdings vergeblich. So erhielt der Hofmaler ANDREAS
NESSELTHALER 1799 den Auftrag für ein neues Bild. Es zeigt die Geburt
Christi und die Anbetung durch die Hirten. Die beiden weiß gefassten,
aus Holz geschnitzten Seitenfiguren, links der erste Halleiner
Kirchenpatron hl. Antonius der Einsiedler und rechts der später,
vielleicht unter Erzbischof Hieronymus Colloredo hinzugekommene zweite
Patron hl. Hieronymus (oder Paulus von Theben?), stammen von FRANZ
XAVER NISSL. Oben im Altarauszug ist das Lamm Gottes mit der Bibel
„Liber Vitae“ zwischen vier Flammenurnen dargestellt. Der 1880
entstandene Tabernakel mit Aussetzungsthron ist ganz mit vergoldetem
Messing verkleidet.

Pfannhauser-Altar
Die Bezeichnung dieses links vom Chorbogen aufgestellten Altares weist
ebenso wie der Kufer- und der Kleizer-Altar in die damalige Arbeitswelt
der erst 1989 eingestellten Halleiner Salzproduktion. Währenddie
„Pfannhauser“ in den Sudbetrieben als Lohnarbeiter beschäftigt wurden,
waren die Kleizer und Kufer (auch: Küffer) als selbstständige
Zulieferer der Holzfässer in Zünften organisiert.
Den Marmoraufbau schuf JOHANN DOPPLER um 1776. Geweiht ist der Altar
dem hl. Rupert, dem Salzburger Diözesan und Landespatron sowie Patron
der Salzarbeiter. Er ist am Altarbild (vielleicht ein Werk des Joh.
Bapt. Durach) zusammen mit Salzarbeitern dargestellt. Die beiden
Seitenfiguren sind aufgrund ihrer Attribute als hl. Laurentius mit dem
Rost bzw. als hl. Florian mit dem Löscheimer zu erkennen; oben im
Altarauszug zeigt das Bild die hl. Kaiserin Helena, während die beiden
Sitzfiguren mit den Attributen Kelch und Anker allegorische
Darstellungen der christlichen Tugenden Glaube und Hoffnung verkörpern
und vermutlich von Barockaltären übertragen wurden. Sie sind älter als
der bestehende Altar und vielleicht Werke von JOHANN GEORG HITZL (Mitte
18. Jh.). Auf der Mensa steht ein barockes Herz-Jesu-Bild (2. Hälfte
18. Jh.).

Kufer-Altar
Der 1776 ebenfalls von JOHANN DOPPLER ausgeführte Altar rechts
gegenüber wurde von den Kufern, die die Kufen der Salzfässer
herstellten, gestiftet. Der Altar ist den Vierzehn Nothelfern geweiht.
Diese schon seit dem Mittelalter in vielfältigen Anliegen als
Schutzpatrone angerufene Gruppe von Heiligen (in lokal
unterschiedlicher Zusammensetzung und anhand ihrer Attribute nicht
immer klar zu bestimmen) ist am Altarbild zu sehen. In der vorderen
Reihe dargestellt sind Eustachius (oder Hubertus), Erasmus (oder Thiemo
von Salzburg), Vitus, Stephanus (oder Laurentius), Dionysius und Georg,
in der hinteren Reihe Florian, Ursula, Blasius, Katharina,
Christophorus, Barbara, Margaretha und Achatius. Über ihnen schweben
auf Wolken die Heiligste Dreifaltigkeit sowie Maria und Joseph.
Das Oberbild zeigt Christus als Guten Hirten. Auf der Mensa steht eine
barocke Kopie des Passauer Mariahilfbildes (18. Jh). Die Seitenfiguren
stellen die hll. Salzburger Bischöfe Virgil (Dommodell) und Vitalis
(Herz und Lilie) dar, während die barocken Auszugsfiguren die Tugenden
Liebe und Gerechtigkeit symbolisieren.

Kleizer-Altar
Dieser Altar (rechts vorne), vor dem sich einst die Zunft der Kleizer -
sie stellten die Wandbretter für die Salzfässer her - sammelten,
entstand 1799 wohl ebenfalls nach einem Entwurf von L. Grenier und ist
dem heiligsten Sakrament geweiht. Diesem Thema widmen sich die beiden
Bilder. Das Hauptbild „Letztes Abendmahl“ ist ebenso wie das Oberbild
„Christus und die Jünger in Emmaus“ ein Werk von FRANZ NIKOLAUS
STREICHER; auf der Mensa steht ein kleiner barocker Tabernakel (Mitte
18. Jh.). Als Zeitzeugen des Lebens und Sterbens Christi und als
Verfasser der Evangelien, die für die Verbreitung des Christentums von
fundamentaler Bedeutung waren, sind ikonografisch entsprechend als
Seitenfiguren die vier Evangelisten mit ihren Attributen dargestellt:
unten die hll. Matthäus (Engel) und Johannes (Adler fehlt), oben die
hll. Lukas (Stier) und Markus (Löwe).
Marmor-Epitaph für Ludwig Hochpichler
In der Kirche sind einige bemerkenswerte Wappengrabsteine und Epitaphe
angebracht, die noch aus dem Vorgängerbau stammen. Das hier links neben
dem Kleizer-Altar in die Wand eingelassene barocke Marmor-Epitaph mit
einem Verkündigungsrelief erinnert an den Bürgermeister Ludwig
-Hochpichler (1668).

Anna-Kapelle
Hübsche spätbarocke Gittertüren führen in die beiden Chorkapellen. Hier
in der rechten Kapelle steht ein barocker Marmoraltar (um 1760) mit dem
Altarblatt „Hl. Anna mit ihrer Tochter Maria“, ein signiertes Werk von
Sebastian Stief aus dem Jahr 1866. Das barocke Oberbild zeigt den hl.
Joachim, den Gatten der hl. Anna. Seitlich stehen auf
Konsolen Figuren der hl. Franz de Paula und Valentin.

Kreuzaltar
Insgesamt vier weitere Altäre sind an den Langhauswänden aufgestellt.
Hier vor dem Kreuzaltar (links vorne) versammelten sich früher die
Zunft der Bäcker sowie die Skapulierbruderschaft. Der Altar entspricht
im Aufbau stilistisch dem Hochaltar und dürfte auf einen Entwurf Louis
Greniers zurück gehen. Das ursprüngliche Altarblatt wurde 1945
zerstört. Das jetzige Bild „Kreuzigung Christi und Maria Magdalena"
stammt aus dem 19. Jahrhundert; das Oberbild „Maria mit Kind“ malte
JOHANN LÖXHALLER 1798. Die Seitenfiguren stellen die beiden
Apostelfürsten Petrus (Schlüssel) und Paulus (Schwert) dar, die Statue
auf der Mensa Christus als Guten Hirten.
Konsolfiguren Rupert und Virgil
Die beiden überlebensgroßen Holzfiguren in den Wandnischen zuseiten des
Kreuzaltares stellen die beiden Salzburger Bischöfe und Diözesanpatrone
hl. Rupert (links, mit Salzfass) und hl. Virgil (rechts, mit Dommodell)
dar. Es sind möglicherweise Arbeiten des Barockschnitzers JOHANN GEORG
HITZL (Mitte 18. Jh.) und stammen vom ehemaligen Hochaltar.

Stille Nacht Museum Hallein
In moderner Atmosphäre wird das Schaffen und Wirken des Komponisten von
"Stille Nacht! Heilige Nacht!" präsentiert. Das Museum befindet sich im
ehemaligen Mesner- und Chorregentenhaus, wo Franz Xaver Gruber 28 Jahre
lang gelebt und gearbeitet hat. Im Mittelpunkt steht auch die
Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte.
Das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!" ist das bekannteste
Weihnachtslied der Welt. Der Komponist Franz Xaver Gruber verbrachte
viele Jahre seines Lebens in Hallein, auch das Stille-Nacht-Museum und
seine Grabstätte befindet sich hier.
* * *
Wohnhausvon Franz Xaver Gruber, jetzt „Stille-Nacht-Museum“
Im Haus schräg gegenüber des Kircheneingangs wohnte einst Franz Xaver
Gruber, der Komponist des weltberühmten Weihnachtsliedes „Stille Nacht,
Heilige Nacht“. Im Jahr 1833 kam er als Chorregent und Organist nach
Hallein und wohnte 30 Jahre im „Mesnerhaus“ neben der Stadtpfarrkirche.
Sein ehemaliges Wohnhaus ist heute als „Stille-Nacht-Museum“
eingerichtet. Neben Möbeln und Gegenständen aus seinem Besitz birgt es
auch die Gitarre, auf der Joseph Mohr als Textdichter und Pfarrer das
Lied bei der Uraufführung im Jahr 1818 begleitete. Vor dem Haus hat
sich als einziges Grab vom ehemaligen Friedhof rund um die Kirche die
letzte Ruhestätte des Franz Xaver Gruber erhalten, der am 7. Juni 1863
in Hallein verstarb.

Peterskapelle: 1384 urkundlich erwähnt, einschiffiger gotischer Bau mit Kreuzrippengewölbe.
Die unmittelbar an den Pfarrhof angebaute, gotische Peterskapelle weist
an den Außenmauern wie im Inneren zahlreiche Grabsteine auf. Außen
findet sich neben dem Eingang links ein Wappengrabstein des Lienhard
Polhamer (+ 1568) und rechts als Rarität ein in Marmor gehauener
Stiftsbrief (von Ruprecht Riedler, 1671; Orig. Pergamenturkunde im
Pfarrarchiv). Im Inneren, einem zweijochigen, kreuzrippengewölbten Raum
mit geradem Chorschluss, sind u. a. links beim Eingang ein großes
Marmorepitaph mit Reliefs (in der Mitte Auferstehung Christi) für
Raphael Geizkofler aus dem späten 16. Jahrhundert sowie rechts beim
Altar eine Grabplatte mit Relief für Christoph Pernegger (+ 1641) zu
sehen. Das historistische Farbglasfenster der Südwand mit der
Darstellung Christi zwischen Maria und Johannes entstand 1876 nach
einem Entwurf von GEORG PEZOLT.
Leider ist die Kapelle geschlossen.

Totenkapelle: Spätbarocker Bau von 1772

Kriegergedächtniskapelle (ehem. Totenkapelle)
Ebenfalls auf ehemaligem Friedhofsgelände steht die 1777 vom
bayerischen Salinenbeamten Anton Hettinger erbaute Kapelle mit einem
schmiedeeisernen Abschlussgitter aus der Erbauungszeit. Seit 1953 dient
sie als Kriegergedächtniskapelle und birgt im Inneren ein von Prof.
JAKOB ADLHART geschaffenes Holzkruzifix sowie Gedächtnistafeln, die an
die gefallenen Halleiner beider Weltkriege erinnern.

Stadtgemeinde Hallein mit Rathausturm am Schöndorferplatz. Kern spätgotisch, Turm 1601

RATHAUS der STADT HALLEIN (im Kern gotisch).
Turm nach Brand 1607 neu erbaut. Fassadengemälde von Theodor Kern (1930): „Hallein im 18. Jh."
Im Rathaus war auch der Tanzboden untergebracht, der von 1792 bis 1926 als Stadttheater diente.
Sitzungs- und Trauungssaal im 2. Stock unter Bgm. Schöndorfer mit 12 Ölbildern von Anton Eggl (Ende 19. Jh.)
In der rechten Ecke des Rathauses befand sich das „Narrenhäusl", eine
Art Käfig in dem Geisteskranke zum Gespött der Menge gefangengehalten
wurden.
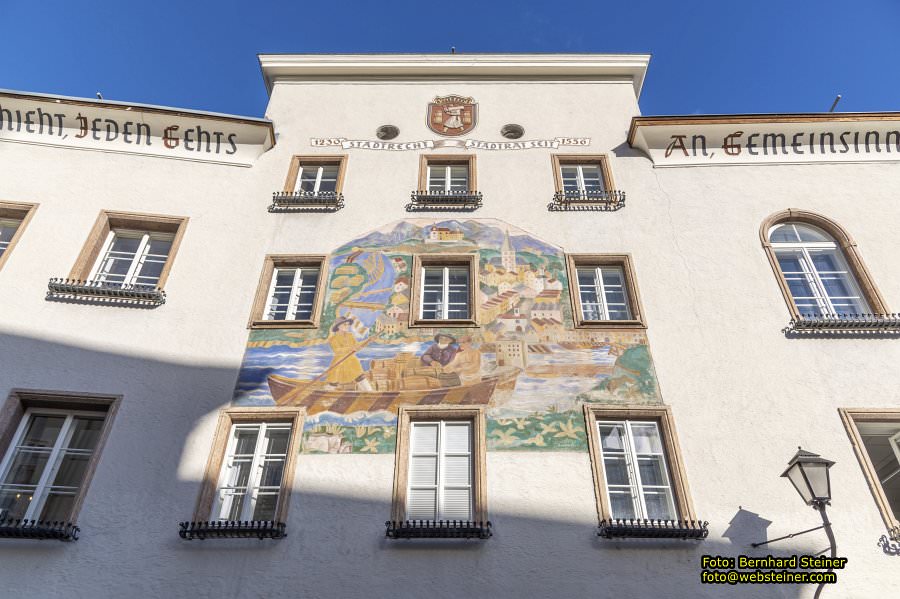
Kolpinghaus Hallein GmbH
Schlichte Pension mit kostenlosem Frühstück, Spieleraum mit Billard und Tischtennis und Fitnessraum.

„KHUEFFENHAUS" (Ende 13. Jhdt.)
Halleins erste Stadtapotheke (1815 - 1908). Initialen des Gründers
Alois Krueger im Oberlichtgitter ("AK"). Erzeugung von Mutterlaugensalz
und Bade-tabletten im Hof. 1931-1967 Kaufhaus Ambichler. Gründungsort
des „Club Hallinum" (1975)
Nachbarhäuser: in Nr. 4 ehem. Stadtgericht, Pranger einst in
Platzmitte, Königl. Bayer. Amtsgericht (1810-1816), 1.Kaffee-Ausschank
Halleins ab 1817. In Nr. 6 mittelalterliche Synagoge.
Kunstraum pro arte
Das Ziel des gemeinnützigen, auf ehrenamtlicher Basis organisierten
Vereins ist, das allgemeine Kulturverständnis im Tennengau und im
Salzburger Land zu fördern. So organisiert der Tennengauer Kunstkreis
unter anderem regelmäßig Ausstellungen, Vorträge, Lesungen und
Kunstfahrten.

Khuenburggasse

Hoher Weg ist ein Weg in der Halleiner Altstadt. Er zweigt von der
Khuenburggasse ab und endet als Sackgasse an den Hängen des Bannwalds
(Beginn des Dürrnbergs).

Bürgerspitalsplatz 4

Bürgerspital und Bürgerspitalskapelle zum Hl. Kreuz
1427 werden das Spital und die Kirche erstmals urkundlich erwähnt.
1708 wurde das Spital zu einem einfachen, zweistöckigen Gebäude
ausgebaut, die Kirche erhöht und zu ihrer heutigen Form erweitert.
1798 wurde der Turm neu hinzugefügt.
2003 wurde unter Bürgermeister Dr. Christian Stöckl die Kapelle mit
Hilfe der Siedlungsgenossenschaft "SALZBURG" restauriert und wird
künftig als Proberaum für Musiker bzw. für Konzert-veranstaltungen
genützt.

Wichtlhuberstraße in Hallein

Kornsteinplatz 7

Kornsteinplatz 4: Spätgotisches Bürgerhaus mit reicher Rokokofassade

Zeiserlbrunnen am Bayrhamerplatz

Café El‘risa in der Metzgergasse

Danijel’S Restaurant & Vinothek am Pflegerplatz

Der Pfannhauserplatz befindet sich in der Halleiner Altstadt neben dem
Keltenmuseum und der Schiemerstraße. Am Pfannhauserplatz stehen der
denkmalgeschützte Reifwichbrunnen und die Bronzeplastik "Mädchen" von
Josef Zenzmaier, aufgestellt um 2017.

Über den Pfannhausersteg im Osten des Pfannhauserplatzes gelangt man
über die große Salzach, weil es noch eine Kleine Salzach gibt, hinüber
zur Pernerinsel.

Bis 1989 wurde die Alte Saline
für die Salzgewinnung genutzt. Heute ist die ehemalige Industriestätte
auf der Pernerinsel ein beliebter Veranstaltungsort in Hallein.
1862 begann der Betrieb der neuen Saline. Die Gesamtkosten für die
modernste Anlage Österreichs betrugen fast 440.000 Gulden. Das Sudhaus
war für eine Kapazität von 25.000 Tonnen Salz im Jahr ausgerichtet. Die
Sole wurde direkt vom Dürrnberg auf die Pernerinsel geleitet. Die
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Salzburg-Hallein 1871 garantierte die
Anlieferung von Kohle und den Abtransport des Salzes. Der Transport auf
der Salzach wurde überflüssig. Durch die Modernisierung verschwanden in
Hallein viele traditionelle Berufe wie Radgeherinnen, Küfer, Kleitzer
und Schiffer.

Die Holzskulptur Salzschiff mit Salzachschiffer
befindet sich in Hallein auf einem Brückenpfeiler auf der Kühbrücke
zwischen der Pernerinsel und dem Ufer des rechten Salzacharmes, der
Kleinen Salzach. 2006 wollte Dr. Christian Stöckl, Bürgermeister von
Hallein, mit einem Salzschiff auf die Geschichte der Stadt hinweisen,
die untrennbar mit dem Salz verbunden ist. Ursprünglich wurde die
Künstlergruppe "Nobl Nobl" beauftragt, einen Salzträger aus Holz
anzufertigen. Die Salzträger stellen das alte Zunftsymbol der
Salinenstadt dar. Doch die Künstler entwarfen ein Symbol aus ihrer
Sicht, eben dieses sieben Meter lange Salzschiff mit einem
Salzachschiffer und seiner Ladung. Die Künstler haben in mehrere Monate
dauernder Arbeit, dieses Kunstwerk aus einem einzigen, mächtigen
Eichenstamm aus dem Gebiet des Chiemsees erschaffen.

Der Bahnhof Hallein ist ein Durchgangsbahnhof an der Strecke der
Salzburg-Tiroler-Bahn gelegen. Die Salzburg-Halleiner-Bahn, die von
Karl Freiherr von Schwarz im 19. Jahrhundert errichtet wurde, war der
Anfang für die Salzburg-Tiroler-Bahn, aber auch für die Tauernbahn,
endete in Hallein. Schon während der Planung dieser Eisenbahnstrecke
hatte Friedrich Baron v. Löwenstern das Projekt tatkräftig unterstützt
und schließlich den Baugrund für den Bahnhof zu einem günstigen Preis
in Hallein verkauft. An diese Mäzenatentum erinnernd wurde eine Straße
beim Bahnhof in Hallein (Baron-Löwenstern-Straße) und in Oberalm
genannt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: