web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Stadtmuseum Hartberg
Heimatmuseum, September 2024
Das Steinpeißhaus, ein Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert, beherbergt die Dauerausstellung des Museums Hartberg. Die Geschichte der Stadt Hartberg wird in einem informativen, historisch belegten Überblick anschaulich dargestellt. Der moderne Zubau wird für die Sonderausstellung „Meilensteine der Medizin und die großen Seuchen“ genützt.

Ein historischer Streifzug — die Dauerausstellung des Museums Hartberg.
Die Dauerausstellung vermittelt einen Überblick über die Geschichte der
Region von der Jungsteinzeit bis zur Besiedelung des Ringkogels, von
der römischen Kultur in der Oststeiermark bis zur Siedlungsgeschichte
im Mittelalter. Die Sozial- und Rechtsgeschichte, die Wehrgeschichte,
die Bedrohungen aus dem Osten durch Türken, Kuruzzen, Heiducken, aber
auch die wirschaftlichen und politischen Aspekte des 20. Jhdts werden
behandelt.
Zuletzt lädt ein möbliertes altes Klassenzimmer zum Nachdenken über Veränderungen im Laufe derZeit und der Generationen ein.

Am Anfang aller Weisheit ist die Furcht Gottes, diese Furcht ist den Schülern vornehmlich beizubringen.
1. Alle Schüler müssen ununterbrochen, weder zu zeitlich noch zu
langsam, mit gewaschenem Gesichte und Händen, mit gekämmten Haaren und
geschnittenen Nägeln erscheinen.
2. Die Schüler müssen schon zu Hause ihre Notdurft verrichten.
3. Sie müssen geraden Weges und sittsam zur Schule kommen.
4. Die Ursache des Ausbleibens ist mit wenigen Worten anzuzeigen.
5. In der Schule darf niemand reden, als mit dem Lehrer, und zwar nur dann, wenn er befraget und zu reden befehligt wird.
6. Es ist Schülerpflicht, den Lehrern Ehrerbietung und willigen Gehorsam zu erweisen, auch durch Winen, Worte, Thaten.
7. Ermahnungen und Warnungen, ja sogar Strafen müssen ohne Widerwillen angenommen, ertragen und zur Besserung verwendet werden.
8. Alles, was unter Mitschülern zur Verachtung, und wohl gar zum hasse Anlaß geben kann, muss sorgfältig vermieden werden.
9. Die Schüler müssen paarweise, sittsam und langsam aus der Schule
gehen, ohne auf der Gasse zu spielen, zu schreien sich Heim begeben.
10. fleißig sind die Schüler, wenn sie sich gern damit beschäftigen,
was in der Schule gefordert, und außer derselben zu thun befohlen wird,
welche sich bemühen alles auf das Beste zu erlernen und von dem
Erlernten guten Gebrauch zu machen.
(Aus den Schulgesetzen 1776)
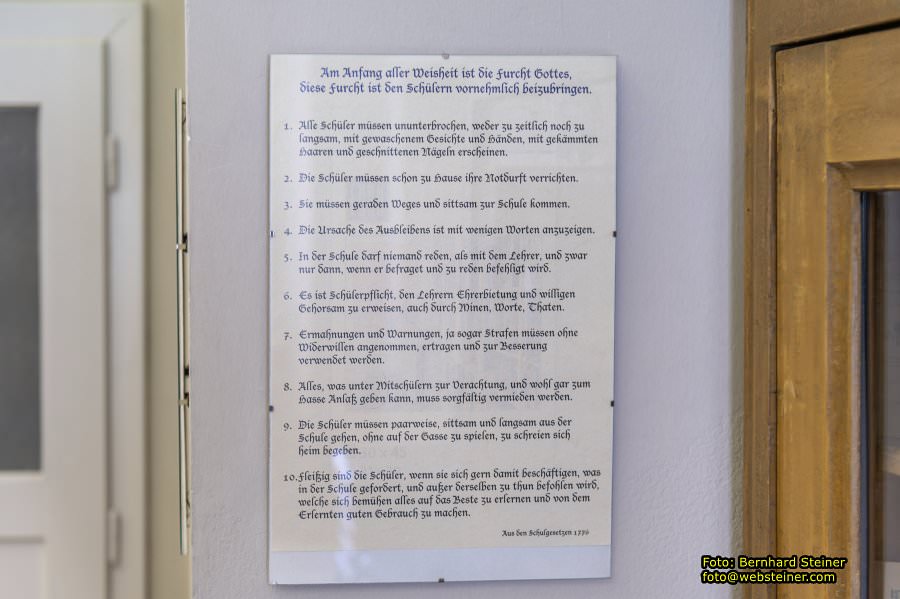
Schulordnung
1. Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen für einen ordentlichen Unterricht.
2. Das Lehrpersonal braucht jetzt nur noch an Wochentagen zwischen 6
Uhr vor mittags und 6 Uhr nachmittags anwesend zu sein. Der Sonntag
dient dem Kirchgang und der Sonntagsschule. Jeden Morgen wird im Bureau
des Direktors das Gebet gesprochen.
3. Einfache kleidung ist Vorschrift. Die Lehrpersonen dürfen sich nicht
in hell schimmernden Farben bewegen und nur ordentliche Strümpfe
tragen. Ueberschuhe und Mäntel dürfen in der klasse nicht getragen
werden, da in allen Räumen ein Ofen zur Verfügung steht. Ausserdem wird
empfohlen, in Winterszeiten täglich 4 Pfund kohle pro Lehrperson
mitzubringen.
4. Während der Pausen darf nicht gesprochen werden. Eine Lehrperson,
Sie Tabak raucht, Alkohol in irgendwelcher form zu sich nimmt,
Billardsäle oder politische Lokale aufsucht, gibt Anlass, seine Ehre,
Gesinnung, Rechtschaffenheit und Redlichkeit anzuzweifeln.
5. Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr erlaubt. Jedoch darf die Arbeit dabei nicht eingestellt werden.
6. Es wird von jedermann die Ableistung von unbezahlten Ueberstunden
erwartet, wenn der Unterrichtsbetrieb es begründet erscheinen lässt.
7. Der Klassenvorstand hat die Klassenräume sauber zu halten.
Junglehrer melden sich bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und bleiben
nach Dienstschluss zum Reinigen des Schulhauses zur Verfügung.
8. Jede Lehrperson hat die Pflicht, für die Erhaltung seiner Gesundheit
Sorge zu tragen, im Krankheitsfalle wird die Lohnzahlung eingestellt.
9. Beamten des Bezirksschulrates und des Landesschulrates ist mit Ehrerbietung und Bescheidenheit zu begegnen.
10. Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit dieser neuen Schulordnung
betont. Zum Ausgleich wird eine wesentliche Steigerung der persönlichen
Leistung erwartet.
(Schulordnung Ende 19. Jahrhundert)
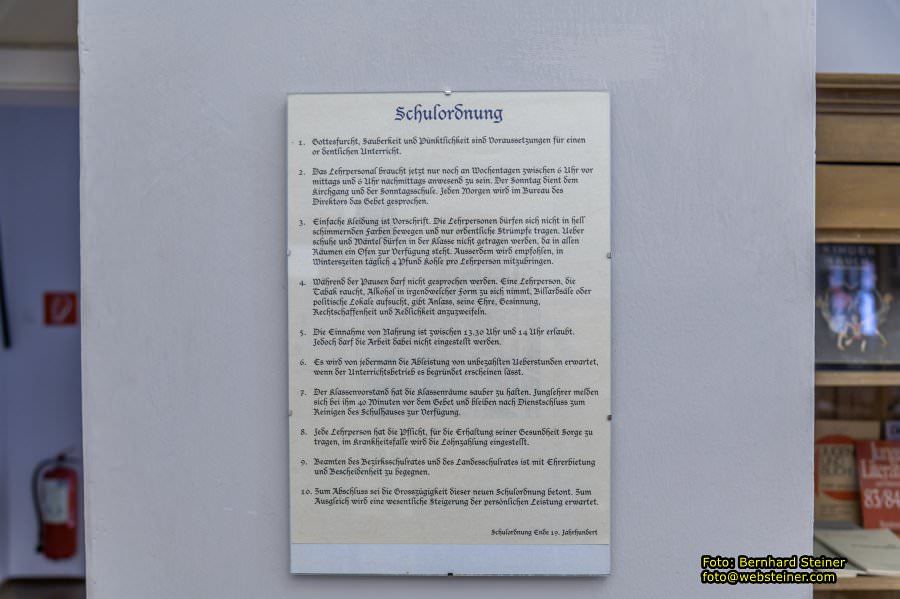
So haben sich die Kolonialmächte den Kontinent Afrika aufgeteilt.
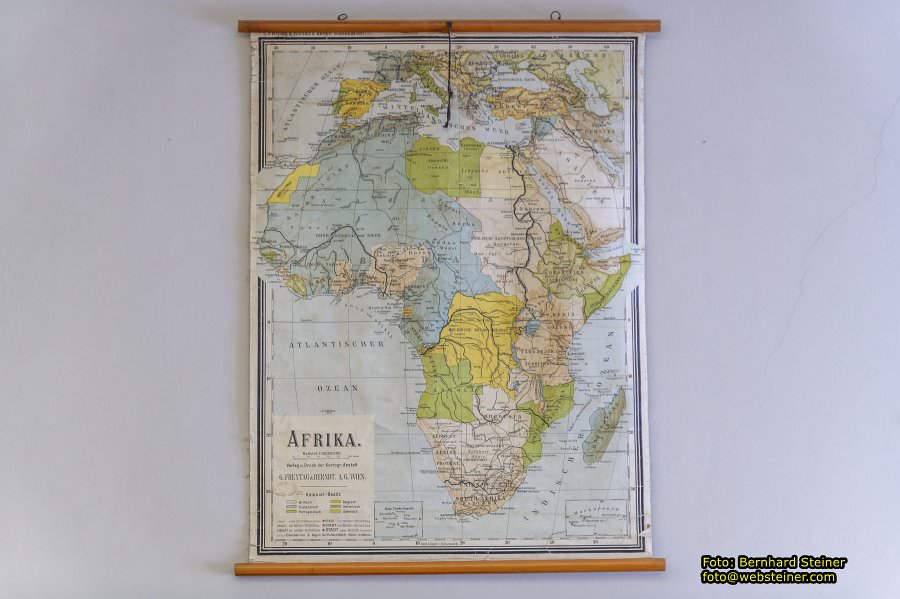
Zahlreiche Exponate, der Einsatz von modernen Medien und verschiedene
Bereiche zum aktiven Erfühlen vermitteln ein eindrucksvolles Erlebnis.


Doppeltüriger Barockschrank (Floriani-Schrank)
Der mit aufgeklebten kolorierten Kupferstichen und Furniermalerei
verzierte prächtige Schrank stellt ein auffallendes Beispiel eines
sogenannten „Floriani-Möbels" dar. Diese Art Möbel weist eigene
Stilelemente auf, die besonders in der Gegend des unteren Traunviertels
(Regionen Linzer Boden, Floriani Landl, Enns, Neuhofen, Bad Hall,
Sierning, Kremsmünster, Steyr) bzw. im nördlichen Hausruckviertel
gepflegt wurden. Der Schrank hat im Inneren eine Einteilung für
hängende Kleidung sowie kleine Schubladen. Der Kranz ist abnehmbar und
verbirgt ein Geheimfach. Bei der Anfertigung solcher Möbelstücke waren
die ausführenden Handwerker oft Bildhauer, Maler und Tischler in einer
Person.
Zur zeitlichen Einordnung unseres Floriani-Schrankes dienen die
dargestellten Herrscherinnengestalten in den vier Medaillonvignetten.
Links oben: Maria Theresia (reg. 1740-80), mit dem polnischen Wappen,
dass wahrscheinlich die polnischen Teilungen (1772, 1793, 1795)
symbolisiert.
Rechts oben: Königin Maria I. von Portugal (reg. 1777-1816, Wappen von Portugal)
Links unten: Zarin Katharina die Große von Russland (reg. 1762-96, Wappen von Rußland)
Rechts unten: eine unbekannte Orientalin, wahrscheinlich eine indische Maharani.
Unter jeder Darstellung einer Herrscherin befinden sich Stadtansichten.
Außerdem gibt es zwei Gartenportale oder Ehrenpforten. Weitere
Darstellungen zeigen Tiere, Pflanzen, Menschen in verschiedenen
Trachten, Musikanten, Tänzer und antike mythologische Szenen. Der
Schrank wurde zwischen den 1770er Jahren und dem beginnenden 19.
Jahrhundert hergestellt und könnte durch Zuwanderung, Aussteuer, Heirat
oder über Märkte nach Hartberg gelangt sein.


Der Hades
„Wenn die Griechen ihre Toten begruben, legten sie dem Verstorbenen
eine Münze unter die Zunge, damit seine Seele den Fährmann bezahlen
konnte, mit der er den Styx überquerte. Charon ruderte das Boot; und er
war habgierig. Seelen, die für das Übersetzen nicht bezahlen konnten,
mussten diesseits des Flusses warten. Zuweilen kehrten sie zurück, um
als Geister diejenigen heimzusuchen, die ihnen das Geld für die
Überfahrt nicht gegeben hatten.
Jenseits des Flusses befand sich eine große Mauer. Ihr Tor wurde von
Kerberos, einem dreiköpfigen Hund, bewacht, den es nach Menschenfleisch
gelüstete und der jedermann angriff, es sei denn, er war ein Geist. Auf
der anderen Seite des Tores, im Tartaros, erstreckte sich eine
weitläufige Fläche, von schwarzen Pappeln beschattet. Hier lebten die
Toten - Helden und Feiglinge, Soldaten, Schäfer, Priester, Sänger,
Sklaven. Ziellos wanderten sie auf und ab. Wenn sie sprachen, piepsten
sie wie Fledermäuse. Hier warteten sie darauf, dass drei Richter -
Minos, Rhadamanthys und Aiakos - über sie zu Gericht saßen. Wer das
Missfallen der Götter in besonderem Maße erregt hatte, erhielt eine
ungewöhnliche Strafe. (...) Die meisten Seelen wurden weder für allzu
gut noch für allzu schlecht, sondern einfach für tot befunden. Sie
kehrten zurück zu den sogenannten Asphodeloswiesen, um dort zu warten
auf nichts. Wer für ungewöhnlich tugendhaft befunden wurde, den
schickten die Richter zu den Elysischen Gefilden ganz in der Nähe. Hier
war immer Feiertag. Die Luft war von Musik erfüllt. Die Schatten
tanzten und spielten den ganzen Tag und auch die ganze Nacht, denn die
Toten brauchen keinen Schlaf. Auch erhielten diese glücklichen Geister
Gelegenheit, auf Erden wiedergeboren zu werden. Nur die Mutigsten
nahmen diese Gelegenheit wahr. Ein besonderer Teil des Elysiums war die
Insel der Seligen. Dort lebten diejenigen, die dreimal wiedergeboren
und dreimal ins Elysium gelangt waren.
Hades und seine Königin (Persephone) lebten in einem großen Palast aus
schwarzem Stein. Hades war sehr eifersüchtig auf seine Brüder und
verließ sein Reich fast nie. (...) Niemals gestattete er einem seiner
Untertanen zu fliehen. Auch erlaubte er keinem Sterblichen, in den
Tartaros hinab- zusteigen und wieder zurückzukehren. (...)
Das Grundstück, auf dem der Palast stand, und die umliegenden Felder
nannte man Erebos; das war der tiefst- gelegene Teil der Unterwelt.
Zwar flogen hier keine Vögel, und doch hörte man das Rauschen von
Flügeln; denn hier hausten die Erinyen, auch Furien genannt, die älter
noch als die Götter waren. (...)"

Das Museum Hartberg ist seit 6. Oktober 1988 im historischen
Steinpeißhaus, einem Hartberger Herrenhaus, beherbergt und wird vom
Historischen Verein Hartberg ehrenamtlich betrieben. Das Haus in der
Herrengasse 6 wird erstmals im August 1406 urkundlich erwähnt und
erhält 1412 durch seinen damaligen Besitzer Seifried Steinpeiß seinen
Namen. Die Bezeichnung Stainpeishaus taucht aber erst 1530 in
schriftlicher Form in Dokumenten auf.
Die Dauerausstellung des Museums Hartberg ist in diesen
geschichtsträchtigen Mauern untergebracht und präsentiert den Besuchern
und Besucherinnen einen interessanten und informativen historisch
belegten Überblick über die Geschichte Hartbergs. Ausgangspunkt für den
Rundgang durch die geschichtliche Ausstellung bildet ein mit adäquatem
Interieur und entsprechenden Unterrichtsutensilien möbliertes altes
Klassenzimmer, das Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich so in Betrieb
war. Von der „Schule“, diesem gemeinsamen erinnerungsbehafteten
Treffpunkt ausgehend, werden bedeutsame Ereignisse und Entwicklungen
des 20. Jahrhunderts betrachtet. Im Anschluss wird die Historie der
Stadt und Region Hartberg rückläufig aufgerollt. Besucher und
Besucherinnen erhalten Einsicht in die Kriegs- und Wehrgeschichte mit
den Schwerpunkten Kampf gegen die Türken und Kuruzzen sowie in die
Sozial- und Rechtsgeschichte, welche speziell das Mittelalter und die
frühe Neuzeit in Hartberg thematisiert. Wissenswertes über die
Römerzeit und die Besiedlung des Ringkogels vor der Zeitenwende und
regionale Fundstücke aus den Metallzeiten und der Jungsteinzeit bilden
den Abschluss des historischen Streifzuges.

Louis Pasteur
* 27. Dezember 1822 in Dole/Jura, † 28. September 1895 bei Paris
Arbeitete über Gärung und organische Fäulnisprozesse und erkannte, dass
Eiter und Wundbrand durch Mikroben hervorgerufen werden. Seine
Untersuchungen halfen bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen
Tollwut.
Robert Koch
* 11. Dezember 1843 in Clausthal/Harz, † 27. Mai 1910 in Baden-Baden
Identifizierte den Tuberkelbazillus 1882, später auch den
Choleraerreger. Gilt gemeinsam mit Pasteur als Begründer der modernen
Bakteriologie. Nobelpreis 1905
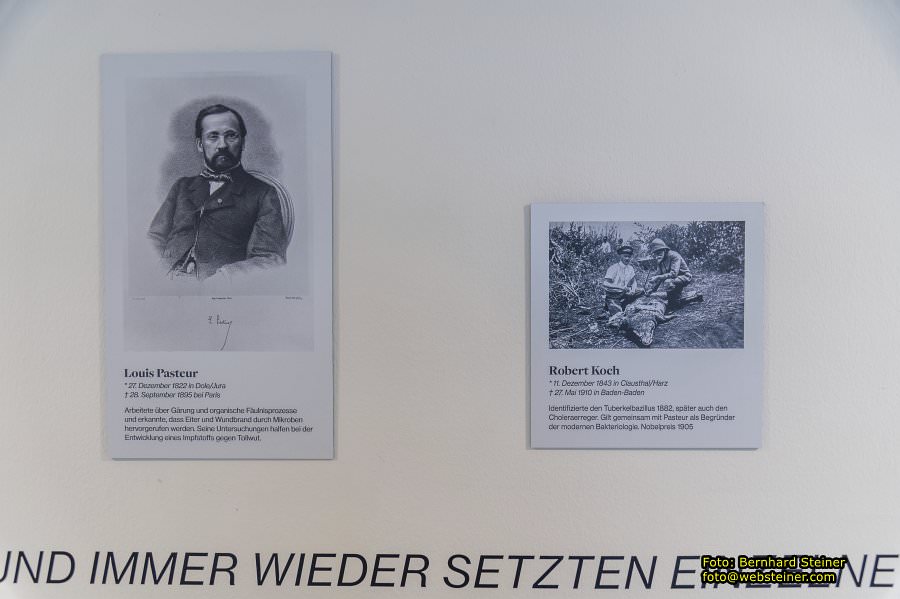
Ignaz Philipp Semmelweis
* 1. Juli 1818 in Ofen, † 13. August 1865 in Wien
entdeckte, dass Kindbettfieber durch Ärzte, die Obduktionen
durchführten, übertragen wurden. Waschungen der Hände und Instrumente
mit wässriger Chlorkalklösung senkten die Sterblichkeit.
Florence Nightingale
* 12. Mai 1820 in Florenz, † 13. August 1910 in London
Begründerin der modernen Krankenpflege. Im Verlauf des Krimkrieges
(1853-1856) betreute sie mit ihren Krankenschwestern ungefähr 10.000
Soldaten. Ihre Einsichten publizierte sie in dem Buch „Notes on
nursing".
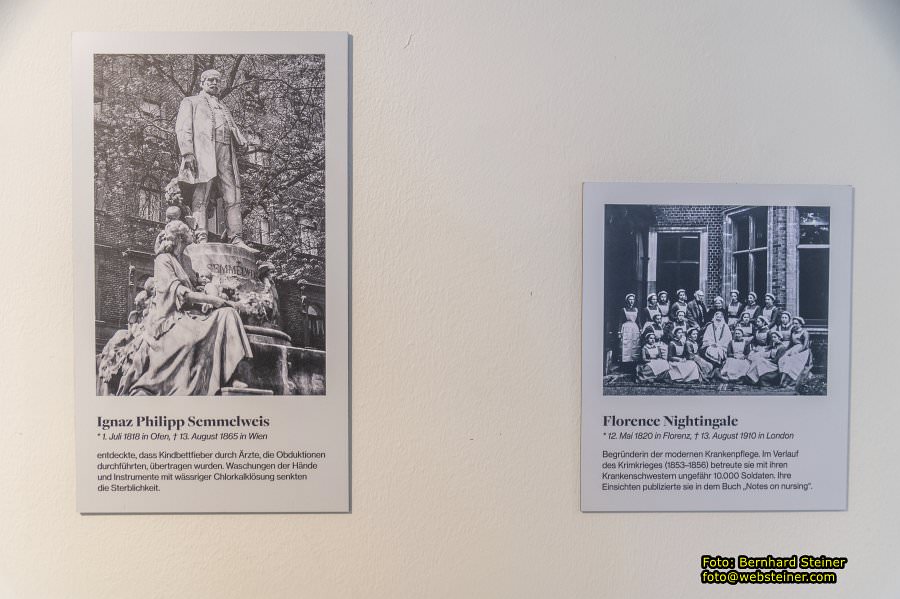
Unglaublich wie sich die Medizin entwickelt hat!
Impfungen, Antibiotika, Transplantationen, Laparoskopie, Endoskopie,
Gelenkersatz, Magnetresonanz, Gefäßerweiterung im Herzen und vieles
mehr.
Alles schon selbstverständlich?
Bewusst machen, wie es gekommen ist und freuen, dass es die Errungenschaften gibt.
Dazu lädt die Ausstellung im Museum Hartberg ein.

Kaiserin Maria Theresia war Impf-Pionierin
Der europäische Hochadel verlor im späten 18. Jhdt. viele
Familien-mitglieder durch die Pocken. So auch Kaiserin Maria Theresia:
Vier ihrer 16 Kinder starben an der Seuche, ebenso die erste und die
zweite Frau Josephs II. Die Kaiserin stand mit den verheirateten
erwachsenen Töchtern an den verschiedenen Königshöfen Europas in regem
Austausch. Sie nahm die Idee einer Impfung gegen Pocken mit großem
Interesse auf und förderte die Forschung darüber. Nach positiven
Ergebnissen ließ sie vier ihrer Kinder mit dem Kuhpockenvirus
erfolgreich impfen.
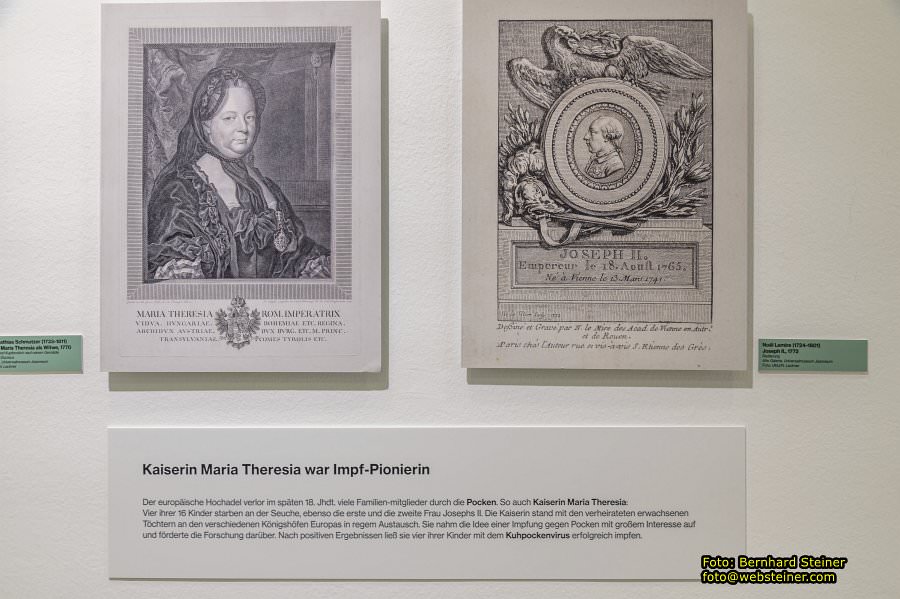
Röntgen Apparat

Hildegard von Bingen
* 1098, † 1179
Klostermedizin, Kräuterheilkunde, Gesundheit als Ausgewogenheit von Seele, Leib und Sinn
Paracelsus
* 1493 in Maria Einsiedeln, † 1541 in Salzburg
begründete die Rolle der Chemie in der Medizin, verwendete pflanzliche, tierische und mineralische Stoffe als Medikamente
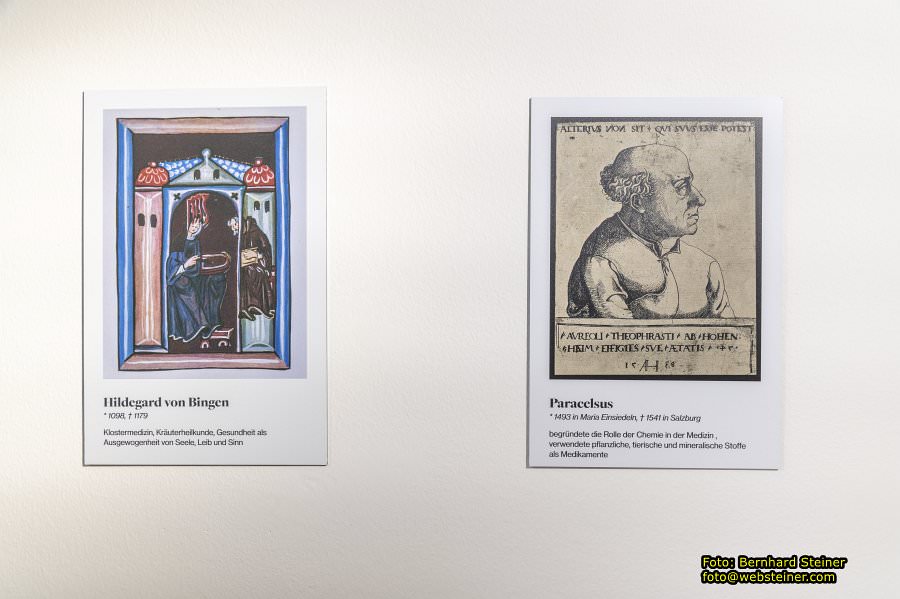
Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: