web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Haus der Geschichte Österreich
in der Neuen Hofburg, Jänner 2023
Entdecken Sie das Zeitgeschichte-Museum im Herzen Wiens! Das Haus der Geschichte Österreich in der Hofburg lädt Sie zu einer fesselnden Reise durch Österreichs jüngste Geschichte ein. Die Hauptausstellung, kompakt und modern gestaltet, führt Sie durch das letzte Jahrhundert bis in die Gegenwart. Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Objekte, noch nie gezeigte Dokumente und interaktive Stationen. Junge Geschichtsbegeisterte können jederzeit mit unserer kostenlosen „Quiz-Reise durch die Zeit“ noch mehr entdecken – sie treffen auf faszinierende Persönlichkeiten der letzten hundert Jahre.

DER ATHLET VON EPHESOS
Römisch, Ende 1. Jh. n. Chr., nach einem Vorbild des 4. Jhs. v. Chr., Bronze, Hohlguss
Ephesos, SW-Ecke der Palästra des Hafengymnasiums
Bereits zu Beginn der österreichischen Grabungen wurde im Jahr 1896
einer der bedeutendsten Funde gemacht: in der Südwestecke der Palästra
des Hafengymnasiums wurden insgesamt 234 Fragmente einer zerborstenen
Bronzestatue gefunden. Gut erhalten waren der Kopf und die
Schulterpartie, sodass sogleich der Statuentypus erkannt wurde. Es
handelt sich um einen Athleten, der sich nach der körperlichen
Ertüchtigung, wie sie in der Palästra eines Gymnasiums stattgefunden
hat, reinigt. Um den Sand und das Öl, mit dem man sich eingerieben hat,
zu entfernen, wurde eine στλεγγίς (strigilis), ein Schabeisen
verwendet. Dieses (hier nicht erhaltene) Werkzeug streicht der Athlet
mit dem Daumen seiner linken Hand aus und reinigt es. Die wie zufällige
Momentaufnahme einer in sich gekehrten Person weist ebenso auf ein
Vorbild des 4. Jahrhunderts v. Chr. wie stilistische Merkmale der
Statue. Zuletzt wurde erwogen, die Statue als Kopie des berühmten
Apoxyomenos (der sich Abschabende) des Lysipp zu verstehen.
Bronzestatuen aus der Antike sind selten erhalten, da das wertvolle
Material zumeist eingeschmolzen wurde. Oft „verdanken" wir die
Überlieferung einer Katastrophe wie dem Sinken eines Schiffes oder, wie
hier, einem Erdbeben, bei dem die Skulptur vom Sockel (hier nebenan
ausgestellt) geschleudert und von herabfallenden Teilen zertrümmert
worden war. In Wien wurden die Fragmente vom Bildhauer Wilhelm Sturm
rückgeformt und auf Messingstreifen geschraubt. Die so hergestellten
größeren Teile wurden auf ein Skelett von Vierkant-Eisenstäben montiert
und die Statue bis zum Hals mit einem speziellen Zement gefüllt, der
sowohl für Stabilität sorgen als auch die Fehlstellen schließen sollte.
1996 wurde im Meer vor der kroatischen Küste eine weitere Statue
desselben Typus entdeckt (Muzej Apoksiomena, Mali Lošinj). Dieser
ausgezeichnet erhaltene „Zwilling" erlaubt einen direkten Vergleich
zweier Bronzekopien und eine Neubewertung des Kopistenwesens in der
Antike.

Von der Herrschaft zur Nostalgie
1919 ging Kaiser Karl ins Exil - und versuchte erfolglos, von dort aus
wieder an die Macht zu kommen. Die junge Republik setzte der Monarchie
auch symbolisch ein Ende, etwa mit der Aufhebung von Adelstiteln und
Umbenennungen von Straßen und Brücken. Kaiserliche Schlösser, Theater,
Wälder und vieles andere gingen in den Besitz des neuen Staates über.
Der Fonds zur Versorgung der kaiserlichen Familie wurde nun für
Kriegsopfer verwendet. Das Privatvermögen der Habsburgerinnen blieb
aber unangetastet.
Die neue Republik vermittelte keine Idee einer österreichischen Nation,
mit der sich die Menschen identifizieren konnten. Die meisten
betrachteten sich als Deutsche. In der Populärkultur wurde Österreich
noch immer mit der Habsburgermonarchie gleichgesetzt und zum Inbegriff
der „guten alten Zeit". Ihre Symbole griff die
Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur ab 1933 wieder auf. Erst die Zweite
Republik entwickelte ein eigenes Nationalbewusstsein. Aber auch sie
residiert bis heute meist in den Gebäuden der Monarchie.
* * *
Seit Meiner Thronbesteigung war ich unablässig bemüht, Meine Völker aus
den Schrecknissen des Krieges herauszuführen, an dessen Ausbruch Ich
keinerlei Schuld trage. Ich habe nicht gezögert, das verfassungsmäßige
Leben wieder herzustellen und habe den Völkern den Weg zu ihrer
selbständigen staatlichen Entwicklung eröffnet. Nach wie vor von
unwandelbarer Liebe für alle Meine Völker erfüllt, will ich ihrer
freien Entfaltung Meine Person nicht als Hindernis entgegenstellen. Im
voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutschösterreich über
seine künftige Staatsform trifft. Das Volk hat durch seine Vertreter
die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an den
Staatsgeschäften. Gleichzeitig enthebe Ich meine österreichische
Regierung ihres Amtes. Möge das Volk von Deutschösterreich in Eintracht
und Versöhnlichkeit die Neuordnung schaffen und beseitigen. Das Glück
Meiner Völker war von Anbeginn das Ziel Meiner heißesten Wünsche. Nur
der innere Friede kann die Wunden dieses Krieges heilen.
Lammasch m. p. / Karl m. p.
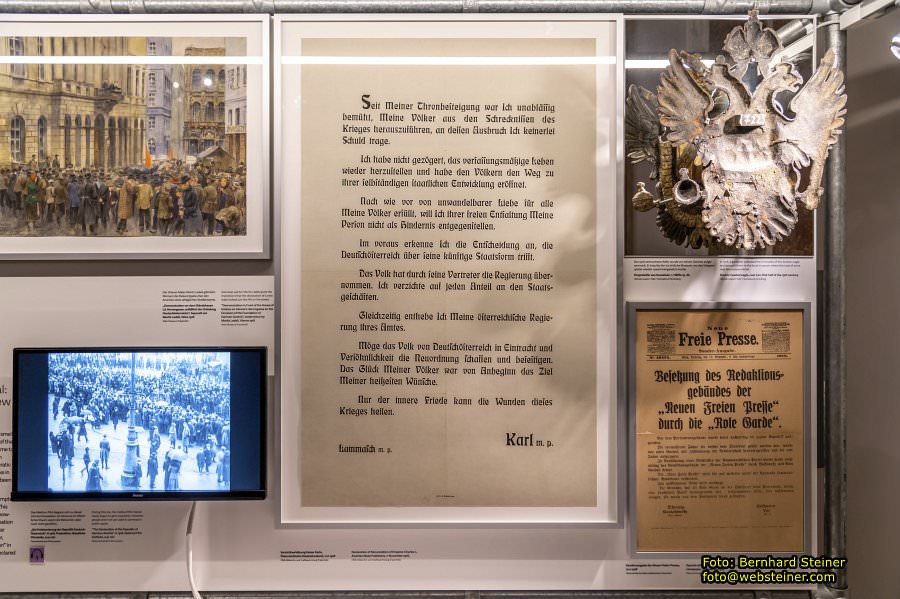
21. Oktober 1918 - Abgeordnete gründen Provisorische Nationalversammlung
Die Parlamentarier der Monarchie aus den deutschsprachig dominierten
Regionen gründen eine Provisorische Nationalversammlung mit dem Ziel,
einen neuen Staat zu errichten. Aus den drei großen politischen
Parteien wählen sie drei gleichrangige Präsidenten: Franz Dinghofer
(deutschnational), Jodok Fink (christlichsozial), Karl Seitz
(sozialdemokratisch).
30. Oktober 1918 - Beschluss zur Gründung des Staates Deutschösterreich
Im niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse tagt die
Provisorische Nationalversammlung, draußen warten tausende Menschen.
Vom Balkon wird schließlich die Gründung eines neuen Staates verkündet.
Weil der Kaiser noch im Amt ist, bleibt offen, ob es eine Republik sein wird.
3. November 1918 - Der Erste Weltkrieg ist für Österreich zu Ende
Bei Padua wird der Waffenstillstand unterschrieben. Die Armee der
Monarchie nimmt die Bedingungen der Alliierten an, garantiert die
Abrüstung und den Abzug aus den von Österreich eroberten Gebieten in
Italien.
11.November 1918 - Kaiser Karl verzichtet auf Teilhabe an der Regierung
An diesem Tag endet der Erste Weltkrieg auch für alle anderen Staaten.
Der österreichische Kaiser erklärt, dass er auf jeden „Anteil an den
Staatsgeschäften" verzichtet. Er entlässt seine Regierung.
12. November 1918 14:30 - Über 100.000 Menschen vor dem Parlament
Viele Anhängerinnen der Republik und Schaulustige sind auf die
Ringstraße gekommen. SozialdemokratInnen marschieren auf.
KommunistInnen verteilen Flugblätter und fordern auf einem großen
Transparent eine „sozialistische Republik". Deutschnationale schwingen
schwarz-rot-goldene Fahnen.
15:10 - Im Parlament wird die Republik beschlossen
Die Provisorische Nationalversammlung tritt im Wiener Parlamentsgebäude
zusammen. Sie beschließt unter anderem, dass der neue Staat
Deutschösterreich eine Republik und seine Fahne rot-weiß-rot sein soll
und dass er Teil der Republik Deutschland werden soll.
16:10 - Die Republik wird ausgerufen
Einer der Parlamentspräsidenten, Franz Dinghofer, verkündet die
Beschlüsse, eine rot-weiß-rote Fahne wird gehisst. Mitglieder der
kommunistischen Roten Garde reißen das weiße Mittelfeld heraus. Die
nunmehr rote Fahne wird dennoch aufgezogen - als sei eine
kommunistische Räterepublik ausgerufen worden.
16:40 - Schüsse und Panik
Mitglieder der Roten Garde versuchen, ins Parlament zu kommen, und schießen dabei auf das Gebäude.
Es entsteht eine Massenpanik, in der einige Personen verletzt und zwei Menschen getötet werden.
17:00 - Der Tumult legt sich
Der Ordnungsdienst setzt sich gegen die Rotgardisten durch. Im
Parlament wird die Sitzung fortgesetzt. Mehrere neue Gesetze werden
vorbereitet.
17:15 - Die Neue Freie Presse wird besetzt
Frauen und Männer der Roten Garde bringen die Redaktion der
berühmtesten konservativen Zeitung unter ihre Kontrolle. Sie erreichen,
dass zwei kämpferische Extraausgaben gedruckt werden. Zwei Tage später
werden die RotgardistInnen wegen „Putschversuchs" verhaftet.
19:00 - Ansprache von Parlamentspräsident Karl Seitz
Er bedauert die unvorhergesehenen Ereignisse des Tages, ruft zur
gemeinsamen Arbeit auf und beschwört die neu errungene Freiheit.

Im Wahlkampf 1918/19 wandten sich die Parteien an die erstmals
wahlberechtigte weibliche Wählerschaft. Die christlichsoziale Partei
warb mit folgendem Plakat für das Festhalten an der Unauflösbarkeit der
Ehe und damit gegen die Ehereform:
Christlich-deutsche Frauen und Mädchen!
Lasset nicht durch Verfechter der Ehereform Eure hehre, leuchtende
Stellung als Gattin, Hausfrau und Mutter gegen ein unsicheres, dunkles
Los vertauschen. Lasset die katholische Ehe nicht zu einem lösbaren
Vertrage heruntersinken, der Euch nur Sorge und Elend brächte. Stellet
Euch an die Seite von Millionen katholischer Frauen und Mädchen, die in
einer Massenpetition an die Nationalversammlung die Unauflöslichkeit
der katholischen Ehe in flammender Begeisterung forderten, wählet nur
die Bekämpfer der Ehereform, das sind die chriftlichsozialen Wahlwerber!
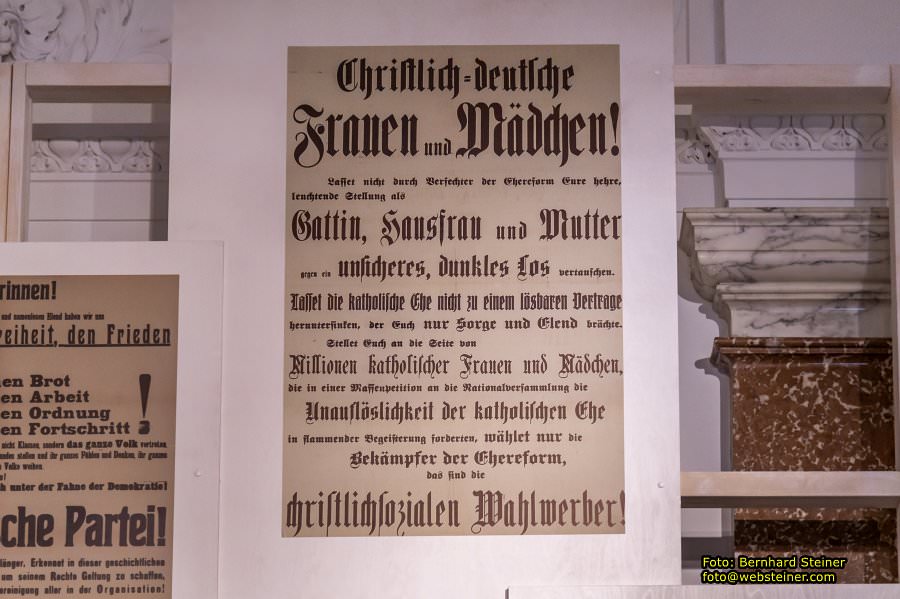
SIBIRIEN-MAPPE, 1915 HANS KATHOLNIG G 1920, NEU GEORDNET 1975 2.MAI
WELTWEITE MALERFAHRTEN DES K.U.K.FÄHNRICHS IM 1. KAISERJAGER-REGIMENT
1914-15 AN DER OSTFRONT-RUSS. POLEN, ALS PLEJNI NACH SIBIRIEN-SPÄTER
GRAPHIKER IN TOMSK 1917, GROSSE ETHNOLOGISCHE EXPEDITION ZUR MITTL.
TUNGUSKA MIT ANATOM. INSTITUT DER UNIVERSITÄT TOMSK., 1918 ALS
STEPPENREITER UND DEKORATIONSMALER AN
SIBIR.THEATERN-TOMSK-TSCHITA-MANDSCHURIA-CHARBIN, SOWIE VIELE
ZEICHNUNGEN FÜR SIBIR. TAGEBUCH BEI BURIJATEN-TUNGUSEN-JAKUTEN-OSTJAKEN
WO WERTVOLLE STUDIEN, AUCH DER SIBIRISCHEN LANDSCHAFT ERARBEITET
WURDEN. DIE VIELEN INTERESSANTEN ABENTEUER UND ERLEBNISSE SIND MIT
REICHEN BILDDOKUMETEN IM SIBIRISCHEN TAGEBUCH VERZEICHNET.
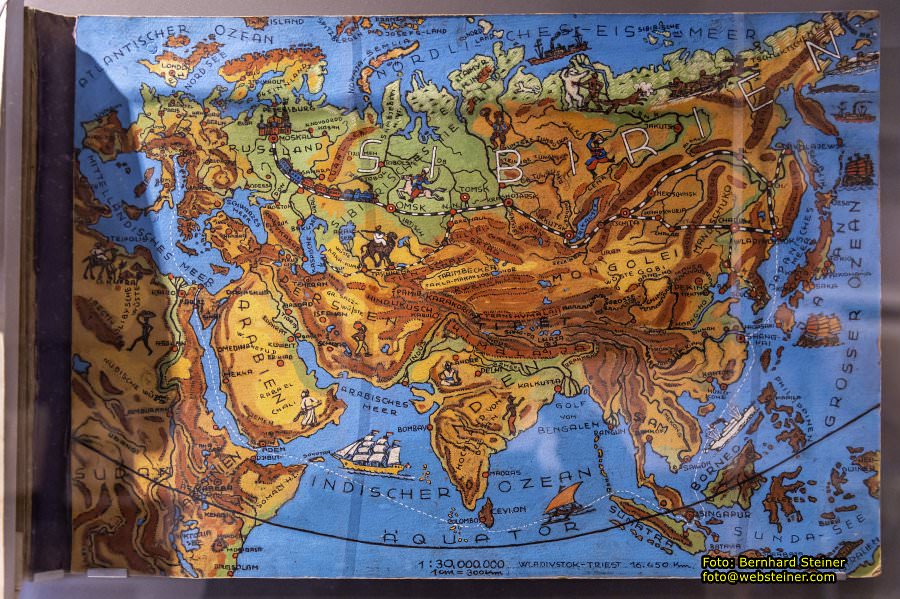
Porträt der berühmten Tänzerin Josephine Baker, Fotografin: Madame d'Ora, Paris, 1928
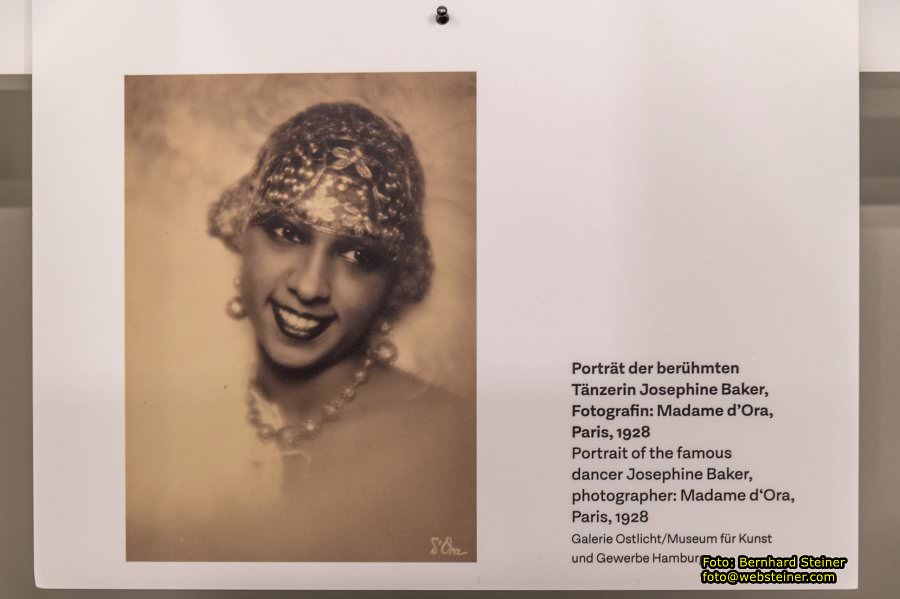
Proteste gegen Schließungen - nicht nur von unbezahlten Schauspielerinnen
Als am 21. Oktober 1918 auch die Theater geschlossen wurden, um die
Verbreitung des Virus einzudämmen, blieb das nicht ohne Folgen. Die
Spielstätten kündigten Widerstand dagegen an. Einerseits blieben die
Einkünfte aus, andererseits verlangten die Künstlerinnen finanzielle
Unterstützung. Schließlich wurden mit dem Ende von Auftritten und
Proben auch keine Gagen mehr ausbezahlt.
Auch die BesitzerInnen von Kinos gerieten unter Druck und forderten von
der Regierung eine sofortige Aufhebung der Sperre und Ersatz der
entgangenen Verdienste zu ersetzen. Die Schließung wurde als ungerecht
wahrgenommen, da „gerade das Kino berufen (sei), bei der Bekämpfung der
Grippe mitzuwirken durch Vorführungen von Diapositiven, welche auf
Maßnahmen hinweisen. Man scheint bei den Behörden zu übersehen, daß
kein Zwang besteht, das Kino zu besuchen und die Kinos durch Lüftung
und Desinfektion nach jeder Vorstellung entsprechende Sicherheit bieten
und keinerlei Gefahr besteht." Als schließlich in einigen Regionen auch
Kirchen geschlossen wurden, interpretierte das die konservative Presse
als Schikane gegen die Gläubigen und unterstellte der Sozialdemokratie,
dahinterzustecken, da diese selbst sehr wohl weiterhin Versammlungen
durchführe.

Wunder Wirtschaft?
Nach der Befreiung Österreichs und der Wiederbegründung der
demokratischen Republik 1945 nahm die österreichische Wirtschaft einen
schrittweisen Aufschwung. Der als „Wirtschaftswunder" empfundene
Wohlstand konnte nur mit internationaler Hilfe und großer finanzieller
Unterstützung durch die USA erreicht werden. Der Staat übernahm nach
1945 die vom NS-Regime durch Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen
aufgebaute Schwerindustrie - ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft
der Nachkriegszeit. Die Sozialpartnerschaft sorgte für einen Ausgleich
von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen. Massenkonsum
und die Modernisierung des Haushalts änderten das Leben der breiten
Bevölkerung.

Österreich wurde vom Deutschen Reich annektiert, und die ganze Welt
schwieg. Die ganze Welt? Nein! Ein fernes Land jenseits des Atlantiks
protestierte. So geschehen 1938. Ausgerechnet Mexiko, wo sieben
Jahrzehnte zuvor der Habsburger Maximilian ein Kaiserreich errichtet
hatte und dafür hingerichtet worden war, legte Protest vor dem
Völkerbund ein. Doch dieser, Vorgänger der heutigen UNO, blieb untätig.
Mexiko hingegen gewährte - wie auch andere Länder Lateinamerikas -
hunderten ÖsterreicherInnen, die vor dem Nationalsozialismus fliehen
mussten, Asyl. Der Mexikoplatz in Wien erinnert an diese Hilfeleistung.

Staubsauger gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert - anfangs wurden
diese händisch betrieben, später elektrisch. In den 1950er Jahren
wurden solche Geräte auch für die breite Bevölkerung leistbar und
sollten so in jedem Haushalt ihren Platz finden. Sie bedeuteten eine
Erleichterung der Hausarbeit.
Staubsauger „Famulus", Hersteller: VAEMAG, 1960er Jahre

Im Zuge der Beitrittsverhandlungen 1994 wurden 23 österreichische
Ausdrücke definiert, die bei Rechtsakten der Europäischen Union
parallel zu den bundesdeutschen Ausdrücken verwendet werden müssen.
Protokoll Nr. 10 über die Verwendung spezifischer österreichischer
Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union, 1994
Rechtsinformationssystem des Bundes
Österreich - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Beiried - Roastbeef
Eierschwammerl - Pfifferlinge
Erdäpfel - Kartoffeln
Faschiertes - Hackfleisch
Fisolen - Grüne Bohnen
Grammeln - Grieben
Hüferl - Hüfte
Karfiol - Blumenkohl
Kohlsprossen - Rosenkohl
Kren - Meerrettich
Lungenbraten - Filet
Marillen - Aprikosen
Melanzani - Aubergine
Nuß - Kugel
Obers - Sahne
Paradeiser - Tomaten
Powidl - Pflaumenmus
Ribisel - Johannisbeeren
Rostbraten - Hochrippe
Schlögel - Keule
Topfen - Quark
Vogerlsalat - Feldsalat
Weichseln - Sauerkirschen
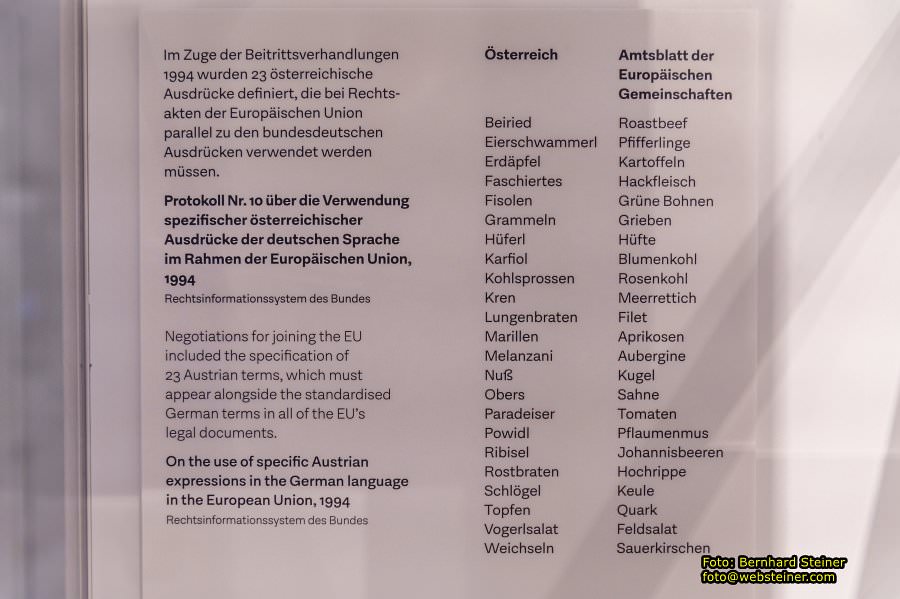
Die Aufschrift dieses Modell-Lkws spielt auf die oft kritisierte Standardisierung von Produktbezeichnungen an.
Österreich konnte zwar die Verwendung des Worts „Marille" erfolgreich
verteidigen, der Begriff „Marmelade" musste allerdings der „Konfitüre"
weichen.
Modell Lkw MAN „Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat; Daham bleibt Daham; Wien bleibt Wien"

Im Zeitalter der Gegenreformation wurde der Barock zu einem Symbol der
katholisch-habsburgischen Herrschaft mit nachhaltiger Symbolkraft. Ein
Beispiel dafür ist der Babenberger Leopold III., Markgraf von
Österreich (1073-1136) und Ende des 15. Jahrhunderts heiliggesprochen.
1663 als Landespatron für „Österreich ob und unter der Enns"
eingesetzt, erfüllt er diese Funktion bis heute. In Niederösterreich
und Wien haben Schülerinnen und BehördenmitarbeiterInnen am
„Leopolditag" frei, in den anderen Bundesländern am Tag ihres
jeweiligen Landespatrons.
Hl. Leopold, Holz, Mitte 18. Jh.

Der erstmals am 31. Oktober 1925 begangene Weltspartag erfreute sich in
den 1960er Jahren wachsender Beliebtheit. Der „Sparefroh" wurde zum
Symbol für Sparsamkeit und zu einem geflügelten Wort.
„Sparefroh", seit 1956 Symbolfigur des Weltspartags der Ersten Österreichischen Spar-Casse, undatiert
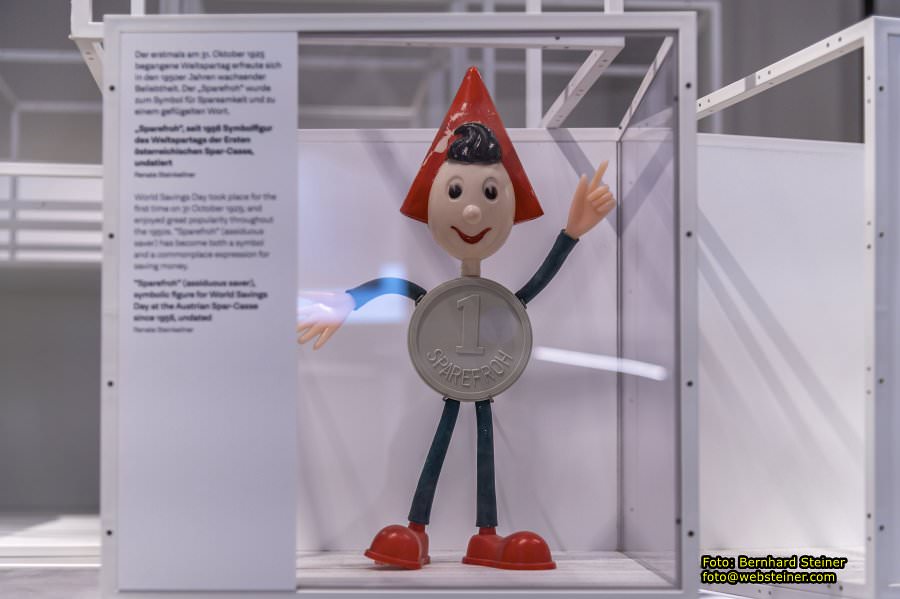
1987-1995 - Österreichisches Musikfernsehen: Austropop im ORF-Wurlitzer
1981 wurde mit MTV das erste Fernsehprogramm der Welt gegründet, das
sich ausschließlich auf das Zeigen von Musikvideos beschränkte. Der
Österreichische Rundfunk strahlte ab 1987 täglich die Sendung Wurlitzer
aus. Dort konnte das Publikum live anrufen, um sich ein Musikstück zu
wünschen. Für die Entwicklung von Popmusik in Österreich wurde der
Wurlitzer neben Ö3 zum wichtigsten Format.
Popmusik (nicht nur) in Umgangssprache
Wir spielen hier nicht nur Musik, die in dieser Fernsehsendung zu hören
war, sondern auch solche, die heute dort zu hören sein würde. Diesen
Songs aus fünf Jahrzehnten ist gemeinsam, dass sie als „Austropop"
bezeichnet werden könnten. Erstmals kombinierten Sängerinnen in den
1970er Jahren den Stil englischsprachiger Popmusik mit österreichischen
Dialekten. Aber auch österreichische Popsongs in Hochsprache oder
Englisch waren äußerst erfolgreich. Einige wenige schafften es sogar
bis in die britischen und US-Charts.

Das Haus der Geschichte Österreich (abgekürzt HdGÖ, Eigenschreibweise:
hdgö) ist ein österreichisches Zeitgeschichtemuseum in der Neuen Burg
(Hofburg) in Wien. Es wurde am 10. November 2018 rund um die
Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Gründung der Republik Österreich
eröffnet.
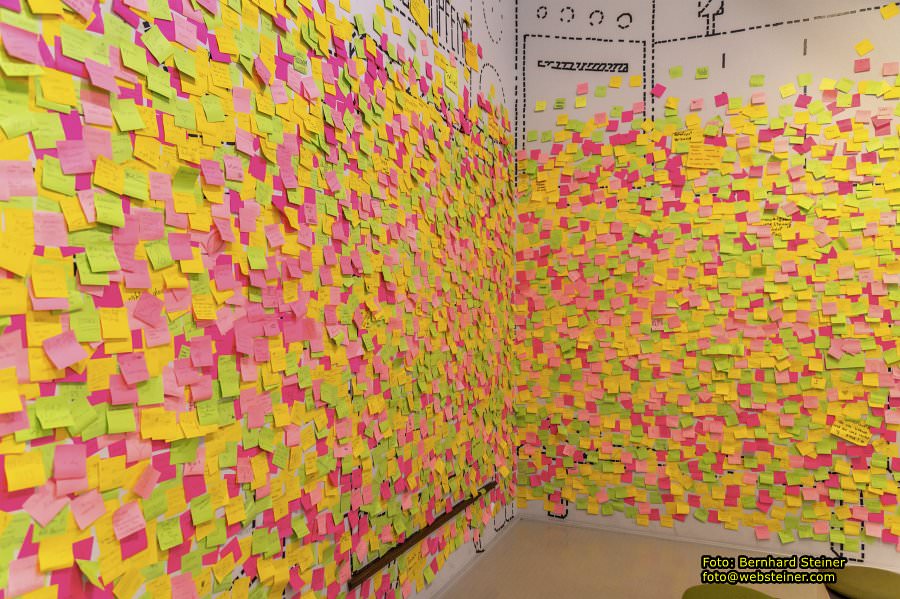
Dem inhaltlichen Konzept folgend soll das HdGÖ einem möglichst breiten
Publikum die Geschichte Österreichs ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
mit einem besonderen Schwerpunkt von 1918 bis in die Gegenwart in ihrem
europäischen und internationalen Kontext vermitteln. Chronologische
Narrative sollen mit thematischen Schwerpunkten verschränkt werden, die
die Pluralität der österreichischen Gesellschaft spiegeln.

Die Ortstafel von Fucking war vor allem für ausländische BesucherInnen
eine beliebte Foto- und Filmkulisse. Dieses Schild zählt zu der letzten
Serie mit dieser Aufschrift.
Tafel zur Markierung des Ortsendes von Fucking, heute Fugging, Gemeinde Tarsdorf (OÖ), Blech, beschichtet, 2020

Covid19 Bank für 1 Meter Abstand.

2014 - Bilder von Europa: Conchita Wurst gewinnt den Eurovision Song Contest
In der Gegenwart haben Social Media verändert, wie Zeitungen und
Fernsehen arbeiten und wirken. Das heißt aber nicht unbedingt, dass
Politikerinnen weniger Aufmerksamkeit bekommen. Als sich 2014 ein
prominenter russischer Politiker abfällig über Conchita Wurst äußerte,
dominierte das die Wahrnehmung des gesamten Eurovision Song Contest.
Traditionelle Medien und Social Media erzeugten gemeinsam den Eindruck,
als wäre der Kontinent zwischen Fortschritt und Diskriminierung
geteilt. Dabei waren Stimmen und Kommentare für die Sängerin zu
gleichen Teilen aus Ost und West gekommen.
Bart und Glamour: Dragqueens verstehen sich als Männer, bestreiten ihre
Auftritte aber als Frauen. Tom Neuwirth unterwarf seine Kunstfigur
Conchita dieser Zweiteilung nicht. International wurde sie mit dem Bart
bekannt, der schien, als würde er dem glamourösen Auftreten
widersprechen.
Kleid von Conchita Wurst für den Auftritt im Finaie des Eurovision Song Contest 2014, Designerin: Ariane Rhomberg
Papier-Bart des ORF anlässlich der Willkommensfeier für Conchita in Wien, 2014
Anstecker aus Magazin-Ausschnitten, Produkt eines Fans, 2017
Gehäkelter Bart, Produkt eines Fans, 2014
Legofigur, 2018
Österreich- und Pride-Fahnen, 2014
Eintrittstickets zum Finale des Eurovision Song Contest, Kopenhagen, 10. Mai 2014
Conchita-Barbiepuppe Gestaltung: Atelier Wunder-kammer, 2018

„Mafiamethoden“ 1975 (Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre)
„Mafiamethoden" - diesen Vorwurf erhob Bundeskanzler Bruno Kreisky im
Jahr 1975 gegen Simon Wiesenthal. Dieser hatte im selben Jahr
nachgewiesen, dass FPÖ-Parteiobmann Friedrich Peter einem an
Kriegsverbrechen beteiligten SS-Verband angehört hatte. Kreisky,
stellte sich hinter Peter und warf Wiesenthal vor, durch Kollaboration
mit dem NS-Regime überlebt zu haben. Die Puppe stammt von Arminio
Rothstein, besser bekannt als Clown Habakuk. Rothstein, dessen Vater
jüdischen Glaubens war, überlebte den Zweiten Weltkrieg versteckt in
Wien.
Kreisky-Portraitpuppe, aus dem politischen Puppenspiel Theater Arlequin Wien
Künstler: Arminio Rothstein, Wien, um 1980
Simon Wiesenthal, der zwischen 1941 und 1945 in zwölf unterschiedlichen
Arbeits- und Konzentrationslagern interniert worden war, widmete sich
nach 1945 der Suche nach NS-KriegsverbrecherInnen. Er war ein ständiger
Mahner einer österreichischen Verantwortung. Seine Aktentasche wurde zu
einem Symbol seiner akribischen Arbeit.
Aktentasche von Simon Wiesenthal, um 1970

DIKTATUR
Österreich war im letzten Jahrhundert nicht immer demokratisch oder
unabhängig. 1933 löste der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert
Dollfuß das Parlament gewaltsam auf und ebnete damit den Weg für eine
Diktatur. Er strebte die Schaffung eines Ständestaates nach
faschistischem Vorbild an, eines katholischen Deutschösterreichs, um
das Land von Nazi-Deutschland abzugrenzen. Die Todesstrafe wurde wieder
eingeführt und politische Parteien schrittweise verboten. In einigen
Teilen des Landes eskalierte der Konflikt zwischen den beiden
wichtigsten politischen Lagern – den Christlich-sozialen und den
Sozialdemokraten – im Februar 1934 zu einem Bürgerkrieg. Im Juli 1934
wurde Dollfuß bei einem Putschversuch österreichischer Nazis ermordet.
Sein Nachfolger Kurt Schuschnigg geriet zunehmend unter Druck
Nazi-Deutschlands.
NAZI-TERROR
1938 gliederte Nazi-Deutschland, unterstützt von österreichischen
Nazis, Österreich gewaltsam in das Deutsche Reich ein. Dieser
sogenannte „Anschluss“ markierte den Beginn der nationalsozialistischen
Terrorherrschaft in Österreich. Die neuen Machthaber begannen, manchmal
mit Hilfe der lokalen Bevölkerung, sofort mit der Verfolgung
politischer Gegner und Minderheiten. Jüdische Menschen verloren ihre
Rechte und ihr Eigentum und wurden ins Exil gezwungen. 1939 begann
Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg, und die Verfolgung eskalierte.
Millionen wurden systematisch ermordet, vor allem Juden, Roma, Sinti,
sowjetische Kriegsgefangene und Behinderte. Einige Österreicher fielen
dem Krieg zum Opfer, während andere sich aktiv am Massenmord in ganz
Europa beteiligten. Nur wenige Österreicher leisteten Widerstand.
ERINNERUNG
Nach der Befreiung durch alliierte Truppen 1945 wurde Österreich als
demokratische Republik wiederhergestellt. Viele Jahre lang sahen sich
die Österreicher als die „ersten Opfer“ des Nationalsozialismus. Dies
ermöglichte es ihnen, ihre eigene Rolle bei den Verbrechen des Regimes
zu ignorieren. Österreichische Versuche, die Mittäterschaft ihres
Landes kritisch aufzuarbeiten, begannen erst in den 1980er Jahren.
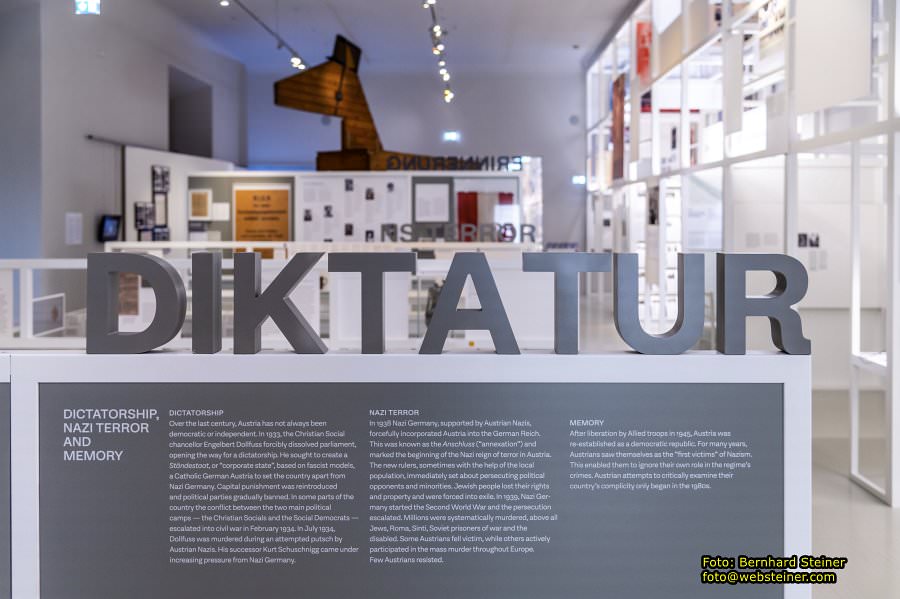
EINE SPHINX REISST ΕΙΝΕΝ ΚNABEN
Römisch, 2. Jh. n. Chr., nach einem griechischen Original um 440 v. Chr., Grauwacke
Ephesos, im Marmorsaal des Hafengymnasiums
Gipsmodell: Atelier A. Rainbauer, 1959; Leihgabe des Instituts für Klassische Archäologie, Universität Wien
Aus über 70 Fragmenten, die sich heute in Wien und London befinden,
konnten zwei idente Figurengruppen - eine Sphinx reißt einen Knaben -
rekonstruiert werden. Die Darstellung nimmt auf den Mythos Bezug, dass
vor der Stadt Theben derjenige einer Sphinx zum Opfer fiel, der das von
ihr aufgegebene Rätsel nicht lösen konnte.
Das Vorbild für diese Gruppe ist ein Detail der Gold-Elfenbeinstatue
des Zeus in Olympia, eines der Sieben Weltwunder der Antike. Der
berühmte Bildhauer Phidias gestaltete um 440 v. Chr. die Lehne des
Throns mit einer derartigen Skulpturengruppe.



DAS PARTHERMONUMENT
Römisch, 2. Jh. n. Chr., Thasischer Dolomit-Marmor, Ephesos
Eines der bedeutendsten Monumente des kaiserzeitlichen Ephesos, das
zugleich eine Vielzahl ungelöster Rätsel aufgibt, ist das sogenannte
Parthermonument. Erhalten sind zahlreiche Reliefplatten und Fragmente
eines Frieses, die an unterschiedlichen Stellen im Ruinengelände von
Ephesos aufgefunden worden sind. Alle Teile waren in Zweit- oder
Drittverwendung verbaut worden, sodass der ursprüngliche Standort des
Monumentes bis heute unbekannt ist. Auch die zugehörige Architektur
konnte bislang nicht eindeutig identifiziert werden, wodurch auch die
Form des Monuments und die Anordnung des Frieses unklar bleiben. Eine
Rekonstruktion schlägt die Form eines Altares - ähnlich dem
Pergamonaltar - vor, um dessen Hauptgeschoß die Friesplatten angeordnet
gewesen sein könnten. Andere Vermutungen weisen in Richtung eines
großen Gevierts, an dessen Innen- oder Außenseiten sich die Platten
ihren Themen entsprechend unterbringen ließen.
Die herausragende Bedeutung des Monumentes wurde bereits bei der
Auffindung einer der zentralen Platten 1903 erkannt: Sie zeigt die vier
römischen Kaiser des 2. Jahrhunderts n. Chr., Hadrian, Antoninus Pius,
Lucius Verus und Marc Aurel. In der Forschung wird diskutiert, wer der
eigentliche Adressat des Monumentes war: Antoninus Pius, der für die
Konsolidierung des römischen Imperiums und in Erinnerung an seine Zeit
als Statthalter in Ephesos geehrt wurde (um 140 n. Chr.), oder Lucius
Verus, dem als Sieger im Kampf gegen die Parther im Osten nach seinem
Tod 169 n. Chr. Tribut gezollt werden sollte.
Das Monument feiert das römische Imperium in vier Themenzyklen:
Grundlage für die innenpolitische Stabilität ist die gesicherte
Kaisernachfolge über drei Generationen, außenpolitisch kann Rom gegen
alle Feinde bestehen, seien es die Parther im Osten oder die Germanen
im Norden, das Imperium ruht auf den Schultern seiner Städte und
Provinzen, die in ihrer kommunalen Eigenständigkeit zum großen Ganzen
beitragen und eine Götterversammlung spendet dem römischen Reich Segen
und Beistand. Der Kaiser auf einem Triumphwagen steht dem
Geschwisterpaar Artemis und Apollon gegenüber, vermutlich ist eine
vierte Platte mit einem Zweigespann zu ergänzen.
Ein Teil der Platten wurde in der Spätantike als Brüstung eines
Brunnenbeckens verwendet, das vor den Stufen der Celsusbibliothek
angelegt wurde. Die Bibliothek war nach dem Einsturz des Hauptraumes
bei einem Erdbeben in ihrer Funktion aufgegeben worden, die noch
aufrechtstehende Fassade wurde zur Rückwand eines Brunnens
umfunktioniert. Andere Platten wurden als Straßenpflaster
wiederverwendet. Zählzeichen auf dem Deckprofil oder der Standleiste
stammen wohl von der vorletzten Aufstellung der Reliefplatten in zwei
langen Reihen. Bereits in den ersten zehn Jahren der österreichischen
Grabung wurden die meisten der heute bekannten Platten und Fragmente
entdeckt, sodass heute fast alle Teiles dieses Monuments in Wien zu
sehen sind. Die in den 1960er und 1990er Jahren gefunden Reliefs
konnten als Gipsabgüsse erworben werden.

POSEIDON
Römisch, 2. Jh. n. Chr., Marmor, Ephesos, Theater (Gipsabguss des Körpers)
Der Kopf des Poseidon wurde im Jahr 1897 im Theater gefunden, der
Körper war schon dreißig Jahre früher von den britischen Ausgräbern
entdeckt und nach London gebracht worden. Die Anfertigung und der
Austausch von Gipsabgüssen ermöglichte es, die Zusammengehörigkeit
beider Stücke zu belegen. Der Meergott mit Dreizack und Delphin stellt
eine Wiederholung eines bekannten Motivs (Typus Lateran) dar, dessen
Vorbild vielleicht dem griechischen Bildhauer Lysipp zuzuschreiben ist.

KNABE MIT FUCHSGANS
Römisch, 2. Jh. n. Chr., nach einem griechischen Vorbild des frühen 3. Jhs. v. Chr., Marmor
Ephesos, im Marmorsaal des Hafengymnasiums
Aus zahlreichen Fragmenten zusammengesetzt, konnte eine besonders
realitätsnahe Skulpturengruppe wiedergewonnen werden: Ein Knabe sitzt
auf dem Boden, blickt auf und streckt seinen rechten Arm einem
imaginären Gegenüber entgegen. Gedankenlos drückt er dabei einen Vogel
nieder, der aufgrund des charakteristischen Federkleides als ägyptische
Fuchsgans identifiziert werden kann. Literarisch ist überliefert, dass
eine besonders lebensechte Bronzegruppe eines Knaben mit Gans im
Asklepios-Heiligtum auf der griechischen Insel Kos bewundert worden
sei. Diese wird dem Künstler Boëthos von Chalkedon zugeschrieben und
könnte das Vorbild der Marmorgruppe aus Ephesos gewesen sein.

Die Neue Burg stellte die letzte große Erweiterung der Hofburg als Teil
des von Gottfried Semper geplanten Kaiserforums dar. Mangelnder Konsens
über die zukünftige Funktion und der folgende Erste Weltkrieg
verhinderten die Ausführung der gesamten Anlage. Fertiggestellt wurde
die Neue Burg schließlich in der jungen Ersten Republik.

Die heutigen Ausstellungsräume des Hauses der Geschichte Österreich
waren ursprünglich als „Appartements Ihrer Majestät der Kaiserin"
geplant worden. Schließlich wurde aber die Ausführung geändert und ein
weiteres Stockwerk eingezogen. Wofür welche Bereiche verwendet werden
sollten, blieb aber unklar.

Am 24. März 1919 verließen der vormalige Kaiser und seine Familie
Österreich. Für die Regierung war es wichtig, dass die Ausreise der
Habsburgerfamilie sicher und ohne Zwischenfälle erfolgen konnte. In
Feldkirch, vor der Einreise in die Schweiz, nahm Karl die im November
1918 verlautbarte Verzichtserklärung auf die Staatsgeschäfte zurück.
Nach diesem Eklat wurde vom Nationalrat das „Habsburger-Gesetz"
einhellig beschlossen. Dieses sah für alle Mitglieder der Familie
Habsburg, die keine Loyalitätserklärung gegenüber der Republik und
keine Verzichtserklärung im Hinblick auf Herrschaftsansprüche abgaben,
ein Aufenthaltsverbot in Österreich vor.

Diana nach der Jagd - Pierre Benevault (Paris 1685-1767 Wien), 1752, Leinwand, Gemäldegalerie

Das große Stiegenhaus in der Neuen Burg, fertiggestellt 1908-1912
