web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Haus der Musik
Das Klangmuseum, Jänner 2023
In einzigartiger Weise präsentiert das Haus der Musik als interaktives Klangmuseum innovative und unkonventionelle Zugänge zur Musik in all ihrer Vielfalt. Reale und virtuell geschaffene Klangwelten laden auf vier Etagen zum unmittelbaren Erleben musikalischer Phänomene ein. Lernen Sie die großen Meister der klassischen Musik kennen!

Interaktiv, spannend, abwechslungsreich: Das Haus der Musik ist mehr
als ein Museum in Wien. Es ist ein Ort der lebendigen
Auseinandersetzung mit viel Tradition.

Das Haus der Musik ist ein Klangmuseum in Wien. Es wurde am 15. Juni
2000 eröffnet und steht seit 2005 über die Wien Holding im Eigentum der
Stadt. Es befindet sich in der historischen Altstadt im Palais
Erzherzog Carl an der Seilerstätte. Mit interaktiven und multimedialen
Präsentationsformen wird auf vier Stockwerken mit einer Gesamtfläche
von 5000 m² in die Welt der Musik der Wiener Philharmoniker, der
Komponisten der Wiener Klassik und die Entstehung, Bearbeitung und
Ausbreitung von Klängen eingeführt. Dabei wurde eine Brücke zwischen
Tradition und Innovation bzw. zwischen Analogem und Digitalem
geschaffen.

Wien war immer schon eine Stadt, in der Menschen keine Scheu hatten,
unkonventionelle Zugänge zur Musik zu finden. In diesem Gebäude
gründete Otto Nicolai 1842 die Wiener Philharmoniker. Zuvor hatte
Erzherzog Carl das historische Palais bewohnt. Hier fand schon immer
ein Wechselspiel zwischen Alt und Neu statt.

MUSEUM DER WIENER PHILHARNMONIKER
Die Geschichte des Orchesters der Wiener Philharmoniker nimmt hier, in diesen
Räumlichkeiten, ihren Anfang. Der Komponist und Dirigent Otto Nicolai
(1810-1849) wohnte und arbeitete hier, als er am 28. Marz 1842 erstmals
ein Orchesterkonzert mit den Musikern der damaligen Hofoper initiierte
und leitete. Die daraus resultierenden „Philharmonischen Concerte"
gelten als Ursprung der Wiener Philharmoniker und Otto Nicolai somit
als Gründer des Orchesters.
Das wohl bedeutendste Konzert der Wiener Philharmoniker ist das
Neujahrskonzert. Seine Geschichte begann mit einem Silvesterkonzert
1939 und ausschließlich Werken der Familie Strauß, unter der Leitung
von Clemens Krauss. Seit 1946 trägt das Konzert zum Jahreswechsel den
Titel „Neujahrskonzert", das heute von Millionen Menschen weltweit
mitverfolgt wird. Seit 2004 gehört auch das Schönbrunner
Sommernachtskonzert zum alljährlichen Fixprogramm der Wiener
Philharmoniker.
Das Archiv der Wiener Philharmoniker, das in den hier angrenzenden
Räumen beheimatet ist, gibt in den historischen Räumlichkeiten anhand
zahlreicher Exponate Einblick in Geschichte und Gegenwart dieses
einzigartigen Orchesters.

Am 28. März 1842 dirigierte Otto Nicolai, Komponist der Oper „Die
lustigen Weiber von Windsor", ein „großes Concert", das vom „sämtlichen
Orchester-Personal des k.k. Hof-Operntheaters" veranstaltet wurde.
Obwohl ähnliche Konzerte bereits vor Nicolai stattfanden, gilt diese
„Philharmonische Academie" mit Recht als die Geburtsstunde der Wiener
Philharmoniker, weil erstmals alle Prinzipien der bis heute gültigen
sogenannten „Philharmonischen Idee" verwirklicht wurden:
- nur ein im Orchester der Wiener Staatsoper (früher Hofoper)
engagierter Künstler kann Mitglied der Wiener Philharmoniker werden;
- künstlerische, organisatorische und finanzielle Eigenverantwortlichkeit;
- alle Entscheidungen werden prinzipiell auf demokratische Weise getroffen;
- die eigentliche Verwaltungsarbeit wird von einem demokratisch gewählten Ausschuß, dem zwölfköpfigen Komitee, durchgeführt.
Trotz größter Erfolge in insgesamt 11 Konzerten unter Nicolais Leitung
brach das junge Unternehmen beinahe zusammen, als der Komponist 1847
Wien verließ. Nach 12 Jahren der Stagnation fand schließlich am 15.
Jänner 1860 das erste von vier Abonnementkonzerten unter der Leitung
des Operndirektors Carl Eckert statt. Seither bestehen die
„Philharmonischen Konzerte" ohne Unterbrechung und erfuhren als einzige
grundlegende Änderung den Wechsel vom jeweils für die Dauer einer
Saison gewählten Abonnementdirigenten zum Gastdirigentensystem.
* * *
Im Instrumentarium werden anhand von vier Rieseninstrumenten die
Prinzipien der Klangerzeugung veranschaulicht. Es gibt Instrumente,
welche zu den „Luftklingern“, also Aerophonen zählen; Instrumente,
welche zu den Selbstklingern, also Idiophonen gehören; Instrumente die
zu den Saitenklingern, also Chordophonen zählen und „Fellklinger“,
welche zur Gruppe der Membranophone gehören. Anhand von vier
Touchscreens kann man Instrumente zum Klingen bringen und gleichzeitig
erfahren, welcher Kategorie sie zugeordnet sind.

Violine, Sebastian Nickl, Wien 1785

Einen weiteren Höhepunkt der philharmonischen Geschichte stellt die
Zusammenarbeit mit Arturo Toscanini in den Jahren 1933 bis 1937 dar.
Musikhistorisch von großer Bedeutung ist die enge Beziehung der Wiener
Philharmoniker zu Richard Strauss. Zwischen 1906 und 1944 dirigierte er
zahlreiche Opernaufführungen sowie Konzerte im In- und Ausland und war
dem Orchester durch ein herzliches Freundschaftsverhältnis verbunden.
1938 griff auf brutalste Weise die Politik ins philharmonische
Geschehen ein: Die Nationalsozialisten entließen fristlos alle
jüdischen Künstler aus dem Dienst der Staatsoper und lösten den Verein
Wiener Philharmoniker auf. Lediglich die Intervention Wilhelm
Furtwänglers bewirkte eine Annullierung des Auflösungsbescheides und
rettete die „Halbjuden" und „Versippten" vor Entlassung und Verfolgung.
Dennoch hatten die Philharmoniker die Ermordung von sechs ihrer
jüdischen Mitglieder in den Konzentrationslagern sowie den Tod eines
jungen Geigers an der Ostfront zu beklagen.

Das Haus der Musik ist im historischen Palais Erzherzog Carl
untergebracht. Im 16. Jahrhundert stand hier das kaiserliche Gießhaus
und diente unter anderem der Produktion von Geschützen. Kaiser Rudolf
II. schenkte 1603 seinem Hofkriegssekretär Heinrich Nickhard dieses
Anwesen. 1707 war das von Kaiser Joseph I. gegründete Versatz- und
Fragamt hier ansässig, ein Vorläufer des heutigen „Dorotheums“. Dieses
übersiedelte später in die Dorotheergasse und wurde dort zu einem
weltbekannten Auktionshaus. Zwischen 1720 und 1730 wurde es von einem
Architekten aus dem Umkreis von Johann Lucas von Hildebrandt umgebaut.
Einer der populärsten Habsburger, der Feldherr Erzherzog Karl von
Österreich-Teschen (damalige Schreibweise: Carl, 1771–1847), erwarb zu
Beginn des 19. Jahrhunderts das Gebäude, ließ es zum Palais umgestalten
und bezog es im Jahr 1805. 1809 siegte er in der Schlacht bei Aspern
über Napoleon I. Karls Gemahlin, Prinzessin Henriette Alexandrine von
Nassau-Weilburg, ließ hier 1816 den ersten Weihnachtsbaum am Wiener Hof
aufstellen und begründete dadurch diese Tradition im Hause
Habsburg-Lothringen. Jedoch war es Fanny von Arnstein, die 1814 den
ersten historisch bezeugten Weihnachtsbaum in Wien aufstellen ließ.

Wie entsteht ein Ton, was hört ein Baby im Mutterleib, und wie fühlt es
sich an die Wiener Philharmoniker zu dirigieren? Über eine Klangtreppe
führt der Weg in neue Perspektiven und Hörwelten auf vier Etagen.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzten die Philharmoniker ihre 1933
begonnene Linie fort und banden alle bedeutenden Dirigenten an sich:
Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Hans
Knappertsbusch, Clemens Krauss, Dimitri Mitropoulos, Eugene Ormandy,
Carl Schuricht, Georg Szell, Bruno Walter, Carlo Maria Giulini, Sir
Georg Solti oder Claudio Abbado, Christoph von Dohnányi, Bernard
Haitink, Carlos Kleiber, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta,
Riccardo Muti, Seiji Ozawa und André Previn, um nur einige Namen zu
nennen. Einen besonderen Stellenwert in der jüngeren
Orchestergeschichte nimmt die Zusammenarbeit mit den beiden
Ehrendirigenten Karl Böhm und Herbert von Karajan sowie Ehrenmitglied
Leonard Bernstein ein.
Der erste Raum in der dritten Etage beinhaltet eine Hologramm-Galerie
von den Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven, Franz Schubert und Johann
Strauss (Sohn). Er dient als Einstimmung auf die kommenden
Komponistenräume.
Der zweite Raum ist Joseph Haydn gewidmet. Er gilt als Wegbereiter und
Erneuerer der Wiener Klassik. Inhaltlich wird auf das Streichquartett
fokussiert, da Haydn als „Vater“ der Gattung Streichquartett gilt. So
ist etwa ein Faksimile vom sogenannten „Kaiserquartett“, op. 76, Nr. 3
ausgestellt. Weiters ist ein Exemplar eines ausgestopften Graupapageis
zu sehen. Haydn nahm sich so einen von seiner zweiten Londonreise
1794/95 mit nach Hause. Dieser konnte angeblich sprechen und die
Melodie des „Kaiserquartetts“ pfeifen.

Schallplatten- und Filmaufnahmen, Konzertreisen in alle Welt, die
Teilnahme an den bedeutendsten Festivals - die Wiener Philharmoniker
entsprechen voll den Anforderungen des heutigen multimedialen
Musik„betriebs" und setzen doch Akzente von unvergleichlicher
Individualität wie etwa mit dem Neujahrskonzert oder mit ihrer
dominierenden Rolle bei den Salzburger Festspielen. Die Wiener
Philharmoniker sind nicht bloß Österreichs begehrtester
„Kulturexportartikel", sondern Botschafter des mit Musik untrennbar
verbundenen Gedankens von Frieden, Humanität und Versöhnung, was etwa
bei der Papstmesse in Rom mit Karajan (1985) oder vor allem bei der
Israel-Tournee mit Bernstein (1988) in bewegender Weise zum Ausdruck
kam. Für ihre künstlerischen Leistungen erhielt die hinsichtlich ihrer
Struktur und Tradition einzigartige Künstlervereinigung zahlreiche
Preise, Goldene Schallplatten, nationale und internationale
Auszeichnungen sowie die Ehrenmitgliedschaft vieler kultureller
Institutionen. Eine Würdigung ganz besonderer Art stellt die Herausgabe
der ersten europäischen Gold-Barrenmünze „Wiener Philharmoniker" durch
die Republik Österreich im Jahre 1989 dar.

500 Jahre Wiener Hofmusikkapelle
Die Anfänge der Wiener Hofmusikkapelle können aufgrund des kaum
vorhandenen Quellenmaterials nicht eindeutig belegt werden. Mit
Sicherheit lässt sich jedoch nachweisen, dass bereits unter dem
Habsburger Albrecht I. (1255-1308) eine Hofkapelle existierte. Ihre
Aufgabe war es, sowohl geistliche als auch weltliche Feste entsprechend
zu gestalten.
Von großer Bedeutung für die Hofkapelle war die Regierungszeit
Maximilian I. (1459-1519). Der Kaiser erließ am 7. Juli 1498 eine
Anordnung über die Neuorganisation der Hofkapelle in Wien. Dieses Datum
wird im allgemeinen als die Geburtsstunde der Wiener Hofmusikkapelle
angesehen. Bedeutende Musiker wie Heinrich Isaac (um 1450-1517), Paul
Hofhaimer (1459-1537) oder Ludwig Senfl (um 1486-1543) wurden nach Wien
berufen. Diese Maßnahmen bewirkten, dass Wien innerhalb kurzer Zeit zum
Zentrum abendländischer Musik aufstieg.
Mit dem Beginn der Barockzeit in Österreich (etwa um 1620) begann auch
eine neue Epoche der höfischen Musik. Nun war der italienische Einfluss
vorherrschend. Die Zahl der Musiker aus Italien stieg nach 1619
schlagartig an: Hofmusikkapellmeister wie Priuli, Valentini, Bertali,
Sances oder Ziani legen hier beredtes Zeugnis ab. Der Musikpflege kam
in dieser Epoche die große musikalische Begabung der drei
komponierenden Kaiser, Ferdinand III., Leopold I. und Joseph I.,
entgegen, die die Hofkapelle sehr förderten.

Die Ehrungen Haydns
Haydn war zu seinen Lebzeiten in ganz Europa bekannt und wurde mit
vielen offiziellen Ehrungen bedacht. 1803 wurde ihm von der Stadt Wien
die „Salvatormedaille" verliehen, 1804 erhielt er Ehrenbürgerschaft.
Die Philharmonischen Gesellschaften und Musikalischen Akademien in
Paris, Amsterdam, Petersburg, Laibach und Modena zeichneten ihn auch
aus. Die Académie Française ernannte Haydn 1802 zu ihrem ersten
ausländischen Mitglied. 1791 wurde ihm das Ehrendoktorat der
Universität Oxford verliehen. Haydn war sehr stolz auf diese Ehrungen
und soll im Scherz gesagt haben, er wolle seine Titel in goldenen
Buchstaben auf einer schwarzen Tafel vor seinem Hause aufhängen lassen.
Joseph Haydn - „Gott erhalte" und Kaiserquartett op. 76/3
Haydn komponierte das „Kaiserlied", das die erste Hymne der
Österreichischen Monarchie wurde, zwischen Mitte Oktober 1796 und
Jänner 1797, zu einem Text von Leopold Haschka (1749-1827). Ob das
„Gott erhalte" auf Anregung des Niederösterreichischen
Regierungspräsidenten Franz Josef Graf von Saurau entstanden ist, oder
ob Haydn aus England seine Begeisterung für die Hymne „God save the
King" mitgebracht hat, bleibt offen. Der Textdichter hielt sich
jedenfalls ziemlich genau an die englische Vorlage. Die Uraufführung
erfolgte am 12. Februar 1797 an mehreren Orten der Monarchie
gleichzeitig und erfuhr rasch weite Verbreitung. Haydn liebte seine
eigene Komposition, die durchaus Gebetscharakter hat, sehr und hat sie
in seinen letzten Lebensjahren selbst oft am Klavier gespielt. 1797
verwendete Haydn das Lied als Thema für einen Variationssatz in seinem
Streichquartett op. 76 Nr. 3, das den Beinamen „Kaiserquartett"
erhielt. 1854 wurde die Melodie mit einem Text von Johann Gabriel Seidl
die offizielle österreichische Nationalhymne, bis zum 12. November
1918, der Proklamation der Republik Österreich. Das „Kaiserlied" Haydns
dient auch nach dem 2. Weltkrieg als Melodie der Nationalhymne
Deutschlands.
Kaiser Franz I., Kupferstich, Artaria Wien, 1810
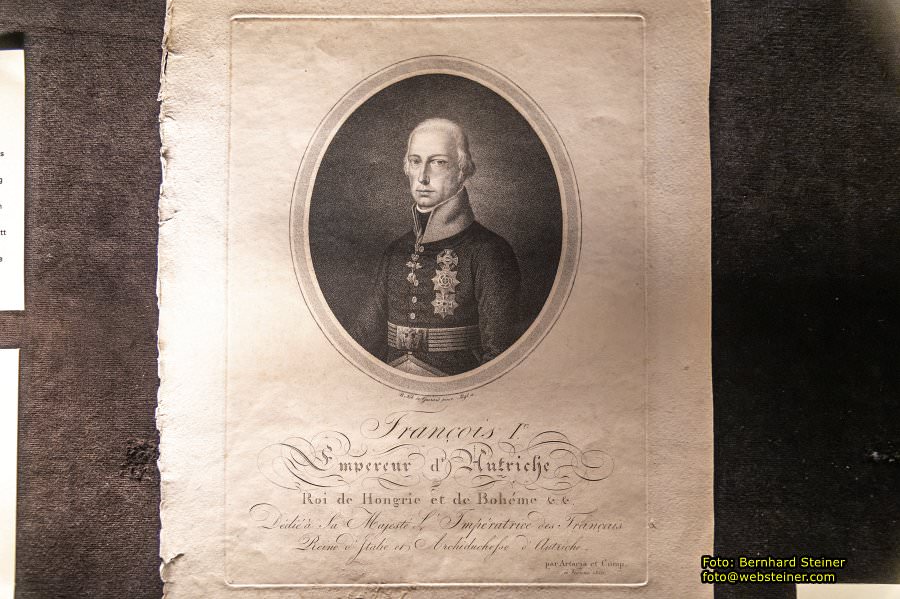
Am Hofe des ebenfalls sehr musikalischen Karl VI. wirkte mit dem
Hofkapellmeister Johann Joseph Fux (1660-1741) seit langer Zeit wieder
ein Österreicher, der eine große Zahl von Messen, Opern und Oratorien
schuf. Die Regierungszeit Karl VI. bedeutete für die Hofmusikkapelle
eine Epoche höchster Akzeptanz, in der sie gleichsam zum Teil der
Reichsidee wurde. Das vielfältige Aufgabengebiet umfasste neben dem
liturgischen Bereich auch die weltliche Repräsentation bis hin zur
Tafelmusik am kaiserlichen Hof.
Unter Maria Theresia verlor die Hofmusikkapelle an Bedeutung, ihre
Funktion wurde auf den liturgischen Dienst und auf die Unterhaltung des
Kaiserhauses eingeschränkt. Zwischen 1788 und 1824 wirkte Antonio
Salieri (1750-1825) als Hofkapellmeister. Unter seinen Nachfolgern sind
vor allem Joseph von Eybler (1765-1846), Ignaz Aßmayer (1790-1862) und
Benedict Randhartinger (1802-1893) zu nennen. Franz Schubert war
Hofsängerknabe, bewarb sich aber später vergeblich um die Stelle des
Vizekapellmeisters. Mit Anton Bruckner (1824-1896) wirkte an der
Hofmusikkapelle ein großer Organist, dessen berührende Kompositionen
auch heute oft auf dem Spielplan stehen.
Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde
die Hofmusikkapelle 1921 dem damaligen Staatsamt für Inneres und
Unterricht unterstellt. Heute zählt sie zu den bedeutendsten
Einrichtungen der Republik Österreich auf musikalischem Gebiet, kann
als Wiege der Musik in Wien angesehen werden und genießt national wie
international einen hervorragenden Ruf. Der Hofmusikkapelle obliegt die
Pflege der Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung der
österreichischen Tonkunst. Daher sind viele kirchenmusikalische
Kompositionen Joseph Haydns auch heute noch ein wesentlicher
Bestandteil ihres Repertoires.
Weiterhin wirken in der Hofmusikkapelle die hervorragendsten Musiker des Landes:
- Mitglieder der Wiener Philharmoniker
- Wiener Sängerknaben
- Mitglieder des Herrenchors der Wiener Staatsoper
* * *
Der dritte Raum ist Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet. Ausgestellt sind
unter anderem ein Familienportrait aus dem Jahre 1781 und mehrere
kleine, über 250 Jahre alte „Tanzmeistergeigen“. Thematisiert wird
ebenso die Oper „Die Zauberflöte“, aber auch die Reisen Mozarts. Eines
der Highlights im „Mozart-Raum“ ist das so genannte „NAMADEUS -SPIEL“,
ein interaktives Computerprogramm, das Mozarts musikalischem Spiel KV
516f nachempfunden wurde. Damit kann jeder Besucher seinen Namen in
eine originale Mozart-Interpretation umwandeln. Für jeden Buchstaben im
Alphabet ließ Mozart sich zwei Takte und eine Variante einfallen.
Dieses Spiel dachte sich Mozart im Jahr 1787 für seine Klavierschülerin
Franziska von Jacquin aus. Ebenso interaktiv ist in diesem Raum das
„Facing Mozart“. Dabei sitzt man dem Komponisten – analog eines
Spiegelbildes – gegenüber und kann mittels „Facetracking“ in die Rolle
Mozarts schlüpfen um dessen Kopfbewegung und Mimik zu steuern.

Tagesordnung des Sel. Herrn von Haydn
In der Sommerzeit war bestimmt, um halb sieben Uhr aufzustehen. Die
erste Beschäftigung war das Rasieren, welches er bis in sein 73tes
Lebensjahr selbst verrichtete. Nach dem Rasieren kleidete er sich
gänzlich an. Wenn ein Scolar während dem Ankleiden bei ihm war so mußte
derselbe seine aufgegebene Lektion auf dem Clavier dem Herrn von Haydn
vorspielen. Die Fehler wurden sogleich korrigiert, der Schüler deswegen
belehrt, und dann ein neues Exempel aufgegeben. Dazu wurden eine und
eine halbe Stunde verwendet. Punkto 8 Uhr mußte das Frühstück auf dem
Tische stehen, und gleich nach dem Frühstück setzte sich Haydn zum
Clavier und fantasierte, entwarf nebenbey gleich die Skitze von der
Composition, dazu war täglich die Zeit von 8 bis halb zwölf morgens
bestimmt. Um halb zwölf wurden Visiten angenommen oder gemacht, oder es
erfolgte ein Spaziergang bis halb zwei Uhr. Von 2 bis 3 Uhr war die
bestimmte Stunde zum Mittagspeisen. Nach Tisch nahm Haydn immer eine
kleine häusliche Beschäftigung vor, oder er ging dann wieder an die
musikalische Beschäftigung. Er nahm dann die des morgens entworfene
Skitze und setzte sie in Partitur, wozu er 3 bis 4 Stunden verwendete.
Um 8 Uhr abends ging Haydn gewöhnlich aus, kam aber um 9 Uhr wieder
nach Hause, und setzte sich entweder zum Partiturschreiben, oder er
nahm wieder ein Buch und las bis 10 Uhr. Die Zeit um 10 Uhr war zum
Nachtessen bestimmt, welches in Brod und Wein bestand. Haydn hatte sich
ein Gesetz daraus gemacht, Abends nichts anderes als Wein und Brod zu
genießen, welches er nur dann und wann übertrat, wenn er irgendwann zum
Essen eingeladen war. Bey Tische liebte Haydn ein scherzhaftes Gespräch
und überhaupt eine muntere Unterhaltung. Um halb zwölf Uhr ging Haydn
zu Bette; in seinem Alter auch noch später. Die Winterzeit machte im
Ganzen keinen Unterschied in der Tagesordnung, also daß Haydn morgens
eine halbe Stunde später aufstand, alles Übrige blieb wie im Sommer. Im
hohen Alter, vorzüglich die letzten 5 bis 6 Jahre seines Lebens,
zerstörten körperliche Schwächen und Krankheiten die oben beschriebene
Ordnung. Der thätige Mann konnte sich endlich nicht mehr beschäftigen.
Auch hatte sich Haydn in dieser Epoche an eine halbstündige
Nachmittagsruh gewöhnt.

Königin der Nacht Arie „Der Hölle Rache"
"Die Zauberflöte" KV 620 ist eine deutsche Oper in zwei Aufzügen von
Wolfgang Amadeus Mozart. Basierend auf dem Libretto von Emanuel
Schikaneder wurde dieses Werk am 30. September 1791 im Freihaustheater
in Wieden uraufgeführt. Bei der Erstaufführung spielte die 33-jährige
Schwägerin von Mozart, Josepha Hofer (1758-1819), die Rolle der Königin
der Nacht. Ihr wurden die Arien "auf den Leib" geschrieben, da sie eine
sehr bewegliche Stimme mit einem ausgeprägten hohen Register hatte. Der
Tonumfang geht über zwei Oktaven, vom f1 bis zum f3.
Im zweiten Akt „Der Zauberflöte" gibt die, von Rachsucht getriebene
Königin der Nacht, ihrer Tochter Pamina ein Messer und trägt ihr auf,
ihren Rivalen Sarastro zu ermorden. Andernfalls verstoße und verlasse
sie ihre Tochter Pamina. „Fühlt nicht durch dich Sarastro
Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr." Dieses
anspruchsvolle Musikstück der Königin der Nacht wurde in d-Moll
komponiert. Diese Tonart hatte bei Mozart oftmals dramatisch
hochgeladene, düster-schicksalsschwere Bedeutung, wie es beispielsweise
in der Ouvertüre zu Don Giovanni oder im Klavierkonzert KV 466 zu hören
ist.

Ludwig van Beethoven komponierte seine 3. Symphonie op. 55 „Eroica"
genannt, in der Hauptsache im Jahre 1803 (erste Skizzenniederschriften
1802). Er widmete sie zunächst Napoleon I. Bonaparte, änderte jedoch
seine Meinung, als sich dieser 1804 zum Kaiser der Franzosen machte.
Beethoven soll nach zeitgenössischen Berichten das Titelblatt seines
Autographs herausgerissen haben. Dieses Original ist verschollen.
Im Titelblatt von Beethovens Handexemplar der Partitur (von einem
Kopisten geschrieben und von Beethoven korrigiert und ergänzt) hat der
Komponist die Widmung ausgestrichen und zwar so heftig, dass das Papier
Löcher bekam. 1806 erschienen die Stimmen und die Symphonie erhielt den
Beinamen „Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sowenire di un
grand Uomo". Diesmal galt die Widmung Fürst Lobkowitz, einem großen
Förderer Beethovens, der selbst Violine spielte und dessen eigenes
Orchester häufig Werke des Meisters aufführte.

Der vierte Raum ist Ludwig van Beethoven gewidmet. Der inhaltliche
Fokus liegt etwa auf seinen vielen (insgesamt 67) Umzügen in Wien und
dem heutigen Niederösterreich. Auf einer virtuellen Karte sind alle
Wohnorte verzeichnet, über die man im Einzelnen mehr erfahren kann.
Ebenso wird Beethovens Hörverlust und seine Taubheit ausführlich
thematisiert. Dies wird anhand von Hörstationen mit seinen Musikstücken
veranschaulicht. Die originale Eingangstüre jener Wohnung, in der
Beethoven gestorben ist, sowie mehrere Objekte zum Alltag des
Komponisten sind ebenso ausgestellt. Der Fokus hinsichtlich seines
Musikschaffens liegt in diesem Ausstellungsbereich auf seiner 3.
Sinfonie „Eroica“ und auf seiner einzigen Oper „Fidelio“.

Porträtbüste Ludwig van Beethoven
Alfred Grünfeld (Gipsabguss nach Kaspar Clemens von Zumbusch)

Der fünfte Raum ist Franz Schubert gewidmet. Inhaltlich liegt der
Schwerpunkt dort auf seinem Lied-Schaffen und den sogenannten
„Schubertiaden“. Der Raum ist wie ein Biedermeierzimmer gestaltet.
Ungewöhnlich scheint der Anblick einer originalen Schubertbrille,
welche wie eine Kinderbrille anmutet, jedoch dem erwachsenen Schubert
gehört hatte.
Bronzebüste Franz Schuberts

Tafelklavier im Stile von Johann Fritz (Wien, ca. 1810)

Joseph Haydn
Joseph Haydn wurde ein Weltstar. Er ist der älteste der sechs
Komponisten, welche im 3. Stock vorgestellt werden. Er wurde im
Spätbarock geboren und gilt als “Erfinder” des Streichquartetts.
Bekannt wurde er auch mit seinen 104 (!) Symphonien und anderen Werken.
Sein Papagei konnte die Hymne pfeifen, welcher er für Kaiser Franz I.
(II.) geschrieben hatte und sogar die Worte “Papa Haydn” krächzen.
Wolfgang A. Mozart
Auch den geborenen Salzburger zog es nach Wien – in die Welthauptstadt
der Musik. Hier konnte er sein Genie entfalten. Sein Leben ist Legende
und bot viel Stoff für die Nachwelt. Seine Person umgibt ein besonderer
Flair.
Ludwig van Beethoven
Er kam aus Bonn und zog mit 22 Jahren nach Wien um dort berühmte
Symphonien zu schaffen. Eine der bekanntesten schrieb er, als er
bereits völlig taub geworden war: Die 9. Symphonie. Dazu zog er 68 Mal
um und wurde sogar als Landstreicher verhaftet. Erfahren Sie mehr über
den eigensinnigen Komponisten!

Franz Schubert
Der bescheidene und zurückhaltende Mann berührte die Menschen mit
seinen mehr als ausdrucksstarken Liedern. Sein Künstlerleben endete
viel zu früh. Er musizierte im kleinen Kreis. Zu seinem ersten Konzert
musste er regelrecht überredet werden.
Johann Strauss
Der Komponist aus Wien führte den Walzer zum weltweiten Triumph.
Geboren am Ende der Wiener Klassik stand er für die Unterhaltungsmusik
seiner Zeit. Die Haarlocken für seine Verehrerinnen soll er von einem
Pudel abgeschnitten haben.
Gustav Mahler
Die Natur, der See und der Wald dienten ihm als Heimat und Refugium.
Dort war er, von Blumen und Vögeln umgeben, glücklich, einsam, in
seinem Element, allein mit sich und der Musik. Gustav Mahler war aber
nicht nur leidenschaftlicher Komponist, sondern auch Dirigent und
Direktor der Wiener Hofoper.

TAFELKLAVIER (1865), Vogel & Sohn J.G. Plauen
Korpus: Nussbaum, Tasten: Elfenbein, Ebenholz

Den vorletzten Raum bildet der so genannte „Raum der Stille“, auch
„Acoustic Reset“ Raum genannt. Es ist ein schallreduzierter Raum,
welcher der Stille gewidmet ist. Dieser Moment der Stille soll ein
Gegenpol zu den Klängen der Ausstellung und des alltäglichen Lebens
sein. Die Reise durch die Welt der Klänge nimmt hier sein Ende.
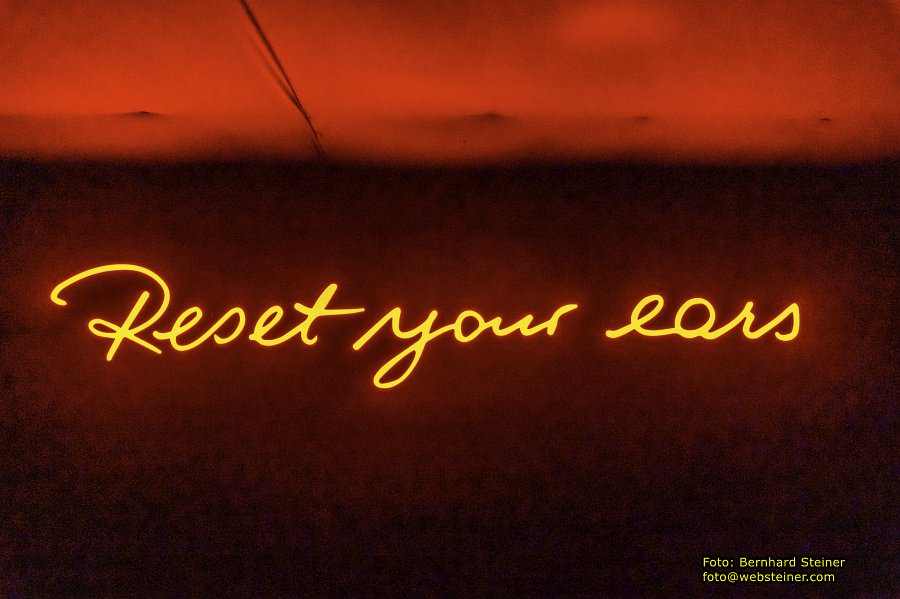
Der Museumsshop befindet sich am Ende der 4. Etage. Hier sind die
Musik-Urkunden zu den Installationen in der Ausstellung erwerbbar sowie
diverse Klang-Souvenirs.
