web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Innsbruck
Landeshauptstadt von Tirol, Oktober 2024
Innsbruck (im lokalen bairisch-österreichischen
Dialekt Innschbrugg ausgesprochen) ist eine Großstadt im Westen
Österreichs und Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Wahrzeichen der
alten Hauptstadt der Gefürsteten Grafschaft Tirol ist das Goldene Dachl. Mit
über 130.000 Einwohnern ist Innsbruck die bevölkerungsreichste Stadt
Tirols und zugleich fünftgrößte Stadt Österreichs (nach Wien, Graz,
Linz und Salzburg).

Triumphpforte - Die nach alter
Tradition der Begrüßungspforten erbaute Ehrenpforte wurde im Jahre 1765
anlässlich der Hochzeit des späteren Kaisers Leopold II. mit der
spanischen Infantin Maria Ludovica aus Steinen des Vorstadttores
errichtet. Die Südseite erinnert an die Hochzeit, die Nordseite an
Kaiser Franz I. Stephan, der während der Feierlichkeiten verstarb.

Die Triumphpforte gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von
Innsbruck. Sie befindet sich am südlichen Ende der heutigen
Maria-Theresien-Straße, seinerzeit dem südlichen Stadtausgang. Erbaut
wurde dieser Triumphbogen 1765 aus Anlass der Hochzeit von Erzherzog
Leopold, dem zweiten Sohn von Kaiserin Maria Theresia und Franz Stephan
von Lothringen, mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica am 5.
August 1765. Da Leopolds Vater Franz Stephan unerwartet kurz nach der
Hochzeit am 18. August 1765 starb, wurden auch Trauermotive anlässlich
seines Todes in der Triumphpforte verarbeitet. Die Südseite zeigt
Motive im Sinne der Hochzeit des jungen Paares, die Nordseite solche,
die auf den Tod des Kaisers hinweisen.

Das Winklerhaus bleibt als kleine Sehenswürdigkeit der Stadt von
Einheimischen und Touristen gleichermaßen häufig unbemerkt. Zu Unrecht,
ist es doch eines der wenigen Jugendstilhäuser Innsbrucks. 1902
errichtet, verbinden sich im Winklerhaus zwei Gebäude in zwei Straßen.
Von der Leopoldstraße aus kann man die Fassade mit den reichen und
ausladenden Ornamenten bewundern. Die Tiere, Fabelwesen und Masken auf
den Kapitellen sind typisch für den verspielten Jugendstil. Der Teil
des Winklerhauses in der Maximilianstraße ist weniger bunt, aber nicht
weniger sehenswert. Besonders der mit zwei Fabelwesen verzierte Erker
weist auf einen fantasievollen und kreativen Bauherrn hin:
"Sehe jeder wie er's treibe,
Sehe jeder wo er bleibe,
Und wer steht,
dass er nicht falle."
Maximilianstraße 1, 6020 Innsbruck

Das Servitenkloster samt Kirche
wurde von Anna Katharina Gonzaga 1614 gestiftet, die auch den
Servitenorden nach Innsbruck holte. Sie ist wie ihre Tochter Maria im
Kreuzgang bestattet. Ein Bomben-angriff am 15.12.1943 zerstörte beide
Bauten fast vollständig. Der Kirchenwiederaufbau mit Fresken von Hans
Andre fand ab 1945 statt.

Der Tiroler Landtag ist
das Legislativorgan des österreichischen Bundeslandes Tirol, dem die
Landesgesetzgebung obliegt. Der Tiroler Landtag setzt sich aus 36
Abgeordneten zusammen und wird alle fünf Jahre neu gewählt. Sitz des
Landtags ist das Alte Landhaus in Innsbruck.
Das Alte Landhaus (Ständehaus) in Innsbruck ist der Sitz des Tiroler
Landtages. Das Gebäude wurde von 1725 bis 1734 nach Plänen von Georg
Anton Gumpp errichtet. Es gilt als der bedeutendste barocke Profanbau
Innsbrucks und steht unter Denkmalschutz. Neben den Räumlichkeiten des
Tiroler Landtages beherbergt das Landhaus auch die Amtsräume des
Landeshauptmanns.

Palais Troyer-Spaur auf Maria-Theresien-Straße 39, 6020 Innsbruck

Tiroler Landtag an der Ecke Maria-Theresien-Straße und Meraner Straße

Turm der Spitalskirche zum Heiligen Geist mit Gebirgskulisses der Nordkette

Kaufhaus Tyrol - Über 50 Läden und Lokale auf mehreren Ebenen in einem modernen Einkaufszentrum mit imposanter Architektur.

Annasäule - Bauwerk von 1703 mit kunstvoller roter Marmorsäule mit einer Statue der Jungfrau Maria.

Spitalskirche zum hl. Geist -
Bereits ab 1320 ist eine Kapelle im Stadtspital belegt, die 1381
erstmals als „Kirche" bezeichnet wurde. Ihre barocke Form erhielt sie
1700/01 durch einen von Johann Martin Gumpp angeregten Umbau. Ebenfalls
ab 1320 nachweisbar ist der angrenzende ehemalige Spitalsfriedhof. Er
diente von 1509 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als städtischer
Friedhof.
Die Ostseite der Kirche mit ihren beiden Portalen ist Teil der
Häuserreihe der Maria-Theresien-Straße und wirkt heute etwas
eingesunken, weil die Nachbarhäuser im 19. Jahrhundert aufgestockt
wurden. Der Turm mit seinem Zwiebelhelm hat ein Innsbrucker Motiv
aufgegriffen. Gemeinsam mit Stadtturm (Zwiebelhaube 1560), Hofkirche
(1565) und Servitenkirche (1626) ergibt sich ein reizvolles
harmonisches Innsbrucker Turmensemble. Auf der Spitze des Turmes thront
eine Messingplastik des Heiligen Geistes.

Bei der Restaurierung 1959 bis 1962 wurden die durch Bombenschäden im
Zweiten Weltkrieg zerstörten restlichen Fresken von Hans Andre neu
gemalt. Die Deckengemälde stellen das Pfingstwunder und die Bergpredigt
dar. Von der Bergpredigt ausgehend beginnen im Uhrzeigersinn die acht
Seligpreisungen in den Seitenfeldern (Selig, die arm sind vor Gott.
Selig, die Trauernden. Selig die Sanftmütigen. Selig, die hungern und
dürsten nach der Gerechtigkeit. Selig die Barmherzigen. Selig, die rein
sind im Herzen. Selig, die Frieden stiften. Selig, die verfolgt werden
um der Gerechtigkeit willen. Vgl. Mt 5,3-10)

Der barocke Hochaltar enthält
das von Caspar Jele 1848 gemalte Pfingstwunder. Neben den äußeren
vorgestellten Säulen steht links Mose mit den Gesetzestafeln, rechts
König David mit Harfe. Der Tabernakel von Hans Kölblinger aus dem Jahr
1962 symbolisiert das Zelt Gottes. Die zwölf Karneolen symbolisieren
die zwölf Apostel. Die Seitenaltäre (1705) stammen von Michael
Stippler. Sie sind aus Holz gefertigt, marmorisiert und bestehen
jeweils aus vier Säulen und dem Ziborium. Das Altarbild am rechten Seitenaltar
wurde von Ulrich Glantschnigg um 1709 gefertigt und stellt Joachim und
Anna mit ihrer Jugendlich verklärten Tochter Maria dar. Der linke Seitenaltar
birgt das aus der Pfarrkirche St. Jakob stammende spätgotische
Holzkreuz (um 1515). Die außergewöhnliche Intensität des Ausdrucks
erinnert stark an die Werke von Veit Stoss. Ziemlich sicher stammt das
Kreuz aus dem Umkreis von Kaiser Maximilian I. Die nachgedunkelte
Fassung hat zum Beinamen „Schwarzes Kreuz” geführt. Auf der Mensa wird
das Mariahilfbild „Maria vom guten Rat” aus der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts verehrt.

Die Kanzel stammt aus dem Jahr
1706 und ist ein Werk von Benedikt Fries. 1962 wurde sie von Franz
Roilo restauriert, der auch den knienden Engel als Bekrönung geschaffen
hat. Wie viele Kapellen und Kirchen bei (ehemaligen) Krankenhäusern hat
die Spitalskirche das Patrozinium „Zum Heiligen Geist“. Als Geist der
Heilung und des Trostes stärkt er Menschenin ihren vielfältigen
Belastungen und Sorgen. Die Spitalskirche dient seit Oktober 2018 als
„Citykirche” und trägt den Namen „Kirche im Herzen der Stadt“. Sie hat
die Bestimmung, als einladender, gastfreundlicher und offener Raum neue
Formen von Gebet, Kultur, Musik und Kunst zu ermöglichen und für
Menschen unserer Zeit Wege der Begegnung mit dem Glauben zu
erschließen. Zugleich will sie im Sinne der Seelsorge an PassantInnen
ein Ort des niederschwelligen Kontakts mit Glaube und Kirche sein.

Der Hochaltar aus Stuckmarmor
ist das Werk von Christoforo Benedetti aus Trient und wurde 1705
aufgestellt. 1728 hat Benedetti auch den Hochaltar im jetzigen Dom zu
St. Jakob gefertigt. Der Volksaltar wurde 1996 von Bildhauer Hermann
Ruetz und Schmiedemeister Thomas Nairz geschaffen. Ihr Auftrag war,
einen Altar zu gestalten, der formal und oberflächenmäßig eine
Ergänzung zum Ambo darstellt.

Die Stukkaturen entstanden 1701 bis 1704. Sie beinhalten Engelsköpfe,
ganzfigurige Putten bekrönt mit Muscheln, Fruchtkörben und Schalen,
Blätter und Ranken. Von den ursprünglichen Fresken von Johann Josef
Waldmann (1702/03) ist nur noch das Deckenbild im Orgelchor erhalten.
Es zeigt die Muttergottes mit gesenktem Zepter nach unten weisend.

Hölblinghaus, Herzog-Friedrich-Straße 10
Dieses gotische Bürgerhaus des 15. Jahrhunderts erhielt vermutlich von
dem um 1723 nach Innsbruck übersiedelten Stuckateur Anton Gigl aus
Wessobrunn seine üppige barocke Fassade. Der Name des Hauses geht auf
Sebastian Hölbling zurück, in dessen Besitz es von 1800-1827 war.

Zunftzeichen der Familie Egger von 1631 und der Rathausturm

Hof- und Franziskanerkirche - Im Auftrag von Kaiser Ferdinand I. wurde nach Plänen von Andrea Crivelli von 1553-1563 die Hofkirche
erbaut und dem Franziskanerorden übergeben. Im Inneren befindet sich
das Grabmal von Kaiser Maximilian I. (1459-1519) mit den berühmten
Bronzefiguren und dem leeren Sarkophag sowie das Grab des Tiroler
Freiheitskämpfers Andreas Hofer (1767-1810).
Die Hofkirche in Innsbruck, auch „Schwarz-Mander-Kirche"
genannt, ist mit dem Grabmal Kaiser Maximilians I. (1459-1519) das
bedeutendste Grabdenkmal eines römisch-deutschen Kaisers. Hinter der
schlichten Fassade verbirgt sich ein Gesamtkunstwerk, für dessen
Fertigstellung es nahezu ein Jahrhundert brauchte. International
namhafte Künstler waren daran beteiligt. 28 überlebensgroße
Bronzestatuen von Ahnen und Vorbildern des Kaisers flankieren das
Hochgrab aus feinteiligen Marmorreliefs. Die Idee dazu stammte von
Maximilian selbst. Neben der dauerhaften Erinnerung an ihn sollte in
dem Grabmal auch der Ruhm des Hauses Habsburg fortbestehen.
Als Maximilian 1519 starb, war allerdings erst ein Teil der Figuren
gegossen. Weder der Ort noch die Gestaltung seines Grabes waren von ihm
festgelegt. Im letzten Testament verfügte Maximilian seine Beisetzung
in der St. Georgs-Kapelle seiner Burg in Wiener Neustadt, wo er bis
heute ruht. Erst sein Enkel - Kaiser Ferdinand I. (1503-1564) -
beschloss 1547 den Bau der Hofkirche mit einem Hochgrab und
angrenzendem Franziskanerkloster (heute Tiroler Volkskunstmuseum) in
Innsbruck. Vollendet wurde das Grab mit der knienden Bronzefigur
Maximilians I. am Grabdeckel schließlich unter Erzherzog Ferdinand II.
von Tirol (1529-1595), dem Sohn Ferdinands I. Als Grabstätte für sich
und seine bürgerliche Gemahlin Philippine Welser ließ er außerdem die
Silberne Kapelle nordwestlich an die Hofkirche anbauen.
KIRCHE UND HOCHGRAB
um 1500 Ideen Maximilians I. zum Bau eines Grabstiftes in Innsbruck, St. Wolfgang oder Mondsee
1519 Tod Kaiser Maximilians I.
1553-1563 Bau der Hofkirche mit angrenzendem Franziskanerkloster
1561-1582 Hochgrab
1584 Figur Maximilians I. am Grabdeckel - Abschluss der Arbeiten am Grabmal
1578-1586/87 Silberne Kapelle

Den zentralen Platz der Kirche nimmt das Kaisergrab ein. Gleichzeitig
beherbergt die Kirche legendäre Lokalhelden wie den Freiheitskämpfer
Andreas Hofer. Er führte 1809 tausende tapfere Tiroler am Bergisel
gegen die Übermacht der napoleonischen Truppen. Und wurde dafür in
Mantua hingerichtet. Doch in Innsbruck verehrt man ihn weiterhin als
Helden. Die Hofkirche ist übrigens auch die Ruhestätte seiner
Mitstreiter Josef Speckbacher, Joachim Haspinger und Kajetan Sweth.
Andreas Hofer wurde nach seiner
Hinrichtung 1810 in Mantua beigesetzt. 13 Jahre später holten Offiziere
des Kaiserjägerregiments Hofers sterbliche Überreste aus seinem Grab.
Die Gebeine wurden nach Innsbruck gebracht, wo sie in der Hofkirche
beigesetzt wurden. 1834 wurde das Hofer-Denkmal von Johann Nepomuk
Schaller errichtet.
Grabmal Andreas Hofers (Tiroler
Freiheitskämpfer, + 1810), eingeweiht 1834, Marmorstatue: Johann
Nepomuk Schaller, Relief: Fahnenschwur, Josef Klieber, 1838

In der Kaiserlichen Hofkirche stehen 28 schwarze Männer Wache, deshalb nennt sie der Innsbrucker Volksmund „Schwarzmanderkirche“.
Die lebensgroßen Bronzefiguren bewachen aber nicht die Kirche, sondern
das Grabmal Kaiser Maximilians I in ihrem Inneren. Kurios: acht der
„schwarzen Männer“ sind Damen, und der Sarkophag des Kaisers ist leer.
Dafür kunstvoll gefertigt und wunderschön anzusehen.
Für die Figurenauswahl beauftragte Maximilian I. Hofhistoriker und
Humanisten. Ihre Zusammenstellung zeugt von Selbstverständnis und
Herrschaftsansprüchen der Habsburger Dynastie. Als Könige und Kaiser
sahen sich die Habsburger in einer Traditionslinie mit imperialen
Amtsvorgängern, beginnend bei den römischen Kaisern. Christliche und
ritterliche Idealfiguren sowie Familienheilige belegen den Bezug der
Habsburger zum christlichen Glauben. In diesem begründet sich ihre
kirchliche und weltliche Legitimation. In der Auswahl von
Familienmitgliedern der Habsburger und verschwägerter Herrscherhäuser
zeigt sich ein politisches Netzwerk europäischer Dimension.
Albrecht II. der Weise, Herzog (†1358)
Sohn von König Albrecht I., Vater von Herzog Leopold III., Großvater von Ernst dem Eisernen und Friedrich IV.
Rudolf I. von Habsburg, Römisch-deutscher König († 1291)
Sohn von Graf Albrecht IV., Vater von König Albrecht I.
Philipp der Schöne, Herzog von Burgund und König von Kastilien (+1506)
Sohn von Maximilian I. und Maria von Burgund, verh. mit Johanna die Wahnsinnige
Chlodwig, erster christlicher Frankenkönig (+511)

Tatsächlich liegt Maximilian in Wiener Neustadt begraben. Die
Kirchenmauern und Fundamente dort waren allerdings nicht stabil genug
für die Last seiner mit liebevollen Details gefertigten Begleiter. Ihre
Errichtung hatte er vor seinem Tode minutiös geplant. Dennoch dauerte
es nach seinem Ableben noch drei Jahrzehnte bis zu ihrer
Fertigstellung. Doch wer bewacht den Kaiser post mortem? Dafür erwählte
der Fürst helden- und tugendhafte Ahnen und Gestalten. Seine beiden
Ehefrauen Maria von Burgund und Maria Sforza finden sich darunter.
Sowie der Tiroler Erzherzog Sigmund, König Ferdinand von Portugal und
sogar der sagenumwobene König Artus.
FIGUREN
ab 1502 Vorarbeiten zu den Figuren
1509 Guss der ersten Statue
1550 Guss der letzten Statue
geplant 40 große Standbilder, ausgeführt 28 (20 Männer, 8 Frauen), davon 12 bis zum Tod Maximilians 1519

Die Innsbrucker Hofkirche mit
dem Grabmal Kaiser Maximilians I. ist das bedeutendste Denkmal in Tirol
und das großartigste aller Kaisergräber in Europa. Es ist Zeugnis einer
weit über den deutschen Sprachraum hinausgehenden europäischen
Hofkunst, für die Maximilian die besten Künstler seiner Zeit wie
Albrecht Dürer, Peter Vischer d.Ä u.a. beschäftigte. Die von den
Habsburgern geprägte Hofkunst in Innsbruck ist international, jedoch
auch lokalen Traditionen verbunden. Kaum eine andere Herrschergestalt
ist im Gedächtnis der Bevölkerung so lebendig geblieben wie Maximilian
I. (1459–1519). Mit seinem Namen verbindet sich die zentrale Stellung
Innsbrucks in Europa zu jener Zeit.
Hochgrab Kaiser Maximilians I.,
1561-1582, Entwurf: Florian Abel, Hofmaler in Prag, Errichtung:
Hieronymus Longhi, 1567-1572. 24 Reliefs mit Szenen aus dem Leben
Maximilians I., Carrara Marmor, Gebrüder Abel (3 Reliefs), Alexander
Colin (21 Reliefs), 1566 fertiggestellt, Schutzgitter: Jörg
Schmidhammer, Prag, 1573
Bronzefigur Kaiser Maximilians I. am Grabdeckel, Modell: Alexander
Colin, Guss: Ludovico del Duca, 1584, umgeben von den vier
Kardinaltugenden, Modell: Alexander Colin, Guss: Hans Lendenstreich,
1570

Hochaltar, Entwurf: Nicolaus
Pacassi; Hofarchitekt Kaiserin Maria Theresias, 1755, errichtet bis
1758, Altarbild: Kreuzigung, Johann Karl Auerbach, 1766, Bleistatuen:
HI. Franziskus und Theresia (Clara?), Guss: Johann Balthasar Moll,
1766/68
Fürstenchor (Empore), Tischlerarbeit und Intarsien: Hans Waldner, 1567/68 und Konrad Gottfried, 1567/71, darunter Chorgestühl
Ebert-Orgel, Jörg Ebert aus Ravensburg, 1558/61 (älteste Orgel Österreichs], Flügelgemälde: Domenico Pozzo

Kunigunde (†1520)
Tochter Kaiser Friedrichs III., Schwester von Maximilian I.. verh. mit Herzog Albrecht IV. von Bayern
Elisabeth von Görz-Tirol (+1313)
verh. mit König Albrecht I., Stammmutter aller späteren Habsburger (21 Kinder)
Maria von Burgund (+1482)
Tochter von Karl dem Kühnen, erste Gemahlin von Maximilian I., Mutter von Philipp dem Schönen und Margarete
Elisabeth von Ungarn (+1443)
verh. mit König Albrecht II.

Wer die Hofkirche besucht, sollte sich auch die Silberne Kapelle nicht
entgehen lassen. Hier liegen zwei weitere berühmte Innsbrucker
begraben: Erzherzog Ferdinand II und seine Frau Philippine Welser. Sie
war zu Lebzeiten ein hiesiger Superstar: Königin der Herzen,
Kräuterexpertin, Badenixe und von bösen Zungen sogar der Hexerei
bezichtigt. Ein prunkvoller Silberaltar mit Madonna von Hofbaumeister
Giovanni Lucchese beherrscht den Raum neben einer weiteren
Besonderheit: einer Orgel, deren Pfeifen ausschließlich aus Holz
gearbeitet sind.
Die Silberne Kapelle ist an die Hofkirche angeschlossen und befindet
sich über der heutigen Durchfahrt zum ehemaligen Stadtgraben. Sie wurde
als Grabkapelle für Erzherzog Ferdinand II. und seine Frau Philippine
Welser in zwei Etappen von 1578 bis 1596 erbaut. Ihren Namen erhielt
sie von den Silberreliefs des dort befindlichen Marienaltars.
Silberne Kapelle, jüngerer Teil, 1586/87, Architekt: Albert Lucchese
Grabmal Erzherzog Ferdinands II., Liegefigur und Reliefs: Alexander Colin, 1590/96
Leibharnisch Erzherzog Ferdinands II., Hans Jakob Topf, um 1580
Orgel mit Holzpfeifen, Italien, um 1580 (?)
Marienaltar, Gehäuse: Ebenholz
und Elfenbein, Konrad Gottfried, 1577/78, Madonna: getriebenes Silber,
um 1550, umgeben von Mariensymbolen. Gab der Kapelle ihren Namen.

Kenotaph in der Hofkirche mit Bronzestaten
Aufwändig gestaltet sind die Oberflächen der Bronzestandbilder, Ihre
zahllosen Details wurden bei der Vorbereitung der Gussformen in Wachs
modelliert und dann mit Bronze ausgegossen. Die Figuren entstanden im
Hohlguss mit einer Gussstärke von etwa sieben Millimetern.
Haltende Hände weisen fast alle
der Bronzestandbilder auf. So konnte man den Figuren zu besonderen
Anlässen brennende Kerzen in die Hände geben heute sind es mitunter
moderne Leuchten.
Krönungsmantel: Friedrich III,
wurde als letzter römisch-deutscher Kaiser 1452 vom Papst in Rom
gekrönt. Sein Mantel aus schwerem Seidenstoff ist aufwändig mit Perlen
und Figurenapplikationen geschmückt.
Geldbörse: Für einen Herrscher
unüblich, trägt Friedl mit der leeren Tasche einen Geldbeutel am
Gürtel, was als Anspielung auf seinen Beinamen zu verstehen ist. Diesen
erhielt der im Tiroler Volk populäre Herzog ursprünglich als Spottname.
Kleine Gebetbücher dienten dem
täglichen Stundengebet. In den Händen der Bronzedamen sind sie Ausdruck
ihrer Frömmigkeit. Zugleich waren die Büchlein auch kostbare Kunstwerke
und als solche Zeichen von Luxus und Reichtum.
Jakobsmuschel und Granatapfel zieren
die Rüstung Ferdinands von Aragon. Der Granatapfel steht für Macht und
Reichtum, aber auch für das maurische Granada, das 1492 durch die
Katholischen Könige erobert wurde. Die Jakobsmuschel steht für die
Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela.
Der Orden vom Goldenen Vlies wurde
als exklusiver Ritterorden 1430 von Philipp dem Guten in Burgund
gegründet. Als Ordenszeichen dient ein goldenes Widderfell an einer
Prunkkette. Durch die Heirat mit Maria von Burgund ging der Orden auf
Maximilian I. und damit auf die Habsburger über.
Die Schamkapsel ist ein modisch
geformter Hosenlatz. Als Teil der Rüstung besteht sie aus Metall und
ist innen gepolstert. Befestigt wird sie am Bauchreifen. Die Abnutzung
der dunklen Patina an dieser Stelle zeigt, dass sie oft berührt wird.
Brokat ist ein kostbarer
Seidenstoff. Seine Muster aus Gold- und Silberfäden bilden Blüten,
Blätter und Granatäpfel. Man findet ihn als Relief in den Damenkleidern
wie auch den Waffenröcken und Mänteln der Männer.
Geschichten in Stein: Die
Reliefs des Hochgrabes sind aus weißem Marmor geschnitten. Dargestellt
sind Ereig-nisse aus dem Leben Maximilians mit plastischen Figuren im
Vordergrund vor fein gearbeiteten Landschaften.

Friedrich III. war der am längsten regierende Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches: Er herrschte 53 Jahre lang. Berühmt wurde sein
Zeichen "AEIOU", auch wenn es
nicht eindeutig entschlüsselt werden kann. Friedrich wurde 1415 als
Sohn von Ernst "dem Eisernen" und Cimburgis von Masowien geboren. Als
Friedrich neun Jahre alt war, starb sein Vater; Herzog Friedrich IV.,
sein Onkel, übernahm die Vormundschaft. 1435 wurde der nun volljährige
Friedrich Regent der Herzogtümer Steiermark, Kärnten und Krain. Schon
zu dieser Zeit entwickelte der junge Herzog ehrgeizige Pläne für das
"Haus Österreich": Friedrichs Sendungsbewusstsein drückte sich in
seinem Zeichen "AEIOU" aus, das er an Bauten, Gegenständen und
Denkmälern sowie auf Münzen und Schriftstücken als seine Eigentumsmarke
anbringen ließ. Eine Interpretation dieser Buchstabensymbolik lautet
"Austriae est imperare orbi universo" – "Es ist Österreich bestimmt,
die Welt zu beherrschen". Diese und zahlreiche andere Deutungen stammen
jedoch erst aus späterer Zeit.
Bereits Zeitgenossen Friedrichs beschäftigte die Deutung der Zeichen; einige davon lauten wie folgt:
Austriae est imperare orbi universo (es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen)
Austria erit in orbe ultima (Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt)
Während der Besetzung Wiens unter dem ungarischen König Matthias
Corvinus (1485) pflegten die Wiener folgende Interpretation: Aller erst
ist Österreich verloren
Alles Erdreich ist Österreich untertan (16./17. Jahrhundert)
Der deutsche Historiker Konstantin Moritz Langmaier hat 2023 in Graz
die Ergebnisse seiner Forschungen zu A.E.I.O.U., der Herrschaftsdevise
von Kaiser Friedrich III., präsentiert. Historiker sehen deren
Bedeutung nun entschlüsselt. Als Lösung des historischen Rätsels greift
Langmaier auf eine der ältesten, allerdings wenig bekannten
überlieferten Varianten zurück: A.E.I.O.U. steht demzufolge für „Amor
Electis Iniustis Ordinor Ultor“.
Die Wortfolge, die zu Deutsch in etwa „Geliebt von den Erwählten, gefürchtet von den Ungerechten“
lautet, ist in zeitgenössischen Schriftstücken von und über Friedrich
III. zu finden und in einen längeren lateinischen Satz eingebettet:
„En, amor electis, iniustis ordinor ultor; Sic Fridericus ego mea iura
rego.“

Mit ihren prachtvollen Prunkräumen, Sälen und Salons zählt die
Kaiserliche Hofburg zu den
bedeutendsten Kulturbauten Österreichs. Im Jahre 1500 war die Hofburg
Innsbruck unter Kaiser Maximilian I. (1459-1519) fertig gestellt
worden. Sie hatte bereits dieselben Ausmaße wie heute und wurde von
Albrecht Dürer als Aquarell festgehalten.Fast 250 Jahre später besuchte
Maria Theresia (1717-1780) die Kaiserliche Hofburg Innsbruck und
empfand diese nicht mehr zeitgemäß. Die Herrscherin ordnete einen Umbau
im Stil des Wiener Spätbarocks an und schickte ihre besten Künstler
nach Innsbruck: Konstantin von Walter und Nicolaus Parcassi. Zur
Innenausstattung wurden Martin van Meytens und seine Schule sowie Franz
Anton Maulbertsch bestellt.
Der Entschluss Maria Theresias, in Innsbruck die Hochzeit ihres Sohnes
Leopold (II.) mit Maria Ludovica von Bourbon am 4. August 1765 abhalten
zu lassen, wurde mit 2000 Gästen prunkvoll gefeiert. 14 Tage feierte
man heiter und ausgelassen bei aufwändiger Speisenabfolge, ging in die
Oper und vergnügte sich, bis am 18. August 1765 der plötzliche Tod des
Kaisers Franz I. Stephan den Feierlichkeiten ein jähes Ende setzte.
Im 19. Jahrhundert war Erzherzog Karl Ludwig (1833-1896) Statthalter in
Innsbruck und ließ das sogenannte Innere Appartement für seine
Schwägerin Kaiserin Elisabeth (Sisi) neu adaptieren. Elisabeth
übernachtete nur einige Male in Innsbruck, während ihr Gemahl Kaiser
Franz Joseph regelmäßig in Tirol weilte und in der Hofburg logierte.
Mit Ende der Monarchie (1918) wurde der ehemals kaiserliche Besitz
staatlich. Die Burghauptmannschaft verwaltet heute das drittwichtigste
historische Gebäude Österreichs.
Da ich bereits an der Eintrittskassa darauf hingewiesen wurde, dass in
den Prunkräumen aus Datenschutzgründen (???) ein absolutes
Fotografierverbot besteht, habe ich von einem kostenpflichtigen Besuch
Abstand genommen. Schade.

Der Leopoldsbrunnen befindet sich am Rennweg vor der Kaiserlichen
Hofburg. Bei dem Reiterstandbild Erzherzog Leopolds V. (1619 - 1632)
handelt es sich nördlich der Alpen um die älteste Darstellung eines
Pferdes, das den Reiter nur auf den Hinterbeinen trägt ("Courbette").
Nach Entwürfen von Caspar Gras aus Bronze gegossene Meeres-und
Jagdgöttinnen schmücken den Brunnen.

Das Tiroler Landestheater ist
ein Mehrspartenhaus in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und der
größte Theaterbetrieb Westösterreichs. Das große Haus fasst etwa 800
Sitzplätze. Die Kammerspiele als zweite Spielstätte sind im
benachbarten Haus der Musik untergebracht. Auf dem Spielplan stehen
Schauspiel, Oper, Operette, Musical und Tanztheater; für die Musik ist
das Tiroler Symphonieorchester zuständig. Das Tiroler Landestheater
befindet sich in unmittelbarer Nähe der historischen Altstadt, umgeben
von Hofburg, Hofkirche, Hofgarten und SOWI-Fakultät der Universität
Innsbruck. Direkt daneben steht das Haus der Musik Innsbruck.

Der Dom zu St. Jakob in
Innsbruck, oftmals auch nur kurz als Innsbrucker Dom bezeichnet, ist
die Kathedrale beziehungsweise der Bischofssitz der
römisch-katholischen Diözese Innsbruck. Die Domkirche ist dem Apostel
Jakobus d. Ä. geweiht, das Patrozinium wird am Jakobitag, dem 25. Juli
gefeiert.
Die am Domplatz sich erhebende Fassade des Innsbrucker Doms ist eine
Doppelturmanlage mit zurücktretender Mitte. Zwei Gebälklagen fassen die
Fassade zusammen und teilen sie in drei horizontale Abschnitte. Das
Hauptgeschoß wird durch übereinander gelegte Pilaster gegliedert. Den
drei Portalen entsprechen drei Rundbogenfenster darüber. In den Kehlen,
mit denen die Fassade vorschwingt, stehen kleine Figurennischen. Eine
größere Figurennische befindet sich auch im Turmuntergeschoß. Das
zweite Geschoß wird von stehenden Ovalfenster gegliedert. Deren
Bedachungen zeigen abwechselnd Segmentform und geschweifte Spitzform.
In beiden Geschoßen schließen die Fensterrahmungen an tiefer liegende
Fassadenelemente an: im Hauptgeschoß an Portalrahmen bzw.
Zwischengesims, im zweiten Geschoß an das große Gesims. Die beiden
Hauptgesimse sind unterschiedlich gestaltet: Das untere besteht nur
über den Pilastern und ist unverkröpft, das obere ist durchgezogen und
verkröpft. Das dritte Turmgeschoß besteht aus einem quadratischen
Sockel mit Glockenoktogon, der Sockel wird durch Lisenen gegliedert,
das Oktogon durch einfache Pilaster beidseits der Schallarkaden sowie
durch Doppelpilaster vor den Schrägseiten, wobei geschweifte
Giebelfragmente vom Quadrat zum Oktogon überleiten. Hauben mit Laterne
und zweiter Haube, die ein vergoldetes Kreuz auf einer Weltkugel trägt,
schließen die Türme ab. Der Giebel nimmt eine Nische mit einer
Marienstatue auf. Bekrönt wird er von einem geschweiften Gebälklage.

Johann Jakob Herkomer konzipierte den Neubau der Stadtpfarrkirche St.
Jakob in Form einer Wandpfeilerkirche. Dabei verzichtete er auf
Seitenkapellen, wodurch eine grandiose Vereinheitlichung des Raumes
erzielt wurde. Den Wandpfeilern sind gestufte, rotmarmorne Pilaster
vorgelegt, die derart von der Wand abgesetzt sind, dass die
auf Pendentifs ruhenden Flachkuppeln der einzelnen Joche wie
aneinandergereihte Baldachine wirken. Unterstützt wird dieser Eindruck
durch die betonten Gurte und die gurtähnlich gestalteten Scheidbögen
der einzelnen Joche. Die Gestaltung der Seitenwände erscheint so, als
würden diese ihr eigenes Gliederungssystem besitzen, das jedoch nur aus
gestuften Pilasterstreifen besteht. Wie die betonten Wandpfeiler tragen
auch diese nur Gebälkstücke, während Architrav und Gesims um den
gesamten Innenraum herumgeführt werden. Zwischen den markanten
Fenstergruppen an den Seitenwänden und im Chorjoch — einem Hochoval und
einem darüber befindlichen Thermenfenster — werden diese Gesimse
allerdings hochgezogen und dienen als Bekrönung der Ovalfenster. Auf
zwei Langhausjoche folgt ein ebenfalls flach gewölbtes Vierungsjoch, an
das sich seitlich zwei Querhauskonchen anschließen. Die Kalotten der
Konchen sind mit drei Hochovalen durchfenstert. Zum Presbyterium
vermittelt ein Triumphbogen.
Das Chorquadrat ist über einem durchfensterten Tambour mit einer Kuppel
samt Laterne überwölbt. Nicht nur durch die Kuppel, sondern auch durch
das über Laterne und Tambour einfallende Oberlicht, erhält dieser Raum,
in dem das Gnadenbild aufbewahrt wird, eine besondere Auszeichnung.

St. Jakob als Fürbitter für die leidende-Menschheit, Fresko im östlichen Joch des Langhauses

Die Orgelempore im Westen ruht
in großer Höhe lediglich auf Konsolen und auf zwei schlanken
Marmorsäulen. Obwohl sie sich über die gesamte Breite des Kirchenraumes
erstreckt, wirkt diese Empore nicht zuletzt wegen ihrer geschwungenen
Brüstung sehr grazil. Außerdem wurde bei der Erbauung des dreiteiligen
Orgelprospekts die ovale Fensteröffnung der Westseite berücksichtigt.
Die große Orgel auf der
Westempore wurde in den Jahren 1998 bis 2000 von der österreichischen
Orgelbauwerkstatt Pirchner (Steinach a. Br.) in dem Gehäuse der Orgel
von Johann Kaspar Humpel aus dem Jahre 1725 erbaut, unter Verwendung
von Pfeifenmaterial der Vorgängerorgel. Das Instrument hat mechanische
Spiel- und Registertrakturen und insgesamt 57 Register (3729 Pfeifen).

Die vergoldete Kanzel ist ein Werk von Nikolaus Moll um 1724. Die
Kanzel wird gestützt von den personifizierten drei göttlichen Tugenden:
Glaube (Engel mit Kreuz), Liebe (Engel, der auf das Herz zeigt),
Hoffnung (Engel mit Anker). Bekrönt wird die Kanzel von dem Dreieck als
Symbol der Heiligen Dreifaltigkeit, den Gesetzestafeln Moses und einen
den Ruhm Gottes verkündenden Engel mit Trompete.

Der Himmelfahrtsaltar in der
nördlichen Querhauskonche, gestiftet von der
Maria-Himmelfahrts-Bruderschaft, besitzt ein Altargemälde des Brixener
Hofmalers Johann Georg Dominikus Grasmair (1691-1751) aus dem Jahre
1727. Es zeigt die Himmelfahrt der Gottesmutter und wie sie von Engeln
emporgetragen wird. Im Reliefmedaillon der Altarbekrönung ist die
heiligste Dreifaltigkeit verbildlicht, die die Ankunft Mariens im
Himmel erwartet. Flankiert wird der Altaraufbau von den Figuren der
hll. Josef (links) und Joachim (rechts). Das Vorsatzbild zeigt den hl.
Antonius Eremita.
In der Kirche befindet sich das Grabmal von Maximilian III.
Deutschmeister, Landesfürst von Tirol 1612–1618. Der Entwurf stammt von
Caspar Gras, nach anderer Ansicht von Hubert Gerhard, der Guss von
Heinrich Reinhart. Besonders interessant sind die Salomonischen Säulen,
die unter anderem mit Pflanzen, Schnecken, Vögeln und Heuschrecken
verziert sind. Oben kniet der Landesfürst mit St. Georg und dem
Drachen. St. Georg war bis 1772 Landespatron von Tirol, dann folgte St.
Josef. Seit 2005 ist der Heilige Georg dem Heiligen Josef als 2.
Landespatron zur Seite gestellt.

Im Zentrum des Hochaltarretabels befindet sich das Mariahilf-Bild von
Lukas Cranach dem Älteren. Der Hochaltar selbst wurde 1729 von
Cristoforo Benedetti und seinem Sohn Teodoro geschaffen. Schwarze
Stuckmarmorsäulen flankieren die rechteckige Rahmung des Gnadenbilds.
Dieses wird von einer Strahlenglorie hinterfangen, darüber befinden
sich ein Baldachin und die Taube. Über bewegter Gebälkzone erhebt sich
der von Voluten gerahmte Auszug, den eine Krone beschließt.

Das Wandgemälde über der Lünette des Altars von Hans Andre stammt aus
dem Jahre 1950. Es zeigt das Lamm Gottes in der Mitte eines Kreuzes,
umgeben von Gottvater, der Heilig-Geist-Taube, Maria und Johannes d. T.
Rechts unten ist die Pfarrkirche zu sehen, links davon der Genius
Innsbrucks mit dem Stadtwappen. Die großen Sanktus-Leuchter stiftete
die Familie des Stadpfarrers Matthias Tausch. Sie wurden 1733 von
Johann Paul Schellener gegossen.

Der Altar im Süden des östlichen Langhausjoches ist ein Heilig-Kreuz-Altar.
Das vor einem gemalten Hintergrund angebrachte spätgotische Kruzifix
stammt noch aus der Vorgängerkirche. Die marmornen Altarfiguren des
Innsbrucker Bildhauers Stefan Föger (1702-1750) — die trauernde Maria
und Johannes Ev. - bilden vor dem von J. G. D. Grasmair gemalten
Landschaftshintergrund zusammen mit dem Kruzifix eine
Kreuzigungsgruppe. Die Altarbekrönung zeigt das Herz Jesu mit der
Dornenkrone sowie einen Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute
nährt - ein Symbol für den Opfertod Christi. Im Altaraufsatz wird ein
Teil der Asche des 1996 seliggesprochenen Pfarrers Otto Neururer
(1882-1940) verwahrt, der 1940 im KZ Buchenwald den Märtyrertod starb.

Die Deckenfresken stammen von Cosmas Damian Asam, der Stuck von Egid
Quirin Asam. Es handelt sich dabei um barocke Illusionsmalerei.
Erstmals kam in Tirol ein Dekorationssystem zur Anwendung, das sich
über die gesamte Gewölbefläche der Flachkuppeln erstreckte. Letztere
bestehen aus Hohlkehlen und flachen Holzdecken, die eine bemerkenswerte
Spannweite von 17 m besitzen. Der Freskenzyklus in der Gewölbezone
feiert den Kirchenpatron St. Jakobus d. Ä. Die gemalten
Scheinarchitekturen sind auf einen von Westen nach Osten schreitenden
Betrachter ausgerichtet. Im ersten Joch über der Orgel, das ganz auf
Untersicht berechnet ist, erfleht der hl. Jakob den Segen von
Gott-Vater für Innsbruck, Tirol, Österreich und die Kirche. Im zweiten
Joch wirkt der Apostel bei Jesus (Gott-Sohn) als Fürbitter für die
leidende Menschheit. Hier wiederholte Asam das Baldachinmotiv der
gebauten Architektur mit starker perspektivischer Verkürzung. In den
Pendentifs sind gerahmte Szenen aus dem Leben des Kirchenpatrons
wiedergegeben: die Berufung durch Christus, die Bekehrung des Zauberers
Hermogenes, die Taufe des schriftgelehrten Josias und die
Offenbarung des Jakobusgrabes in einer Vision an Karl den Großen. Das
Fresko in der Vierung ist als Scheinkuppel gestaltet.

Im Zuge der letzten Innenrestaurierung wurde der Altarraum den
liturgischen Erfordernissen angepasst. Aus schwarzem Marmor wurde ein
ovaler neuer Volksaltar errichtet, dessen sieben Säulen die sieben
Gaben des Hl. Geistes symbolisieren sollen. Ebenfalls neu gestaltet
wurden Ambo, Bischofssitz und Priestersitz.

In den Jahren 1990-1993 wurde nach Plänen von Dipl.-Ing. Helmut Dreger
unter den Langhausjochen eine Unterkirche eingebaut. Ein schlichter
Treppenabgang im ersten Joch führt hinab in die längsovale Unterkirche,
die einerseits ein Raum der stillen Andacht sein soll, andererseits für
Messen und Andachten einer kleineren Gemeinschaft sowie als Taufkapelle
dienen kann.

DIE UNTERKIRCHE IM DOM ZU ST. JAKOB
Wer von der barocken Pracht des Domes in die Schlichtheit dieser
Unterkirche herunterkommt, ist vielleicht etwas betroffen und
enttäuscht. Aber dieser Raum für stille Beter sollte die Sprache
unserer Zeit sprechen. Und so sammelt sich das innerste Geheimnis
unseres Glaubens in wenige schlichte Zeichen. Der ovale Raum ist ein
Bild des Universums, in dem das Licht der Welt sichtbar wird. Darum
wiederholt sich das Symbol von Kreis und Viereck beim Altar wie beim
Taufstein: Der Kreis ist das Symbol der Ewigkeit, das Viereck das
Symbol der Welt. Im westlichen Brennpunkt der Ellipse steht der
Taufstein aus Granit (aus Afrika). Im Raum für das Wasser wird der
Wirbel des Dreifaltigen Geheimnisses sichtbar, von dem alles Heil
ausgeht. Das Segel, das - wie vom Winde erfaßt in den Raum hineinragt,
erinnert an den Geist, der "über den Wassern schwebte", und der bis zum
Ende der Welt die Liebe Gottes in diese Schöpfung hineintragen wird.
Vom Taufstein führt eine Wegspur am Boden vor zum Altar, der aus
demselben edlen Material wie der Taufstein in seiner archaischen Form
an das große Opfer der Hingabe des Gottessohnes erinnert, das hier
gefeiert wird. Der angedeutete Baldachin über dem Altar trägt eine
goldene Scheibe mit dem Christmonogramm: Das Ewige Wort, das das Alpha
und das Omega ist, der Anfang und das Ende, und das Herz des
Universums. So wie im Alten Testament Jakob die Gegenwart Gottes im
Traum von der Himmelsleiter erfuhr, so ist hier der Tabernakel mit dem
Symbol der Leiter verbunden: Gott steigt zu uns herab und ist uns nahe.
Und dieser Ort, wo er in der Gestalt des Brotes bei uns ist, ist
heilig. "Wirklich - der Herr ist an diesem Ort- und ich wußte es nicht.
Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort!", sagt Jakob nach seinem
prophetischen Traum .......
Diese Unterkirche soll vor allem dem stillen Verweilen vor Gott und der
Anbetung des Allerheiligsten dienen. Zur weiteren Ausstattung der
Unterkirche gehören die in Email und Stahl gearbeiteten Behälter für
die heiligen Öle an der Rückwand. Im Dom werden ja die heiligen Öle
jeden Gründonnerstag für die ganze Diözese geweiht. Ähnlich gearbeitet
ist das Ewige Licht. Der blaue Vorhang mit dem schlichten Gitter
verdeckt den Eingang in die Begräbnisstätte. Das Silber und Gold des
Gitters weist den Weg in unsere Vollendung in Gott. Die Gestaltung
dieser Unterkirche, die durch die Großzügigkeit der
Peter-Kaiser-Stiftung in Liechtenstein (DDr. Herbert Batliner)
ermöglicht wurde, ist das Werk des Liechtensteiner Künstlers Dr. Georg
Malin in Zusammenarbeit mit Arch. H. Dreger vom Bischöfl. Bauamt.

Historisches Rathaus - 1358
errichtet, erfuhr das Gebäude im Laufe der Zeit mehrere bauliche
Veränderungen. Es diente bis 1897 als Sitz des Magistrats. Im
Erdgeschoß befanden sich eine Kaufhalle und die Brotbank, im ersten
Stock waren die Ratsstube, Verwaltungsräume und das Stadtarchiv
untergebracht und im zweiten Stock befindet sich noch heute der große
Bürgersaal.
1450 erfolgt die erste urkundliche Nennung des Innsbrucker Stadtturmes
(Stat Turn am Platz) im Zuge eines Tausches von Haus und Hofstätte von
Chu(o)ntz und Elspet Ircher und dem Heilig-Geist-Spital in Insprugk
(Innsbruck). Die Errichtung des Stadtturmes erfolgte demnach zwischen
1442 und 1450. 133 Stufen führen nach oben zum wunderschönen Blick über
die Dächer der Altstadt. Einst dem Turmwächter vorbehalten, genießen
heute Besucher:innen das Panorama. Der Stadtturm
ist gut 50 Jahre älter als das Goldene Dachl, wurde 1450 fertiggestellt
und grenzt an das alte Rathaus. Im Vergleich zu modernen Bauwerken
wirkt er zwar nicht riesig. 1450 waren seine 51 Meter Höhe allerdings
stattlich und ein stolzes Zeichen vom Selbstbewusstsein der
Innsbrucker. Seine Zwiebelhaube erhielt der Stadtturm übrigens erst
hundert Jahre nach seiner Fertigstellung. Inmitten der
mittelalterlichen Altstadthäuser ragt er imposant empor. Ein guter
Aussichtspunkt zur Orientierung und um Innsbruck aus romantischer
Perspektive kennenzulernen.

Der „Neue Hof" mit dem Goldenen Dachl
Der „neue" Hof war im 15. Jahrhundert die Residenz von Herzog Friedrich
IV. „mit der leeren Tasche" und Sigmund „dem Münzreichen". Den mit 2657
feuervergoldeten Kupferschindeln gedeckten spätgotischen Prunkerker
ließ Kaiser Maximilian I. (1459-1519) aus Anlass seiner Hochzeit mit
Bianca Maria Sforza von Mailand errichten.
Das Goldene Dachl ist Innsbrucks Wahrzeichen und ein echter Blickfang –
vor allem im Sommer, wenn die Sonne die vergoldeten Kupferschindeln zum
Strahlen bringt. Mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln und der
reichen Fresken-und Reliefverzierung war der Prunkerker mitten in der
Innsbrucker Altstadt nicht nur zu seiner Entstehungszeit um 1500 ein
Blickfang. Auch heute, über 500 Jahre später, zieht das Goldene Dachl
täglich tausende Besuchende in seinen Bann und ist Innsbrucks
bekannteste Sehenswürdigkeit – weit über die Grenzen Österreichs
hinaus. Kaiser Maximilian I. ließ das Goldene Dachl zwischen 1497 und
1500 errichten. Als Baumeister gilt Nikolaus Türing der Ältere, der
Freskenschmuck wird Jörg Kölderer, dem Hofmaler Kaiser Maximilian I.,
zugeschrieben. Die achtzehn kunstvoll aus Sandstein gehauenen Reliefs
zeigen den stilistischen Übergang von der Spätgotik zur Frührenaissance
und gelten aufgrund ihrer Qualität und ihrer Motive als eines der
wichtigsten Kunstwerke Tirols. Um die sie vor Schäden zu bewahren,
wurden sie 1952 durch Kopien ersetzt. Sechs Originalreliefs können –
komplett restauriert und hautnah – im Museum Goldenes Dachl bestaunt
werden.

1468 erfolgte am Stadtturm der Einbau einer Feuer- und Sturmglocke
zum Schutz der Bevölkerung. Damit konnte der Gefahrenort durch eine
entsprechende Anzahl an Glockenschlägen ausfindig gemacht werden. 5
Schläge: Hofburg und Altstadt, 4 Schläge: Neustadt, Stadtgraben und
Innrain, 3 Schläge: Sillgasse, Kohlstatt und Universitätsstraße, 2
Schläge: Mariahilf und St. Nikolaus.
Türmer - Sowohl tagsüber als
auch nachts versahen Turmwächter ihren Dienst am Turm. Der erste
urkundlich bekannte Turmwächter wurde 1529 auf Beschluss des Stadtrates
zur Tagwache bestellt. Seine Aufgaben bestanden darin, die Stunden
auszurufen und die Stadtbevölkerung rechtzeitig vor Feuer oder anderen
Gefahren zu warnen. Die letzte Türmerin Maria Winterle verrichtete
ihren Dienst bis 1967.

51 Meter - Damals einer der
höchsten Türme der Umgebung und ein imposantes Zeichen für das
Selbstbewusstsein des Bürgertums. Heute ein Garant für schöne Ausblicke
über Innsbruck und auf die umliegenden Berge. Die unteren Stockwerke
des Stadtturmes dienten im Mittelalter als
Stadtgefängnis. Noch heute ist dies an den vergitterten Fenstern in den
ersten beiden Geschossen zu erkennen.
Ausblick Richtung Süden auf die Maria-Theresien-Straße bis zur Bergiselschanze

2 x 133 Stufen - Diese besondere Form der Treppe erlaubt ein Hinauf-und
Hinuntergehen auf getrennten Wegen und bringt somit eine spannende
Dynamik in die alten Gemäuer. Entwurf und Planung stammen vom
Architekturbüro Vogl-Fernheim.

Goldenes Dachl - Habsburgerresidenz, Prunkerker mit 2657 glänzenden Schindeln, heute Museum zur Innsbrucker Geschichte.
Reliefs am Erker zeigen Maximilian I. mit seinen beiden Gemahlinnen,
Kanzler, Hofnarr, Moriskentänzer und Wappen (Originalreliefs im Tiroler
Landesmuseum). Im Hintergrund der Reliefs verläuft ein Spruchband mit
Zeichen, die erst 2006 teilweise entschlüsselt wurden (4. „Wort“ =
Chryst…, 10. „Wort“ = nihil). Es handelt sich des Weiteren u. a. um
lateinische, griechische und hebräische Buchstaben, u. U. auch um
ägyptisierende Hieroglyphen.

Hofburg Innsbruck - Opulente Innenräume mit Fresken im Kaiserpalast aus dem 16. Jh. im späten Renaissance- und Barockstil.

Innsbruck Hbf - Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist der größte Bahnhof der
Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. In Form eines Durchgangsbahnhofs
liegt er östlich der Innsbrucker Innenstadt und zählt zu den
wichtigsten Eisenbahnknoten in Österreich. Der Bahnhof liegt in der
Innsbrucker Innenstadt an der Grenze zu Pradl.

KAISER MAXIMILIAN I. UND TIROL
Maximilian I. übernahm 1490 von Erzherzog Sigmund die Herrschaft über
Tirol und die Vorlande. Tirol war mit seinen reichen Silber- und
Salzvorkommen für den stets unter Geldnöten leidenden Maximilian I.
„eine Geldbörse, in die man nie umsonst greift". Mit seinen reichen
Jagdgründen hatte das Land dem jagdbegeisterten Maximilian I. aber noch
viel mehr zu bieten. Der unermüdlich durch sein Reich reisende Kaiser
blieb immer wieder längere Zeit an einem Ort - speziell in Tirol -, um
sich seiner Jagdleidenschaft zu widmen. Für ihn war die Jagd nicht nur
eine angenehme Freizeitbeschäftigung, er versprach sich davon auch eine
Stärkung des Charakters, weil dabei sowohl Mut als auch Tapferkeit und
Ausdauer trainiert würden. Bereits in Burgund hatte Maximilian I. die
Jagd als einen Bestandteil fürstlicher Repräsentation und als Ausdruck
höfischer Sitten kennengelernt. In Tirol veranstaltete er zahlreiche
Schaujagden, bei denen nicht nur das „Frauenzimmer" (die Königin und
die Hofdamen) zuschauen konnte, sondern auch fremde Fürsten und
Gesandte.
EIN MEISTER DER SELBSTINSZINIERUNG
Schon zu Lebzeiten kümmerte sich Kaiser Maximilian I. ganz aktiv um
sein Vermächtnis und legte damit den Grundstein dafür, wie wir heute
über ihn denken. Den eben erfundenen Buchdruck setzte Maximilian I.
gezielt für seine Zwecke ein. Es entstanden die teils
autobiografisch-verklärenden Werke Theuerdank, Weißkunig und Freydal.
Seine Verwendung des Holzschnitts zu Propagandazwecken wirkt wie
moderne Publicity: Die Auftragswerke Ehrenpforte und Triumphzug sind
monumentale Holzschnitte, deren Abbildungen durch Druckverfahren
vervielfältigt werden konnten. Im Papier hatte der Kaiser ein Medium
gefunden, das viel mehr Menschen erreichen konnte als ein in Stein
gemeißeltes Denkmal. Nicht nur von seiner Ausbildung und seinen Taten
wollte Maximilian I. berichten, auch sein Gesicht sollte so bekannt
werden wie keines seiner Vorgänger. Das Spektrum der Darstellungen
umfasst alle neuzeitlichen Medien und Formate: Die markante Nase und
das lange Haar Maximilians I. zierten Zeichnungen, (Glas-) Gemälde,
Münzen und Druckgrafiken. Der Kaiser als PR-Genie in eigener Sache? Das
ist ihm gelungen: 500 Jahre nach seinem Tod ist Maximilian I. nach wie
vor präsent und wird wohl immer unvergessen bleiben.

1450 wurde der Stadtturm
erstmals urkundlich erwähnt. 1560 erfolgte die Umgestaltung des
gotischen Aufsatzes in die heute noch erhaltene achteckige
Renaissanceform. Heute führen 133 Stufen auf den 51 Meter hohen Turm
über den Dächern der mittelalterlichen Altstadt. Während wir dort nun
das Panorama genießen, nützten Turmwächter damals die Aussicht, um als
Erste Feuer oder andere Gefahren zum Schutz der Bürger entdecken zu
können.

Der Bau der ursprünglich gotischen Kirche geht vermutlich bis zur
Stadtgründung Innsbrucks ins 12. Jahrhundert zurück. Ein schweres
Erdbeben im Jahr 1689 machte schließlich einen. vollkommenen Neubau der
Kirche notwendig. Seine heutige barocke Erscheinungsform erhielt der
Dom in den Jahren 1717 bis 1724 nach den Bauplänen von Johann Jakob
Herkomer, fertig gestellt von Johann Georg Fischer. Schutzpatron der
Kirche ist der hl. Jakobus der Ältere, dessen Legende vom Maler Cosmas
Damian Asam im großen Deckenfresko von 1723 im Dom verewigt wurde. Seit
1650 befindet sich in der Stadtpfarrkirche das berühmte Gnadenbild
„Mariahilf“ von Lukas Cranach d. Ä., das als Schenkung des Kurfürsten
Georg I. von Sachsen an den späteren Tiroler Landesfürsten Erzherzog
Leopold V. in Tiroler Besitz gelangte und seit 1750 jedes Jahr mit
einer Säkulumsfeier am ersten Sonntag im Juli gewürdigt wird. Im Jahr
1964 wurde Innsbruck Bischofssitz, wodurch die Stadtpfarrkirche St.
Jakob zum Dom erhoben wurde.
Um die barocke Kirche - Dom St. Jakob Innsbruck
- auch im engen Gefüge der städtischen Bebauung mit ihrer monumentalen
Westfassade zur Geltung zu bringen, wurde unmittelbar im Anschluss an
den Neubau in den Jahren 1722-1726 der Pfarrplatz geschaffen. Die
Schauseite am Pfarrplatz wird von den beiden dem Baukörper seitlich
vorgestellten Türmen dominiert, die über eine konkave Biegung mit der
zurückgesetzten, dreiachsigen Fassade verbunden sind. Dadurch ergibt
sich zwischen den Türmen ein durch Treppenstufen abgesetzter schmaler
Vorplatz, der zu den drei Langhausportalen führt. Die Türme und die
Fassade sind einem einheitlichen Gliederungssystem unterworfen, wobei
die Geschosseinteilung durch Gesimse erfolgt, die über den gestuften
Wandvorlagen verkröpft sind.
An den Vorderseiten und den zum Portalvorplatz weisenden Flanken der
Türme sind Figurennischen eingesetzt. Während in der Portalzone und in
den darüber liegenden Wandöffnungen der Rundbogen vorherrscht, zeigt
die Wand im Geschoss darüber große hochovale Fenster (zwei davon sind
Blindfenster), die alternierend mit Segmentbögen und geschweiften
Dreiecksgiebeln verdacht sind.

Der Weißkunig ist ein
autobiografisches Werk Kaiser Maximilians I. Der erste Teil ist der
Brautwerbung und Kaiserkrönung von Kaiser Friedrich III., dem Vater
Maximilians I., gewidmet. Im zweiten Teil wird von der Geburt und
Erziehung Maximilians I. berichtet. Der dritte Teil erzählt von
Maximilians I. Ehe mit Maria von Burgund und den von 1477 bis 1513
geführten Kriegen. Der kaiserliche Sekretär Marx Treitzsaurwein
verfasste große Teile des Textes in den Jahren 1512 bis 1514. Besonders
im dritten Teil nahm Maximilian I. regen Anteil und ergänzte das Werk
fortlaufend mit aktuellen Ereignissen, weshalb es zu keiner Drucklegung
zu seinen Lebzeiten kam. Erst 1775 wurde das Buch mit den erhalten
gebliebenen Druckstöcken gedruckt. Die 251 Holzschnitte schufen
ungefähr je zur Hälfte die Künstler Hans Burgkmair und Leonhard Beck,
vier stammen von Hans Springinklee, zwei von Hans Schäufelin.
Maximilians I. Selbstmarketing hörte mit dem Weißkunig nicht auf - im Gegenteil. Im Theuerdanklässt
uns ein junger Ritter an seiner Brautfahrt und zahlreichen
Heldentaten teilhaben. Das Versepos beruht auf Maximilians I. Leben und
der ehrenvolle Ritter ist niemand anders als der junge König selbst.
Wie konnte Maximilian I. sich aber zusätzlich den mehrheitlich
analphabetischen Zeitgenossen präsentieren? Auf Münzen! Genauer gesagt
prägten unterschiedliche Motive des Kaisers den Guldiner, einen
Vorläufer des Talers. Maximilian I. sah darin weniger eine Geld- denn
vielmehr eine Geschenkmünze, die er als Propagandamittel nützte.

Der Leopoldsbrunnen (selten: Leopoldbrunnen) ist ein denkmalgeschütztes
Objekt nahe der Innsbrucker Altstadt. Der vor dem Haus der Musik unweit
vom Landestheater gegenüber der Hofburg am Rennweg gelegene Brunnen
zeigt ein Reiterstandbild des Erzherzogs Leopolds V. (1586–1632), der
von 1623 bis 1630 Landesfürst von Tirol war und dem Brunnen den Namen
gab. Erzherzog Leopold V. ließ das Reiterstandbild gemeinsam mit zehn
weiteren herausragend gestalteten allegorischen Figuren als Ausdruck
seines absolutistischen Machtanspruches durch seinen Hofbossierer
Caspar Gras anfertigen. Das groß angelegte Repräsentationsprojekt blieb
jedoch durch den Tod Leopolds im Jahr 1632 unvollendet.
Das Erzherzog-Leopold-Reiterstandbild
ist das Hauptwerk des berühmten Bildhauers Caspar Gras (1585–1674) und
zugleich eines der künstlerisch bedeutendsten Denkmäler Österreichs aus
dem Frühbarock. Caspar Gras war der erste Künstler, dem es gelang, die
gusstechnisch äußerst schwierige Sprungstellung der Levade umzusetzen,
bei der das Ross die Balance freistehend auf den beiden Hinterhufen
hält, ohne den Schweif als dritte Stütze zu benutzen: eine
technisch-künstlerische Höchstleistung ihrer Zeit und richtungsweisend
für Reiterdenkmäler des Barock und des Klassizismus. Die Positionierung
des Pferdes nur auf den beiden Hinterbeinen war eine statische
Herausforderung, die unter anderem durch ein Gewicht aus Blei im
Schweif zur Stabilisierung gelöst wurde. Über das Reiterstandbild
hinaus, gestaltete Casper Gras zehn weiteren allegorische Figuren von
Göttinnenfiguren und Meeresgottheiten.

Innsbruck Museumstraße

Herzog-Friedrich-Straße in Innsbruck

Triumphpforte - Triumphbogen im römischen Stil, 1765 von Kaiserin Maria Theresia anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes errichtet.

Das Befreiungsdenkmal ist ein
Triumphtor am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck. Es wurde 1948 von
der französischen Militärregierung errichtet und soll an den Widerstand
Einheimischer in der NS-Zeit und an die gefallenen alliierten Soldaten
erinnern. Die Adlerfigur erfolgte nach einem Entwurf von Emmerich Kerle
durch den Schlosser und späteren Stadtrat Anton Fritz (ÖVP), der auch
die Gitter gestaltete.
Das Denkmal hat die Gestalt eines Triumphtores im Stil des
Neoklassizismus. Es ist etwa 20 m hoch ebenso breit, wobei die zentrale
Struktur ohne Adlerfigur und Sockel etwa 15 × 15 m bemisst. Der
Architrav trägt auf der Front die Inschrift „PRO LIBERTATE AUSTRIAE
MORTUIS“ (Den für die Freiheit Österreichs Gestorbenen). Der Tiroler
Adler mit Binnenschild besteht aus Kupfer und hat eine Höhe von 3,5 m.
Die fünf Tordurchgänge werden durch Gitter versperrt. In diesen
zeichnen sich in der Form des christlichen Kreuzes die Wappen der neun
österreichischen Bundesländer ab.

Amt der Tiroler Landesregierung - Unser Land Tirol - Land Tirol, Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - Museum in einem imposanten Gebäude
von 1842 mit einer umfangreichen Sammlung von der Steinzeit bis heute.

Der Habsburger Kaiser Maximilian I. (1459-1519), Herrscher über das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation, machte Innsbruck zum
Mittelpunkt seines Reiches. Neben bedeutenden Reformen hinterließ
Kaiser Maximilian I. auch repräsentative Bauwerke, die an seine Person
und vorallem an seine Macht erinnern sollten. So gab er bereits zu
Lebzeiten Pläne für sein eigenes Monumentalgrab mit einer
repräsentativen (teils fiktiven) Ahnengalerie, in Form von 40
überlebensgroßen Bronzefiguren, in Auftrag. Während einer Reise
verstarb der Kaiser jedoch zwischenzeitlich auf der Burg in Wels im
Jänner 1519 und wurde in Wiener Neustadt, seinem Geburtsort, begraben.
Sein Enkel Kaiser Ferdinand I. ließ dennoch von 1553-1563 die Hofkirche
in Innsbruck bauen und unter Erzherzog Ferdinand Il. konnte 1584
schließlich das Grabmal in der Kirche fertig gestellt werden, umringt
von 28 Bronzefiguren. Neben dem leeren Kaisergrab befindet sich in der
Hofkirche auch die Ruhestätte des bekannten Landesverteidigers Andreas
Hofer, sowie in der Silbernen Kapelle, das Grab von Erzherzog Ferdinand
II. und seiner Gemahlin Philippine Welser.

Basilika Wilten - Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen
Als älteste Pfarre der Gegend war Wilten die Mutterpfarre Innsbrucks.
Das Gnadenbild Mariens „unter den vier Säulen" zog seit dem Mittelalter
Wallfahrer an. Der heutige Rokoko-Bau (1751-1755) ist das bedeutendste
Werk des Tiroler Priester-Architekten Franz de Paula Penz. Papst Pius
XII. erhob die Kirche 1957 zur „Basilica minor".
Die Basilika Wilten besitzt eine dreigeschossige Doppelturmfassade mit
vortretendem, konkav geformtem Mittelteil. Die Fassadenmitte wird von
einem Giebel abgeschlossen. Ein Hauptgesims fasst den durch
korinthische Pilaster gegliederten unteren Teil der Fassade zusammen.
Die Mittelachse ist breiter, sie ist durch das Portal und ein
Hochfenster in Form eines geschwungenen Vierpasses akzentuiert. Im
Giebel führen Lisenen die Pilasterachsen des Hauptgeschosses fort.
Zuoberst stehen Ziervasen. In der Giebelnische steht eine Figur der
Maria Immaculata. Der Giebel erhebt sich auf einer Attika, die kleinen
Giebelfragmente seitlich kehren leicht variiert im dritten Turmgeschoss
wieder. Die beiden Türme stehen ab dem zweiten Geschoss frei. Das
dritte Turmgeschoss ist ein Oktogon mit abgeschrägten Ecken, hier
rahmen ionisierende Pilastern eine Schallarkade mit Blendbalustrade,
das Gebälk wölbt sich segmentgiebelförmig auf. Die Hauben zeigen
zweifache Einschnürung.

Die Vorgeschichte der Kirche reicht zurück bis ins 4. Jahrhundert n.
Chr. Die Gründungslegende besagt, dass römische Legionäre ein
Marienbild unter vier Bäumen verehrt hätten. 1140 wurde die Pfarre
Wilten, die Älteste der Stadt Innsbruck, durch Bischof Reginbert von
Brixen dem Stift Wilten übergeben, nachdem die Prämonstratenser 1138
das Kloster in Wilten übernommen hatten. Seither werden die Menschen in
der „Kirche im Süden der Stadt“ von den Chorherren seelsorglich
betreut. Die Wiltener Pfarrkirche ist bereits sehr früh als
Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen“ bekannt.
Das gotische Gnadenbild in der Mitte des Hochaltars zeigt Maria mit dem
Kind. Der Tiroler Priester Franz de Paula Penz plante die wohl schönste
Rokokokirche Tirols. Unter seiner Aufsicht wurde sie 1751-1755 erbaut
und von namhaften Künstlern wie Josef Stapf und Matthäus Günther
künstlerisch ausgestattet. 1957 wurde die Pfarrkirche wegen ihrer
Bedeutung’für die Region zur päpstlichen „Basilica minor” erhoben.
Die nach Osten ausgerichtete Wiltener Pfarrkirche mit umliegendem
Friedhof, dessen Ummauerung die spätgotische Michaelskapelle
einschließt, steht nordwestlich des benachbarten
Prämonstratenserstifts. Ehemals dem Stiftsbezirk eingebunden, ist die
Kirche seit dem 19. Jahrhundert durch die 1839/40 angelegte
Brennerstraße von diesem abgetrennt. Die Pfarrkirche besitzt eine
gegenüber dem Langhaus verbreiterte Zweiturmfassade im Westen. Das
Langhaus und der etwas niedrigere, eingezogene und halbrund schließende
Chor sind durch Pilaster, die mit den Mauervorlagen verkröpft sind, und
die dazwischenliegenden Fensterachsen, gegliedert.

Hochaltar -
Am 11. Dezember 1751 erhielt Franz Karl Fischer, hoffürstlicher
augsburgischer Landbaumeister in Füssen, einen Teilbetrag für die
Herstellung eines Marmortabernakels und der Mensa in der Wiltener
Pfarrkirche ausbezahlt. Vermutlich hat Fischer als Steinmetz nach den
Entwürfen des Joseph Stapf, der nachweislich solche gefertigt hatte,
gearbeitet. Um 1755 unterbreitete der Steinmetz- und Maurermeister
Franz Renn, der schon am Vorgängerbau beteiligt gewesenist, ein Angebot
für einen vollständigen Altaraufsatz mit vier roten Marmorsäulen samt
Sockeln, den er auf Wunsch des Wiltener Prälaten nach einem ihm
vorgelegten Plan herstellen sollte. 1756 erhielt ein gewisser Martin
Treitls seinen Lohn für vier an Renn gelieferte Postamente. Bei der
Herstellung des Altaraufbaus sind vermutlich die Marmorsäulen des
Vorgängeraltars, der 1728 aufgerichtet und in zeitgenössischen
Abbildungen dargestellt ist, wieder verwendet worden.
Die vier, auf hohen kurvierten Postamenten zweifach aufgesockelten
Säulen des als Ziborium gestalteten Aufbaus sind trapezförmig
angeordnet. Die beiden hinteren Säulen fassen die Mensa mit
Tabernakelaufsatz ein, gleichzeitig die Rückwand des Altaraufbaus
ausbildend. Die der Mensa vorgestellten Säulen sind weiter nach außen
gesetzt und verstärken die perspektivische Tiefenwirkung des Aufbaus,
der das zentral platzierte Gnadenbild überfängt. Die teilweise
vergoldeten Säulen sind mit einem profilierten, im hinteren Bereich
halbrund geführten, mit Putten und Lambrequins verzierten
Stuckmarmorgesims verkröpft, das sie zudem miteinander verbindet und
nur an der Front in einer Rocaille geöffnet wird. Der Aufsatz bildet
sich aus Voluten, die, mit Akanthus, Blumengirlanden und Rocaillen
reich dekoriert, über den Säulen auf dem Gebälk aufsitzen und in der
aus Holz gefertigten und vergoldeten Krone endigen.
Der Tabernakel mit vorschwingendem Mittelteil - darin die Tabernakeltür
und das Tabernakelkreuz - ist an den Seiten von Pilastern, die unten in
C-Schwüngen auslaufen eingefasst. Vorgekröpfte marmorierte Säulen
teilen seitliche Nischen ab, in welchen stehende Engel aus weißem
Marmor aufgestellt sind. Das Gebälk mit Gesimsstücken ist entsprechend
der Sockelzone in der Mitte hochgebogen und von einem Kreuz mit
Marienmonogramm bekrönt. Auf den seitlichen Gebälkstücken sind
adorierende Engel, ebenfalls aus weißem Marmor, zugeordnet.
Einfacher sind die Seitenaltäre
an den Ostseiten der Kapellen. Es sind Säulenaltäre mit
volutemgestütztem Auszug und zugehörigen Heiligenfiguren. Geschaffen
hat sie Josef Stapf (1764–76).
Die an dem Wandpfeiler auf der Langhausnordseite angebrachte, weiß gefasste und teilweise vergoldete Kanzel
stammt aus der Erbauungszeit der Kirche und wird dem Joseph Stapf
zugeschrieben. Die Brüstung des geschwungenen, mit Rocaillen besetzten
Kanzelkorbs wird durch Putten in drei Abschnitte mit gerahmten Feldern
geteilt, deren mittleres eine reliefierte und vergoldete Darstellung
des Guten Hirten zeigt. Zwei Putten, die einen drapierten Vorhang
halten, bilden die Rückwand der Kanzel, über welcher der an der
Stirnseite mit einer Rocaille ausgestattete Schalldeckel ansetzt. Der
sich nach oben verjüngende, durch Putten bereicherte Aufbau des
Schalldeckels bildet einen Sockel mit dem Lamm Gottes aus und endigt in
einem Strahlenbündel mit der Hl.-Geist-Taube und dem bekrönenden Auge
Gottes. Die figurale Zier des Schalldeckels bilden außerdem die Figuren
der hll. Petrus und Paulus sowie die vier Evangelistensymbole, die mit
Inschriftentafeln versehen sind.

Ein Gnadenbild der Maria war nach Angaben des 18. und 19. Jahrhunderts,
die wohl auf älteren Aufzeichnungen beruhen, bereits zu dieser Zeit
inmitten der Kirche zwischen vier Säulen aufgestellt. Dass sich die
Wallfahrt zur »Maria unter den vier Säulen« bereits damals etabliert
hatte, bezeugt die Tatsache, dass das Gnadenbild nach dem Neubau der
Kirche zu Beginn des 14. Jahrhunderts in seiner Platzierung wiederum
von vier Säulen eingefasst wurde. In diesem Zusammenhang ist wohl die
Ursprungslegende der Marienwallfahrt zu sehen, die besagt, dass
christliche römische Soldaten aus der Legio fulminata an dem Ort, an
welchem später die Pfarrkirche errichtet wurde, ein Marienbild unter
vier Bäumen verehrt hatten. Nach ihrem Abzug soll das Bild vergraben
und erst später von einem frommen Bauern namens Lorenz an der Stelle
aufgefunden worden sein, an dem später die Kirche errichtet worden ist.
Der Hochaltar stammt von Franz Karl Fischer (1755). Seine vier
polierten Freisäulen mit Kompositkapitellen tragen ein kurviges Gebälk,
der Altarauszug besteht aus einer Volutenkomposition, die eine Krone
trägt. Blumengirlanden und Lambrequins tragen zu einer transparenten
Leichtigkeit bei. Das Zentrum des Altars nimmt das Gnadenbild im
Strahlenkranz ein, eine etwa 90 cm hohe Muttergottesstatue mit Kind,
gehauen aus Sandstein, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, das
der Kirche den Namen verlieh. Vor dem Altar stehen Leuchterengel.

Die Basilika in Wilten ist eine spätbarocke Wandpfeilerkirche mit
eingezogenem Langchor. Der Grundriss ist zweiteilig: ein Langhaus-Saal
zu zwei quadratischen Jochen sowie ein einjöchiger Chor, der rund
schließt. Wandpfeiler stoßen in den Saalraum vor; die Pfeilerstirne
sind mit Doppelpilastern, die Flanken mit einfachen Pilastern besetzt.
Zwischen den Wandpfeilern liegen weiträumige, durch Rundbogen- und
Thermenfenster beleuchtete Abseiten oder Kapellräume. Das
aufschwingende Gebälk in den Kapellen macht mittig Platz für
Kartuschen. Als Langhauswölbung dienen Flachkuppeln, über den Kapellen
liegen Quertonnen. Als Chorwölbung dient eine Stichkappentonne. Da die
Wittener Basilika auf Emporen und Querhaus verzichtet, ergibt sich ein
Saalraum von weiträumiger Helligkeit.
Sämtliche Fresken in der
Pfarrkirche sind Werke des Augsburger Malers Matthäus Günther
(1705-1788), der sie laut Signatur in der westlichen Langhauskuppel im
Jahr 1754 vollendete. Günther, ein Schüler des Cosmas Damian Asam, ist
mit seinen in Zusammenarbeit mit Wessobrunner Stuckateuren geschaffenen
Deckengestaltungen, aber auch mit zahlreichen Altarblättern in ganz
Süddeutschland vertreten.
Das Fresko im Chorgewölbe stellt Maria als Fürbitterin vor der Hl.
Dreifaltigkeit dar. Maria sowie Christus und Gottvater, die in
Dreieckskomposition mit der Hl.-Geist-Taube angeordnet sind, nehmen auf
Gewölk schwebend und von einer monumentalen Säulenarchitektur umgeben
das Bildzentrum ein. Um einen Altar, auf dem brennende Herzen
dargebracht werden, sind neben Bettlern und Pilgern die Vertreter der
Tiroler Stände, einige auf den seitlich zugeordneten Balkonen, gezeigt,
die ihre Bittschriften emporreichen. Maria, von ihrem Sohn mit dem
Zepter als Zeichen der Macht ausgestattet, nimmt die Gesuche, die von
Engeln übermittelt werden, entgegen und überreicht sie der Hl.
Dreifaltigkeit. Als Vertreter der Geistlichkeit erscheint Abt Norbert
Bußjäger, durch seinen Abtsstab und den so genannten »Wiltener Kelch«,
den Graf Berthold V. 1180 dem Stift schenkte, charakterisiert. In den
seitlichen Gewölbezwickeln und auf Maria Bezug nehmend, sind die
allegorischen Darstellungen der theologischen Tugenden Liebe und
Hoffnung, im Chorschluss die Personifikation des Glaubens zugeordnet.

Skispringen hat auf dem Bergisel Tradition. Die Schanze selbst ist ein
Highlight von Star-Architektin Zaha Hadid und Schauplatz zweier
Olympischer Spiele. Majestätisch thront die Sprungschanze oberhalb der
Olympiastadt Innsbruck auf dem geschichtsträchtigen Bergisel, der für
Tirol und insbesondere für Innsbruck schon immer große Bedeutung hatte:
Vor etwa 200 Jahren kämpften dort mutige Tiroler unter ihrem Anführer
Andreas Hofer für die Freiheit ihres Heimatlandes. Und schon 1925 wurde
auf diesem historischen Boden die erste Sprungschanze errichtet.

1115 war das Jahr der Bekehrung des Norbert von Xanten, der später den
Prämonstratenserorden gegründet hat. Das Stift Wilten hat den Künstler
Christian Moschen beauftragt, eine übergroße Skulptur aus Blech zu
gestalten. Der Künstler hat das 5mm-Blech selber gebogen und
geschweisst. Die Statue prägt in ihrem Rostbraun den weitläufigen
Vorplatz vor der Stiftskirche am Fusse des Berg Isel.
Norbert wird durch einen Blitz vom Pferd geworfen. Eine übergrosse Statue vor dem Stift Wilten erinnert seit Juni 2015 an die Bekehrung des Ordensgründers.

Stift Wilten - Im Bereich der
römischen Siedlung Veldidena entstand im Mittelalter ein der Legende
nach vom Riesen Haymon gegründetes Kloster. Anstelle des ursprünglichen
Konvents von Weltpriestern führt seit 1138 der Orden der
Prämonstratenser das Stift, das im 17. und 18. Jahrhundert seine
Blütezeit erlebte und im Barockstil ausgebaut wurde.

Die Weihe der frühbarocken Stiftskirche erfolgte im Oktober 1665 durch
den Brixener Fürstbischof Sigmund Alfons Graf Thun im Beisein von
Kaiser Leopold I., nachdem der gotische Vorgängerbau eingestürzt war.
Der Nordturm wurde 1667 fertig gebaut, wobei der Bau des Südturms durch
den Tod des Hofbaumeisters Christoph Gumpp d. Jüngeren 1672
unterbrochen und deshalb nur bis zur halben Kirchendachhöhe ausgeführt
wurde. Eine Besonderheit in der Stiftskirche ist ein spätgotisches
Kruzifix mit echtem Haar (um 1510) an einem Seitenaltar, das früher in
der Mitte des Langhauses stand und während der Bombardierung Innsbrucks
in den Jahren 1943/44 nahezu unversehrt blieb. Die restliche Kirche
wurde jedoch stark beschädigt und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Das
letzte Mal erhielt die Kirche in den Jahren 2005-2008 eine komplette
Generalsanierung und zwei neue Orgeln.

In der Vorhalle der Kirche fällt sofort die über fünf Meter hohe
Kolossalstatue des Riesen Haymon aus der Zeit um 1470 auf, die sich
einst liegend in der alten Turmkapelle an der Nordseite des Chores
befand. Das prächtige schmiedeeiserne Vorhallengitter des Wiltener
Schlossermeisters Adam Neyer (1707) ist neben dem „Rosengitter“ in der
Stamser Stiftskirche eine der bedeutendsten Arbeiten barocker
Schmiedeeisenkunst in Tirol.

Die Stiftskirche Wilten ist eine langgestreckte, frühbarocke
Wandpfeileremporenhalle. Sie entspricht ganz dem Typus der süddeutschen
Wandpfeilerkirchen des 17. Jahrhunderts. Der in ein Rechteck
eingeschriebene Grundriss zeigt eine regelmäßige Abfolge von
querrechteckigen Jochen, zu denen sich seitlich Abseiten öffnen. Der
zweijöchige Chor ist nicht eingezogen. Im Aufbau prägen Wandpfeiler,
vor deren Stirnen übereinandergelegte, flache Pilaster stehen, den
Innenraum. Das kräftig vorkragende Gebälk beschränkt sich auf die
Pilasterbreite. Zwischen den Wandpfeilern liegen unten Kapellenräume
und oben Emporen. Beide werden mit Quertonnen gedeckt. An den Ostseiten
der Kapellen stehen jeweils Altäre. Die Emporenbrüstungen liegen auf
gleicher Höhe wie der obere Teil des Hauptgebälks. Die Brüstungen
ersetzen somit das Gebälk der den gesamten Raum bestimmenden
Pilasterordnung. Wandpfeilersaal und Chor werden von einer
gurtgegliederten Stichkappentonne gewölbt. Ein aus vorspringendem
Pilasterpfeiler und kräftigem Gurtbogen gebildeter Triumphbogen leitet
zum Chor. Im Chor liegen über Nischen, die u. a. das Gestühl aufnehmen,
Doppelemporen.
Der Innenraum der Kirche beeindruckt ob seiner einheitlich-strengen
Komposition. Die Fresken (Kaspar Waldmann) und Stuckaturen entstanden
zwischen 1702 und 1707. Akanthuslaub, Fruchtgirlanden, Adler und
Engelsgestalten bilden eine unübersehbare und doch noch sehr streng
gegliederte Fülle an Ornamenten. Der oberitalienische Meister Bernardo
Pasquale zeichnet mit 31 Gehilfen für diese hervorragenden Arbeiten des
„späten Frühbarock“ verantwortlich.
Das Innere der Kirche, die mit 60 m Länge zu den größten Sakralbauten
des Landes gehört, bietet einen frühbarocken Gesamteindruck. Durch die
üppige Stuckierung erhält die Stiftskirche ein festliches Gepräge,
andererseits wird durch die schwarz-goldenen Altäre eine gewisse
Strenge vermittelt.

Die Formensprache des Gehäuses der 2008 gebauten Festorgel
von Verschueren Orgelbouw aus Heythuysen in den Niederlanden bezieht
sich auf Elemente des barocken Kirchenraumes. Eine optische
Korrespondenz der Westempore zum 19 Meter hohen Hauptaltar wird dabei
angestrebt. Die 53 klingenden Register sind auf vier Werke verteilt:
Oberwerk, Hauptwerk, Rückwerk und Pedalwerk. In Zusammenarbeit mit
Verschueren Orgelbouw wurde ein einheitliches Instrument in
Orientierung an die großen Niederländischen Barockorgeln projektiert,
die von sich aus eine Vielfalt der Darstellung der traditionsreichen
europäischen Orgelliteratur bieten. Traditionelle Materialien und
kunsthandwerkliche Verarbeitung bei Verzicht auf moderne Spielhilfen
bilden dabei die Grundlage. Die große neue Festorgel von
Verschueren-Orgelbouw auf der Westempore
wird an Sonn- und Festtagen während der hl. Messe gespielt.

Hochaltar - Über einem mehrfach
abgesetzten Sockel erheben sich je drei Säulen, die ein mächtiges
Rundbogenbild rahmen und ein kräftiges Gebälk tragen. Dieser wird von
einem reich dekorierten Altartisch geprägt, auf dem der Tabernakel
steht. Den Mittelpunkt der dreisäuligen Nische bildet das mächtige
Altarblatt, das von je zwei Kolossalfiguren gerahmt wird. Auf dem
rundbögigen Bild wird die in den Wolken sitzende Mutter Gottes als
Rosenkranzkönigin dargestellt.
Die neun in Schwarz-Gold gefassten Altäre aus Ebenholz sind das
eigentliche Charakteristikum der Wiltener Stiftskirche. Sie verleihen
dem Innenraum einen eigentümlichen ernsten Eindruck. Ihr Stil ist eine
Mischung aus Renaissance und Frühbarock. Der Hochaltar ist nicht nur
das Hauptstück der Kirchenausstattung, sondern stellt mit einer Höhe
von 18 Metern einen der gewaltigsten Altaraufbauten des
süddeutsch-österreichischen Raumes dar.

Obwohl die Architektur die Alleinherrscherin in dem starren und ernsten
Raum ist, ist die Stuckatur der Punkt auf dem i. Der Stuck wurde
zwischen 1702 und 1707 vom Bildhauer Bernardo Pasquale mit 31 Gehilfen
angebracht. Wo hingegen die Stuckaturen die Architektur betonen,
unterstreichen die Fresken die Farbakzente. Der Stuck dient als Rahmen
der Fresken und als Deckenschmuck. Der krautige, dicht angelegte Stuck
der Wiltener Stiftskirche gilt als Spätwerk des Frühbarocks. Was Hans
Schor und Florian Nut in der Innsbrucker Jesuitenkirche um 1640
begonnen haben, führt Bernardo Pasquale hier in Wilten zum krönenden
Abschluss.
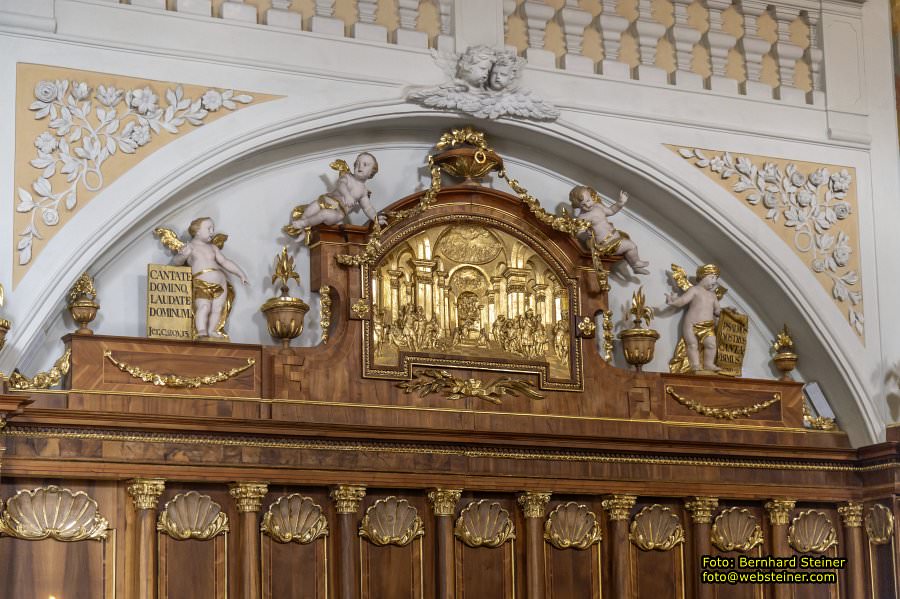
Das Innere der Kirche, die mit 60 m Länge zu den größten Sakralbauten
des Landes gehört, bietet einen frühbarocken Gesamteindruck. Durch die
üppige Stuckierung erhält die Stiftskirche ein festliches Gepräge,
andererseits wird durch die schwarz-goldenen Altäre eine gewisse
Strenge vermittelt.
Das üppig modellierte weiße Stuckkleid, das Gewölbe und Wände
überzieht, die zahlreichen farbkräftigen Wand- und Deckenfresken, die
mit den ähnlich intensiv marmorierten Wandpfeilern korrespondieren, und
die neun schwarzgoldenen Altäre, geben gemeinsam mit der ebenso
gefaßten Kanzel und der großen Orgel der Kirche eine ungewöhnlich
feierliche, ernste Note.

Die Aufsatzarchitektur ist mehr als nur die abschließende Bekrönung des
Hochaltars. Die feingegliederte Architektur stellt sich wie das
Bühnenbild eines barocken Jesuitentheaters dar. Sie bildet auch
theologisch die dritte Ebene des Altars.
ECCE PLUS QUAM SALOMON HIC (Siehe, hier ist mehr als Salomo, Matthäus
12,42) verkündet die Inschrift auf der prächtigen Rokokokartusche am
Gesims. Zum Thron Salomonis führen sechs Doppelstufen empor, bewacht
von je sechs goldenen Löwen. Auf dem Thron sehen wir nicht König
Salomon, sondern Christus als die verkörperte Weisheit Gottes, die das
Alte Testament erfüllt, ja die sprichwörtliche Weisheit und
Gerechtigkeit Salomos überhöht.
In der Stiftskirche Wilten gibt es insgesamt elf Altäre,. Dazu gehören
acht Seitenaltäre, der prächtige Hochaltar sowie der Zelebrationsaltar
im Zentrum des Chorraumes. Der elfte Altar befindet sich oberhalb des Hochaltars, bei den “Löwen des Thronsalomon”.
Dieser besondere Altar diente in der Geschichte des Stiftes immer
wieder als Ort für feierliche Zelebrationen, sei es aus besonderen
Anlässen oder während der Visitationen des Bischofs von Brixen.

Kaiserjägermuseum - Ausstellungen zur Tiroler Militärgeschichte vom 18.
bis zum 20. Jahrhundert mit interaktivem Raum am Bergisel

Aussicht vom Pavillon beim Kaiserjägermuseum auf Innsbruck und die Nordkette

Das Andreas-Hofer-Denkmal auf
dem Bergisel in Innsbruck wurde 1889 bis 1892 nach einem Entwurf von
Heinrich Natter errichtet. Der Bergisel war Schauplatz der vier
entscheidenden Schlachten des Tiroler Volksaufstandes unter Andreas
Hofer im Jahr 1809. Das Denkmal steht auf dem Plateau des Bergisel im
Zentrum einer Anlage, die vom Kaiserjägermuseum, dem Tirol Panorama,
den Schießständen der Kaiserjäger und dem Urichhaus umgeben ist.
Die überlebensgroße Bronzestatue steht auf einem rund zehn Tonnen
schweren Sockel aus Bozner Porphyr. Hofer ist als entschlossener
Kommandant mit breitkrempigem Hut und Fahne in der Hand dargestellt. An
den Seiten befinden sich zwei Adler mit ausgebreiteten Schwingen,
darunter Wappen mit dem Tiroler Adler (Westen) und dem österreichischen
Doppeladler (Osten). An der Vorderseite des Sockels ist eine Kartusche
mit der Inschrift „Für Gott, Kaiser und Vaterland“ angebracht, die von
Waffen und militärischen Symbolen umgeben ist.

Kaiser Franz Joseph I. Denkmal
Lebensgroßes Standbild Kaiser Franz Josephs (1830-1916) in Uniform am Innsbrucker Bergisel

Mit der Anlaufspur als Brückenbau, dem Turm als Hochbau und dem Turmkopf als Stahlbau sind in der 2001 umgebauten Skisprungschanze am Bergisel
in Innsbruck alle Sparten der Baukunst genial vereint. Verantwortlich
für dieses architektonische Meisterwerk zeichnete die irakische
Architektin Zaha Hadid, die schon dem Tomigaya Zaha Building in Tokio,
dem Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinatti und der
Erweiterung des Reina Sofia Museums in Madrid ihren künstlerischen
Stempel aufdrückte.
Internationale Anerkennung fand die Architektin auch im Jahr 2004 als
ihr der Pritzker Preis für ihre Arbeiten verliehen wurde – damit war
sie die erste Frau, die diese Auszeichnung entgegennahm. Im
Bergisel-Stadion verbindet Zaha Hadid Sprungturm, Café und Anlaufspur
elegant zu einer signalartig markanten Einheit, einer benützbaren
Skulptur.
· Architektin Zaha Hadid, 2001/2002
· Hybrid aus spezifischer Sportanlage und öffentlicher Funktion (Panorama-Restaurant „Café im Turm“ und Aussichtsplattform)
· Turm mit Turmfuß, „Kopf“ und Anlauframpe
· Kombination aus Turm und Brücke (91,60 m lang; 48,35 m hoch)
· zahlreiche internationale Preise
· gilt als modernes Wahrzeichen Innsbrucks

Zweimal kam die Sportstätte zu olympischen Ehren: Bei den Olympischen
Spielen 1964 und 1976 wurde das olympische Feuer auf dem Bergisel
entzündet. Auch aufsehenerregende Großveranstaltungen fanden in der
Arena statt, wo Papst Johannes Paul II. 1988 eine Messe für 60.000
Gläubige zelebrierte.

Die Bergisel-Arena ist nicht nur alljährlich im Winter – unter anderem
bei der internationalen Vierschanzentournee – Treffpunkt für Sportler
und Sportinteressierte. Die Sportstätte ist FIS-Wettbewerbsanlage und
zugleich Ganzjahrestrainingszentrum mit Mattenschanze: Die Skispringer
nehmen auf einer speziellen Porzellan-Spur Anlauf, die Aufsprungbahn
ist mit gedämpften Fasermatten ausgelegt.
Die modernste Skisportanlage der Welt mit über 28.000 Zuschauerplätzen
ist zwar vorwiegend dem „Erlebnis Skisprung“ vorbehalten, doch bietet
dieses neue Innsbrucker Wahrzeichen auch viele touristische
Möglichkeiten: So kommen dort Panoramagenießer, Kaffeehausbesucher,
Technikfreaks und Architekturfreunde gleichermaßen auf ihre Kosten.
Leider war es mir nicht möglich einen Zugang zum Panoramacafé und
Aussichtsterrasse als Fußgänger zu finden. Alle Eingänge waren
versperrt. Offenbar MUSS man mit der kostenpflichtigen Kabinenbahn
fahren. Schade.

Emile-Béthouart-Steg -
Marie-Emile Béthouart (1889-1982), General, nach 1945 Oberbefehlshaber
der französischen Besatzungstruppen in Österreich. Der frühere Innsteg
trägt seit 2003 dessen Namen.

Pfarrkirche St. Nikolaus - Die
Marienkirche des einstigen von einer St. Nikolaus-Bruderschaft
betreuten Leprosenhauses wurde schon 1505 als St. Nikolaus-Kirche
bezeichnet. Der 1665 erweiterte Bau war im 19. Jahrhundert zu eng
geworden, wurde 1881 abgerissen und bis 1885 durch die heutige
neugotische Kirche nach Plänen des Wiener Architekten Friedrich von
Schmidt ersetzt.
Die Pfarrkirche von St. Nikolaus ist signifikant für die Zeit des
Historismus (1850-1880), in der ein Bauwerk nicht nur Nutzbau, sondern
auch Monumentalbau sein sollte. Der Kirchenbau zeigt die Vorliebe des
Historismus für symmetrische Anlagen und geometrische Details, für eine
Raumvereinheitlichung und andererseits für eine starke Aufgliederung
des Außenbaus. Friedrich von Schmidts vielfältige Anregungen beim Bau
der Kirche und bei Fragen der Ausstattung geben Zeugnis vom Künstler,
dessen Streben nach dem Gesamtkunstwerk auch in St. Nikolaus deutlich
zu Tage tritt. Heute erhält die Kirche außerdem noch dadurch eine
besondere Bedeutung, als sie zu den wenigen Bauten gehört, die noch
eine weitgehend unveränderte, geschlossene neugotische Ausstattung
besitzen.

Die Pfarrkirche St. Nikolaus nimmt als bedeutendstes Denkmal
neugotischer Kirchenarchitektur in Tirol eine dominante Stellung für
das Stadtbild ein. Nicht zuletzt deswegen und wegen seiner leichten
Erreichbarkeit (über den Innsteg, heute Emile-Bethouart-Steg) diente
diese Kirche nach dem 2. Weltkrieg als Ersatzdom, denn St. Jakob lag in
Trümmern. Bereits im Jahre 1313 stand an dieser Stelle eine Kapelle,
der letzte Neubau erfolgte 1881-1886 durch den Wiener Dombaumeister
Friedrich v. Schmidt. Die einheitliche Ausstattung des Inneren im
neugotischen Stil führt uns ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk aus
dieser Zeit vor. Besonders zu erwähnen sind die Flügelaltäre mit
geöffneter Festtags- und geschlossener Werktagsvariante.
Über dem Doppelportal stehen vor einem Goldmosaikhintergrund die drei
Skulpturen der Muttergottes, des Hl. Nikolaus und des Hl. Martin. Sie
stammen von Johann Posch aus Hall i. T. Darüber befindet sich eine
7-teilige Rosette, die ganz von einem Spitzbogen umfasstist. Der
abgetreppte Giebel mit Blendnischen und Mosaikbildern (4 Evangelisten
und 4 Propheten) nach einem Entwurf von M. Stolz stammt aus der
Neuhauser’schen Mosaikwerkstätte. Die Mitte des Giebels beherrscht die
Statue des Erlösers von Julius Blaas.

Für die einheitliche Innenausstattung der Kirche sind verschiedene
bedeutende Tiroler Künstler verantwortlich (im Besonderen Josef Schmid
und Josef Bachlechner). Ihre Arbeiten sind eigenständige künstlerische
Produkte, die sich einem Ganzen unterordnen. Sie alle fühlten sich dem
Geist des Architekten Friedrich von Schmidt verbunden, der verschiedene
Pläne für die Inneneinrichtung gezeichnet hatte, die auf eine Harmonie
von Architektur und Ausstattung abzielten. Links und rechts vor dem
Hochaltar steht das Chorgestühl, das von Franz Egg und dem Kunsttischler Möslein 1894 nach einem Entwurf Josef Schmids ausgeführt wurde. Die Deckenfresken stammen von den Historienmalern Franz und Carl Jobst aus Wien und sind im Nazarenerstil gehalten. Der Fußboden der Kirche wurde von der Wienerberger Ziegelei hergestellt.
Leider war der Zutritt ins Kirchenschiff versperrt.

Der Hochaltar wurde von Josef
Schmid nach einem Entwurf von Friedrich von Schmidt geplant. Die
Außenseiten zeigen in vier Bildern, die von Hans Rabensteiner aus
Klausen gemalt sind, Szenen aus der Passion Christi. Zu den kirchlichen
Festen ist der Altar geöffnet. Die zwischen reicher Ornamentik vor
vergoldetem Hintergrund stehenden Figuren sind links die Kirchenpatrone
St. Nikolaus und St. Martin sowie rechts die beiden Märtyrer Sebastian
und Florian. Die Reliefs an den Innenflügeln stellen die Geburt Jesu
und die Anbetung durch die drei Könige dar. In der Mitte des Altars
steht der zweistöckige Tabernakel. Er stammt von Jakob Rappel aus
Schwaz. Links und rechts wird der Altarschrein von den Heiligen Petrus
und Paulus flankiert. Im Gesprenge sind die Hl. Katharina und die Hl.
Barbara sowie Maria und der Hl. Johannes zu sehen.
Nach den Entwürfen des Haller Bildhauers Josef Bachlechner wurde nach seinem Tode (1923) die prachtvolle Kanzel
von seinen Schülern Heinrich Ludwig und Gottfried Köstler vollendet.
Dieses bemerkenswerte Kunstwerk reicht vom Fußboden bis ins Gewölbe.
Über dem Kanzelfuß mit fünf Statuen aus dem Alten Testament (Abraham,
Moses, Johannes der Täufer, David, Elias) sieht man an der
Kanzelbrüstung vier Reliefs mit Themen aus dem Neuen Testament (Jesus
am Jakobsbrunnen, Bergpredigt, Jesus im Hause von Martha und Maria,
Petrus wird zum Oberhaupt der Kirche bestellt). Der hoch emporstrebende
Aufsatz des Schalldeckels trägt die Dreifaltigkeit und Posaunenengel.

EIN PRUNKERKER FÜR DEN KAISER
Maximilian I. blieb wie kein anderer Habsburger Herrscher im Gedächtnis
der Tiroler Bevölkerung verankert. Mit dem Bau des Goldenen Dachls
schuf er ein Gesamtkunstwerk, das sich zum weltbekannten Wahrzeichen
Innsbrucks entwickelte. Maximilian I. ließ das Goldene Dachl um 1500 an
der Südfront des ab 1420 geschaffenen „Neuen Hofes" („Neuhof")
errichten. Diesen Ort wählte er nach repräsentativen Gesichtspunkten.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Herzog Friedrich IV. und Herzog
Sigmund bewohnte Maximilian I. den sogenannten „Neuen Hof" nie. Er
machte ihn aber ab 1498 zum Amtssitz der Raitkammer (Finanzkammer), die
in den drei überwölbten Räumen des hinteren Stöcklgebäudes ihre Akten
feuersicher archivierte. 1780 wurde das Gebäude in eine Kaserne
umgewandelt. 1811 erwarb es die Stadt im Tausch gegen ein Lazarett in
der heutigen Weinhartstraße und übergab es 1822 an eine Gruppe von
Bürgern. Schon 1831 gelangte das Gebäude aber wieder in städtischen
Besitz.
Ausblick vom Erker Goldenes Dachl in die Herzog-Friedrich-Straße

Aufbruch in eine neue Zeit - die Welt im Wandel
Am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance häufen sich weltbewegende
Ereignisse, Entdeckungen und Erfindungen: Die Osmanen besiegeln mit der
Eroberung von Konstantinopel den Fall des Oströmischen Reichs; der
Buchdruck ermöglicht eine bis dahin unvorstellbare mediale Revolution
zuvor mühevoll abgeschriebene Texte konnten nun vervielfältigt und
leichter zugänglich gemacht werden. Die Entdeckung der Neuen Welt
läutet einen Wettlauf zwischen den großen Seemächten Europas ein.
Zugleich bedeutet die Besiedelung Amerikas die Verfolgung und
Ausbeutung indigener Stämme. Im Reich wehrt sich Martin Luther gegen
die Praxis des Ablass-handels und begründet damit eine neue Konfession.
Das Adelsgeschlecht der Habsburger erwarb im Lauf der Jahrhunderte
viele europäische Gebiete und erlangte in der damaligen Welt
entscheidenden Einfluss. Bis zur Zeit Maximilians I. lag das Zentrum
ihrer Macht im heutigen Ostösterreich. Er selbst gewann 1477 Teile
Burgunds, 1490 Tirol und die Vorlande (Westösterreich), 1504 Kufstein
und durch einen Erbfall Herrschaften in Görz, Friaul und Oberkärnten
hinzu. Die größten Gebietsgewinne für die Habsburger brachte aber
Maximilians I. Heirats- und Erbpolitik: Spanien sowie Ungarn und Böhmen
wurden nicht auf dem Schlachtfeld erobert, sondern vor dem Traualtar.
Mit zwei Doppelhochzeiten begründete Maximilian I. die beiden
habsburgischen Stammlinien, die spanisch-niederländische und die
Österreichische Linie.

DREI PRACHTVOLLE GESCHOSSE UNTER EINEM GOLDENEN DACH
Als Baumeister des Goldenen Dachls gilt Nikolaus Tūring d. Ä. Er
gestaltete es als dreigeschossigen Standerker (Sõller) im spätgotischen
Stil mit reichem Fresken- und Reliefschmuck. Das Dach ist mit 2.657
vergoldeten Schindeln gedeckt. 3-3,5 kg Gold wurden - grob geschätzt -
für die Vergoldung der Schindeln verwendet. Ca. 500 Gramm wiegt eine
Schindel.
Die Brüstung des ersten Obergeschosses nimmt ein Wappenfries ein, das
zweite Obergeschoss des Erkers ist als Loggia ausgebildet. In die
Brüstung sind zehn Reliefs aus Sandstein eingelassen, auf denen eine
höfische Veranstaltung mit Moriskentänzern dargestellt ist. Zwei
zentral auf der Vorderseite positionierte Reliefs zeigen Kaiser
Maximilian I.

ERFINDUNGEN UND ENTDECKUNGEN 1450-1520
1450 - ERFINDUNG DES MODERNEN BUCHDRUCKS
Während es in Asien bereits seit einigen Jahrhunderten Druckverfahren
mit beweg-lichen Lettern gibt, werden in Europa Bücher in mühevoller
Handarbeit Seite für Seite abgeschrieben. Die ab 1450 von Johannes
Gutenberg entwickelte Druckerpresse ermöglicht nun eine höhere und
damit günstigere Druckauflage. Mit der Verbreitung seiner Erfindung
findet in Europa eine Medienrevolution statt: Wissen wird einer
breiteren Bevölkerung zugänglich.
1488 - UMSEGELUNG DER SÜDSPITZE AFRIKAS
Im Zuge einer Entdeckungsreise wird das Kap der Guten Hoffnung an der
Südspitze des afrikanischen Kontinents erstmals von einem Europäer
umsegelt. Bartolomeu Diaz befindet sich im Auftrag des portugiesischen
Königs auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien und stößt so auf die
Route, die bis zur Eröffnung des Suezkanals knapp 400 Jahre später zu
einer bedeutenden Handelsverbindung wird.
ab 1490 - DER ERSTE, HEUTE NOCH ERHALTENE GLOBUS ENTSTEHT
Ab 1490 wird im Auftrag der Reichsstadt Nürnberg und unter Anleitung
Martin Behaims der heute älteste erhaltene Globus der Welt angefertigt.
Außerdem ist der Behaim-Globus einer der letzten kartografischen Zeugen
vor der europäischen Entdeckung Amerikas: Zwischen Afrikas West-und
Asiens Ostküste findet sich lediglich der Ozean.
1490 - EINFÜHRUNG DES POSTWESENS IN MAXIMILIANS I. HERRSCHAFTSBEREICH
Kaiser Maximilian I. gilt als Schöpfer der ersten zentral organisierten
und durchgängig benützten Postlinien im deutschsprachigen Raum. Er
beauftragt die oberitalienische Adelsfamilie Taxis mit der Organisation
erster stabiler Verbindungen - im Laufe der Jahrhunderte steigt diese
als Inhaberin der Reichspost zu europäischem Ruhm auf. Aufgrund der
Lage zwischen Italien und Burgund wird die Stadt Innsbruck zu einem
wichtigen Mittelpunkt für die Beförderung von Nachrichten.
1492 - CHRISTOPΡΗ KOLUMBUS LANDET AUF HISPANIOLA
Der italienische Seefahrer Christoph Kolumbus sticht am 3. August 1492
mit drei Schiffen in See, um einen direkten Seeweg über Westen nach
Indien zu finden. Geldgeber sind das Königspaar Ferdinand II. von
Aragón und Isabella I. von Kastilien. Mit der europäischen Entdeckung
Amerikas beginnt für die indigene Bevölkerung eine Zeit der Ausbeutung
und Verfolgung.
1497 - ENTDECKUNG DES NORDAMERIKANISCHEN FESTLANDS
Im Juni 1497 betritt der italienische Seefahrer Giovanni Caboto als
erster Europäer - seit der Zeit der Wikinger - nordamerikanisches
Festland. Er glaubt zunächst, auf eine Westroute nach Asien gestoßen zu
sein und sich an Chinas Ostküste zu befinden. Tatsächlich landet er
aber auf Labrador, Neuengland oder Neufundland; wo genau er an Land
geht, ist bis heute unklar.
1497-1499 - VASCO DA GAMA ENTDECKT DEN SEEWEG NACH INDIEN
Nach der erfolgreichen Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung durch
Bartolomeu Diaz wird der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama damit
beauftragt, einen südlichen Seeweg nach Indien zu finden. Die
Entdeckungsfahrt gelingt und da Gama kehrt 1499 mit voll beladenen
Schiffen nach Portugal zurück, wo ihn ein triumphaler Empfang erwartet.
1500 - PEDRO ÁLVERES CABRAL ENTDECKT BRASILIEN
Im März 1500 verlässt der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral
mit einer gewaltigen Flotte Lissabon - zum Expeditionsteam gehört u. a.
auch Bartolomeu Diaz. Auf dem Weg nach Indien lässt er seine Schiffe
bei den Kapverdischen Inseln aber weit nach Westen ausschwenken - so
weit, dass die Flotte auf Land trifft, das heutige Brasilien. Cabral
und seine Mannschaft landen nördlich der heutigen Stadt Porto Seguro
und halten das entdeckte Land zunächst für eine Insel.
1510-1514 - KOPERNIKUS ENTWICKELT DIE GRUNDZÜGE SEINES HELIOZENTRISCHEN WELTBILDES
In der mittelalterlichen Vorstellung steht die Erde im Zentrum des
Universums und die Sonne dreht sich um sie (geozentrisches Weltbild).
Nikolaus Kopernikus formuliert die Theorie, dass sich unsere Erde
erstens um ihre eigene Achse dreht und zweitens - genau wie alle
anderen Planeten - um die Sonne (heliozentrisches Weltbild).
1513 - BEGINN DER SPANISCHEN KOLONISATION ZENTRAL-AMERIKAS
Nach der europäischen (Wieder-) Entdeckung Amerikas beginnt die
Conquista (Eroberung) im Dienste der spanischen Krone. Die
Conquistadoren bekommen teilweise den Auftrag, die indigene Bevölkerung
zu schützen und zu missionieren - in der Realität wird sie allerdings
versklavt, ihrer (Boden-) Schätze beraubt, vertrieben und/oder
ermordet. Oberstes Ziel der Eroberer ist weniger die Erschließung neuer
Gebiete, sondern die Suche nach Gold und sagenhaften Reichtümern.
1517 - MARTIN LUTHER VERÖFFENTLICHT SEINE 95 THESEN
1517 veröffentlicht der Theologe Martin Luther 95 Thesen, die sich
insbesondere gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen der
katholischen Kirche richten. Die Veröffentlichung - ein tatsächlicher
Thesenanschlag an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg, wie er
dargestellt ist, gilt als historisch umstritten - führt zur Reformation
und damit auch zur Kirchenspaltung.
1519-1522 - ERSTE WELTUMSEGELUNG
Der Flotte des portugiesischen Seefahrers Ferdinand Magellan - der
allerdings für die spanische Krone segelt - gelingt die erste
dokumentierte Weltumsegelung. Aus den Aufzeichnungen seines Chronisten
wissen wir, dass Magellan die komplette Umrundung nicht miterlebt hat:
Kurz vor dem Ziel stirbt er auf der philippinischen Insel Mactan bei
einem der ersten erfolgreichen Abwehrkämpfe von indigenen Einwohnern
gegen europäische Kolonialisten.
1536 - JAKOB HUTTER WIRD VOR DEM GOLDENEN DACHL HINGERICHTET
Jakob Hutter (auch Huter), Führer des Tiroler Täufertums und
Namensgeber der auch heute noch bestehenden Religionsgemeinschaft der
Hutterer, wird als Ketzer vor dem Goldenen Dachl auf dem Scheiterhaufen
verbrannt.
Die Täufer verstanden sich als radikalreformatorische Bewegung,
zentrale Anliegen waren (und sind) Gewaltlosigkeit und die wortgetreue
Auslegung des Neuen Testaments. Neben den Wurzeln der Hutterer liegen
auch die Wurzeln der Mennoniten und Amischen im Täufertum.
* * *
SPÄTGOTISCHER KÜRISS - Neben
Rüstungen, die in der neuen Innsbrucker Hofplattnerei angefertigt
wurden, entstanden in Augsburg hervorragende Arbeiten, so auch dieser
Reiterharnisch. Kennzeichnend für den spätgotischen Stil sind die spitz
zulaufenden Schnabelschuhe. Im Innsbrucker Zeughaus entstand ein
zentrales Rüstungs- und Waffenarsenal, von dem aus die Kriegsausrüstung
rasch in alle Richtungen des Reichs gebracht werden konnte.
Spätgotischer Küriß (vollständiger Reiterharnisch), Augsburg, 1485-1490, Stahl, Historisches Museum der Stadt Wien

DAS LEBEN KAISER MAXIMILIANS I.
1459 - GEBURT MAXIMILIANS I.
Maximilian I. wird als Sohn Kaiser Friedrichs III. und Eleonores von
Portugal in Wiener Neustadt geboren. Nachdem er als Kleinkind erlebt,
wie die Wiener Hofburg 1462 von der Stadtregierung belagert wird, hält
er sich sein restliches Leben lang kaum mehr in Wien auf.
1477 - HEIRAT MIT MARIA VON BURGUND
Im August 1477 begegnen sich Maximilian I. und seine Ehefrau Maria von
Burgund zum ersten Mal in Gent - nachdem sie bereits seit April durch
eine Stellvertreterhochzeit verehelicht sind. Der Ehe waren lange
Verhandlungen vorangegangen. Nach dem Tod ihres Vaters ist Maria
aufgrund ihres (nicht unumstrictenen) Erbanspruchs auf das Herzogtum
Burgund die begehrteste Braut Europas.
1477-1489 - BURGUNDISCHER ERBFOLGEKRIEG
Frankreich, zu dessen Lehensverband das Kernland Burgunds gehört, will
Marias Erbanspruch nicht anerkennen. So entbrennt ein jahrelanger Krieg
um das Herzogtum Burgund, von dem sich auch die niederländischen Stände
neue Privilegien versprechen.
1478 - GEBURT VON ERZHERZOG PHILIPP
Im Juli 1478 wird Marias und Maximilians 1. erster Sohn Philipp, später
der Schöne genannt. geboren. Bereits als Kleinkind wird er aufgrund des
frühen Todes seiner Mutter zum Herzog und damit Erben von Burgund, das
er ab seiner Volljährigkeit regiert. 1506 stirbt Philipp mit nur 28
Jahren, als seine Gemahlin mit ihrem sechsten Kind schwanger ist.
1480 - GEBURT VON ERZHERZOGIN MARGARETHE
Philipps jüngere Schwester Margarethe wird wie ihr Bruder in die
Ehepolitik ihres Vaters eingebunden. Doch nachdem beide ihrer Ehen nach
jeweils kurzer Zeit durch den Tod des Ehegatten enden und auch Philipp
früh verstirbt, wird Margarethe als Witwe zur statthaltenden Regentin
über die Niederlande. Dort übernimmt sie außerdem die Vormundschaft für
ihren Neffen, den späteren Kaiser Karl V.
1482 - TOD MARIAS VON BURGUND
Infolge eines Jagdunfalles - die eigentlich geübte Reiterin war von
ihrem Pferd gestürzt - stirbt Maria von Burgund mit nur 25 Jahren. Sie
bestimmt ihren Sohn als Erben des Herzogtums und verfügt, dass ihr
Gatte bis zur Mündigkeit Philipps regieren solle. Mit dem burgundischen
Erbe beginnt jene Rivalität zwischen dem Haus Habsburg und Frankreich,
die Europa jahrhundertelang prägen sollte.
1483 - VERLOBUNG MARGARETHES MIT KARL (VIII.) VON FRANKREICH
Um den für alle Seiten verlustreichen burgundischen Erbfolgekrieg
beizulegen, wird die erst dreijährige Margarethe dem französischen
Thronfolger Karl VIII. versprochen. Bis zur Lösung der Verlobung lebt
sie am französischen Hof; Karl VIII. heiratet 1491 nämlich nicht
Margarethe, sondern Anne de Bretagne. Erst mit dem Frieden von Senlis
darf die inzwischen 13-Jährige ausreisen.
1486 - WAHL UND KRÖNUNG ZUM RÖMISCHEN KÖNIG
Kaiser Friedrich III. schafft es noch zu Lebzeiten, dass sein Sohn im
Jahr 1486 in Frankfurt am Main vom Kurfürstenkollegium zum
römisch-deutschen König gewählt wird. Die Krönung Maximilians I.
erfolgt im selben Jahr in Aachen. Als Rex Romanorum, König der Römer,
erhebt Maximilian I. 1493 nach dem Tod Friedrichs III. Anspruch auf den
Kaiserthron.
1488 - GEFANGENSCHAFT MAXIMILIANS I.
1488 wird Maximilian I. kurzzeitig inhaftiert: Die hohen Kriegskosten,
die Begünstigung Antwerpens als Handelszentrum und die neuen
Steuerpläne führen dazu, dass ihn das aufständische Bürgertum der Stadt
Brügge kurzerhand für einige Monate gefangen nimmt. Erst eine von
Friedrich III. berufene Armee kann den festgehaltenen Sohn befreien und
die Lage in Burgund beruhigen.
ab 1490 - HEIRAT MIT ANNE DE BRETAGNE UND „BRETONISCHER BRAUTRAUB"
Maximilian I. heiratet 1490 über einen Stellvertreter die erst
14-jährige Anne, Erbin des Herzogtums Bretagne. Karl VIII., König von
Frankreich und eigentlich mit Maximilians Tochter Margarethe verlobt,
schreitet aber ein und ehelicht Anne, deren Ehe mit Maximilian I. noch
nicht vollzogen wurde. Damit wird Anne zur französischen Königin und
die Bretagne verliert ihre Unabhängigkeit.
1490 - MAXIMILIAN I. ÜBERNIMMT TIROL
Nach Jahren des Krieges kommt Maximilian I. 1490 aus Burgund nach
Tirol. Dort verzichtet sein Onkel Sigmund, genannt der Münzreiche, auf
Drängen der Tiroler Stände auf die Regentschaft über Tirol und die
Vorlande. Nach burgundischem Vorbild beginnt Maximilian I. mit der
Modernisierung der bestehenden Verwaltung und formt das
Erscheinungsbild Innsbrucks als neue Residenzstadt entscheidend.
1493 - TOD KAISER FRIEDRICHS III.
Am 19. August 1493 stirbt Maximilians I. Vater, Kaiser Friedrich III.,
in Linz. Mit einer Herrschaftszeit von über 50 Jahren war Friedrich
III. das am längsten regierende Oberhaupt des römisch-deutschen Reichs
aller Zeiten. Während seiner Herrschaft bereitete Friedrich III.
den Weg für Maximilian I. und damit den Aufstieg der Habsburger in
Europa.
1494 - HOCHZEIT MAXIMILIANS I. MIT BIANCA MARIA SFORZA
Die Hochzeit Maximilians I. mit Bianca Maria Sforza hat auf beiden
Seiten pragmatische Beweggründe: Bianca Marias Onkel, Ludovico Sforza,
strebt nach dem Herzogstitel in Mailand; der notorische Schuldner
Maximilian I. hingegen sieht in der großzügigen Mitgift eine
willkommene Finanzspritze. Die Leidtragende ist Bianca Maria, die den
Großteil ihres restlichen Lebens in Innsbruck verbringt - ohne ihren
Mann.
1496-1497 - SPANISCHE DOPPELHOCHZEIT
Um das Bündnis zwischen Habsburgern und Spaniern zu stärken, heiraten
Maximilians I. Kinder Johann und Johanna von Aragón und Kastilien. Da
der Thronfolger Johann kurz nach der Hochzeit stirbt, rücken Philipp
und Johanna in der Reihenfolge um die spanische Krone an die Spitze:
Ihr gemeinsames Kind Karl, Maximilians I. Enkel, regiert als spanischer
König und als römisch-deutscher Kaiser.
1500 - GEBURT KARLS V. UND GEBIETSGEWINNE FÜR MAXIMILIAN I. UM GÖRZ
Im Februar 1500 wird Maximilians I. Enkel Karl geboren. Dieser herrscht
später als Erbe der Heirats- und Erbpolitik seines Großvaters über ein
Reich, „in dem die Sonne nie unterging". Nur zwei Monate nach Karls
Geburt stirbt Leonhard von Görz, mit dem das Adelsgeschlecht der
Meinhardiner ausstirbt. Maximilian I. erbt dessen Herrschaften im
Pustertal, in Oberkärnten, Görz und Friaul.
1508 - MAXIMILIAN I. WIRD IM DOM VON TRIENT ZUM ERWÄHLTEN RÖMISCHEN KAISER ERNANNT
Traditionell wurden die meisten römisch-deutschen Könige in Rom vom
Papst zum Kaiser gekrönt. Allerdings verhindert eine Sperre der
Venezianer Maximilians I. Zug zum Petersdom. Er nimmt daraufhin mit
Zustimmung des Papstes in Trient den Titel eines Erwählten Römischen
Kaisers an. Maximilians I. Nachfolger verzichten künftig sogar ganz auf
die Zustimmung des Papstes.
1510 - TOD VON BIANCA MARIA SFORZA
Die Entfremdung zwischen Maximilian I. und seiner zweiten Ehefrau wird
immer größer: Bianca Maria ist bei seiner Kaiserproklamation nicht
anwesend. Seit Ludovico Sforza Mailand an Frankreich verloren hat,
zeigt Maximilian I.
überhaupt kein Interesse an seiner Gemahlin mehr: Als sie 1510 stirbt,
weilt Maximilian I. in Freiburg im Breisgau. Er unterlässt es, zu ihrem
Begräbnis zu reisen.
1511 - MAXIMILIAN I. ERLÄSST DAS TIROLER LANDLIBELL
Im Einvernehmen mit den Tiroler Ständen schafft Kaiser Maximilian I.
mit dem Landlibell einen entscheidenden Teil der Tiroler
Landesverfassung, der im Kern bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
fortgeschrieben und nur leicht abgeändert wird: Für die Stände ist
diese Urkunde deshalb so bedeutend, weil sie garantiert, dass nur dann
Kriegsdienst geleistet werden muss, wenn der Krieg innerhalb Tirols
stattfindet.
1515 - WIENER DOPPELHOCHZEIT
Nach dem Erfolg der Spanischen Doppelhochzeit und in Anbetracht der
vorrückenden osmanischen Truppen will Maximilian I. das Königreich
Ungarn (mit Böhmen und Kroatien) an sich binden. Dazu verheiratet er
seinen Enkel Ferdinand mit Anna von Ungarn und seine Enkelin Maria mit
dem ungarischen Thronfolger Ludwig II. Mit der Doppelhochzeit in Wien
wird der Grundstein für die spätere Donaumonarchie gelegt.
1519 - TOD MAXIMILIANS I.
Im Januar 1519 verstirbt Maximilian I. auf der Reise von Innsbruck nach
Linz in Wels. In seinem - kurz vor dem Tod diktierten letzten Willen -
fordert Maximilian I. ein bescheidenes Begräbnis. Außerdem ordnet er
an, dass sein Leichnam gegeißelt, ihm die Haare geschoren und die Zähne
ausgebrochen werden sollen. Das kann als Wille eines gottesfürchtigen
Menschen gedeutet werden, der als Büller aus dem Leben scheiden will.
* * *
DAS GOLDENE DACHL - Matthias Perathoner, Goldenes Dachl, 1777, Öl auf Leinwand, Tiroler Landesmuseen
Auf diesem Gemälde ist das Gebäude mit drei Obergeschossen dargestellt.
Beim Umbau zu einem Mietshaus um 1822 wurde das ehemalige Grabendach zu
einem vierten Obergeschoss ausgebaut. Das Gebäude erhielt dabei ein
hohes Walmdach. Gut zu sehen sind auch die Stützmauern aus Höttinger
Brekzie, die nach einem schweren Erdbeben, das 1670 die Region um
Innsbruck und Hall erschüttert hatte, angebracht wurden.

EIN BAUHERR DES REICHS UND DER STÄDTE
Kaiser Maximilian I. (1459-1519) verkörpert wie keine andere
historische Persönlichkeit im Umbruch zwischen Spätmittelalter und
Früher Neuzeit den Geist des Zeitenwandels. Geboren in Wiener Neustadt,
regierte Maximilian I. im Wesentlichen wie die Reisekönige des
Mittelalters: Bis nach dem Tod seiner ersten Frau Maria von Burgund
lebte er am burgundischen Hof, danach zog sein Hofstaat mit ihm durch
das Reich. Am öftesten hielt er sich in Augsburg auf, in Innsbruck am
zweithäufigsten. Maximilians Verdienste waren zahlreich: Durch die
Heirats- und Erbpolitik mit den Königshäusern von Burgund, Spanien und
Ungarn legte er den Grundstein für ein Weltreich, „in dem die Sonne nie
unterging". Mit Innsbruck als neuem Mittelpunkt des Reichs begann er
von Tirol aus sein umfangreiches Reformwerk. Die Stadt erzählt noch
heute von ihrem Kaiser und zahlreiche Kunstschätze - wie das Goldene
Dachl - zeugen von seinem Repräsentationswillen. Als bedeutender
Habsburger, als Förderer von Kunst und Wissenschaft sowie als Reformer
und Bauherr in der Stadt Innsbruck wird von seinem Tod 1519 bis heute
an ihn erinnert - ganz so, wie er sich seine „gedächtnus" zu Lebzeiten
ausmalte.
* * *
THRONSIEGEL/BULLE KAISER MAXIMILIANS I.
Ulrich Ursentaler, Siegel Maximilians I., Silber, 1518, Abguss der nicht zur Ausführung gekommenen Bulle, Tiroler Landesmuseen

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: