web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Judenburg
Stadtmuseum & Puchmuseum, August 2024
Judenburg ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Murtal in
der Steiermark mit knapp 10.000 Einwohnern. Durch die Stadt fließt der
längste Fluss der Steiermark, die Mur. Das Stadtgebiet war bereits zur
Hallstattzeit besiedelt, wie der Fund des Strettweger Kultwagens
belegt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen Stadtturm, Museum Murtal,
Puchmuseum und Stadtmuseum Judenburg.
* * *
Ehemaliges Minoritenkloster - Um 1254 errichtet, 1395 Erweiterung durch
einen Kirchenbau, 1455 Umwandlung in ein Franziskanerkloster, beim
großen Stadtbrand 1807 großteils zerstört und deshalb als Kloster
aufgehoben, von 1820 bis 1857 als k.k. Gymnasium geführt. Danach diente
es als Hauptschule und Polytechnische Schule. Im Westflügel ist die
Stadtbibliothek untergebracht. Im Ostflügel befindet sich das Museum
Murtal: Archäologie der Region.

Kultwagen von Strettweg, stammt aus dem Mittelmeerraum ca. 600 v. Chr.

Was bedeutet der Name Judenburg?
Der Name Judenburg — und darin sind sich die meisten Historiker und
Ortsnamenforscher einig — steht in einer ganz bestimmten Verbindung mit
einer Reihe von Orten im Ostalpenraum, deren namengebender Bestandteil
„Juden-”" lautet. Neben Judenburg finden sich nämlich, insbesondere an
wichtigen mittelalterlichen Verkehrs- und Handelswegen, zahlreiche Orte
mit diesem charakteristischen Namensbestandteil. Es seien hier nur die
an oder nahe der so genannten Italien- oder Venedigerstraße gelegenen
Judendörfer bei Villach, Maria Saal, Friesach, Neumarkt und
Leoben erwähnt. Betrachtet man nun die Lage dieser und anderer
Judenorte, so fällt auf, dass sie
nicht zufällig verteilt an den mittelalterlichen Verkehrswegen, sondern
an ganz bestimmten, verkehrsgeografisch neuralgischen Punkten lagen,
etwa an Straßenkreuzungen, an Flussübergängen, am Fuß von Passstraßen
oder in unmittelbarer Nähe wirtschaftlicher Zentren.
Diese Stützpunkte erst befähigten die jüdischen Händler und Kaufleute,
die beträchtlichen Distanzen zwischen dem Mittelmeer- und dem Donauraum
zu bewältigen. Judenburg war Teil dieser über das Land verteilten
Stützpunkte. Die Namensendung „-burg“ widerspricht dieser Deutung
keineswegs, denn mit dem Begriff „burg“ bezeichnete man noch im 10.
Jahrhundert nicht eine Burg im heutigen Sinne, sondern in der Regel
eine (vor)städtische Siedlung im allgemeinen bzw. eine
Kaufmannssiedlung im Schutz eines Herrschaftszentrums im besonderen.
Zusammenfassend kann man sagen: Der Name Judenburg leitet sich von der
Handelstätigkeit der Juden im Hochmittelalter ab und bedeutet eine in
unmittelbarer Nähe eines Herrschaftszentrums gelegene jüdische
Fernhändlersiedlung.

GEBURTSSTUNDE EINER STADT
„Judinburch" so lautet der ers- te schriftliche Nachweis einer am
Ostrand der Murterrasse gelegenen Burganlage, der in etwa aus der Zeit
um 1075 stammt. Knapp drei Jahrzehnte später, im Jahre 1103, erhalten
wir Kunde vom ,mercatum Judenpurch", der ältesten steirischen
Kaufmannssiedlung, die sich von einer lokalen Mautstelle für das
Kloster St. Lambrecht zu einem wichtigen überregionalen Handelszentrum
entwickeln sollte.
BLÜTEZEIT EINER HANDELSSTADT
Die rasch aufstrebende, um 1224 zur Stadt erhobene Kaufmannssiedlung
(Bürgergemeinde) und der dem Adel vorbehaltene Burgbezirk (Ritterstadt)
wuchsen im Verlauf des 13. und 14. Jahrhunderts zusammen und wurden
nach und nach durch eine Stadtmauer umschlossen. Die Stadt blühte auf.
Privilegien wie das Stapelrecht, das Monopol des Speik- und
Roheisenhandels und die Prägung des „Judenburger Guldens“ trugen dazu
ebenso bei wie die verkehrsgeographisch günstige Lage Judenburgs.
Speziell der Handel mit Italien florierte prächtig, Judenburger
Kaufleute hatten für einige Jahrzehnte eine eigene Handelsniederlassung
in Venedig.
KUNST, JUDENTUM UND STADTTURMBAU
Die in Judenburg bis zu ihrer Vertreibung im Jahr 1496 ansässigen Juden
haben den Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft entscheidend
mitgestaltet. Durch
die aus dem weitreichenden Handel resultierenden Kontakte fand
protestantisches Gedankengut in Judenburg früh Eingang. In
künstlerischer Hinsicht üben vorrangig zwei Zeiträume und deren
Kunstschaffen einen prägenden Einfluß aus. Der Meister Hans von
Judenburg, der in seiner Werkstätte Stein und Holzplastiken fertigte
sowie der Glockengießer Hans Mitter, beeinflussten das künstlerische
Geschehen Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts wesentlich. Zum
anderen das 18. Jahrhundert, mit der von Balthasar Prandstätter
begründeten und von Johann Nischlwitzer weitergeführten „Judenburger
Schnitzwerkstätte‘“, die weit über den obersteirischen Raum Bekanntheit
erlangte. Im Spätmittelalter schließlich begann man mit dem Bau des
Judenburger Wahrzeichens, des heute 75 m hohen Stadtturms.
SCHWIERIGE ZEITEN BRECHEN AN...
Handel und Eisenverarbeitung brachten der Stadt Wohlstand und
bescheidenen Reichtum. Judenburg erlangte im 14. und 15. Jahrhundert
den Ruf, die „Hauptstadt von Obersteier‘“ zu sein. Infolge der
Konkurrenz durch andere Städte, der großräumigen Verlagerung der
Handelsrouten, äußerer Gefahren wie Türkensturm und Franzoseninvasion
verlor die Stadt zunehmend an Einfluss. Zudem wurde Judenburg im Laufe
seiner Geschichte von zahlreichen verheerenden Stadtbränden (u. a.
1504, 1670, 1709, 1807, 1840) heimgesucht. Jedoch hat seine Funktion
als Zentrum der landesfürstlichen Verwaltung (ab 1480
Viertelhauptstadt, ab 1750 Kreishauptstadt, ab 1850 Bezirkshauptstadt)
Bedeutungsverlust doch entscheidend gemildert. Der Handel mit
„geschlagenem Eisen“, insbesondere der Handel und die Herstellung von
Waffen, entwickelte sich im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten
wirtschaftlichen Faktoren. Um 1600 galt Judenburg als Schwertschmiede
des Landes.

AUFSCHWUNG DURCH INDUSTRIALISIERUNG
Der Beginn der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts prägte fortan die Entwicklung von Judenburg und seiner
Umgebung. Besonders die Konzentration von eisenverartbeitenden
Betrieben im Stadtgebiet bewirkte einen nachhaltigen wirtschaftlichen
Aufschwung, der in der Folge auch das bis dahin bürgerlich geprägte
Stadtbild entscheidend veränderte.
DIE STADT MIT CHARME UND FLAIR
Durch eine behutsame Verbindung von Bewahrung und Erneuerung, von
Tradition und Moderne bei der Stadtbildpflege, gelang es, in den
letzten Jahrzehnten gerade den sensiblen Altstadtbereich mit seinen
reizvollen Bauensembles in seiner Eigenart zu bewahren und
gleichlebendigen Ort der Begegnung zu gestalten. Dem Wandel zeitig als
der Zeiten folgend präsentiert sich Judenburg heute als Stadt mit einem
ebenso reichhaltigen wie qualitätsvollen Kultur- und Freizeitangebot,
darüberhinaus auch als ein von den Naturschönheiten der Seetaler Alpen
umgebenes Zentrum des sanften Tourismus.
DIE PERLEN DER STADT
Der bewegten Geschichte Judenburgs entstammen viele Sehenswürdigkeiten,
die teilweise noch sehr gut erhalten sind. Uber allem ragt der
gewaltige steinerne Wächter, der Stadtturm, der heute hoch über dem
Hauptplatz das modernste Planetarium Europas beherbergt, und dessen
Aussichtsgalerie in 42 Meter Höhe einen überwältigenden Blick auf
Judenburg und sein Umland gewährt.

Stadtturm, Galerie 41 m, Spitze 75,5 m
Höchster freistehender Stadtturm in Österreich (75,66 m). Spätgotischer
Bau (1449 bis ca. 1520), später barockes Zwiebeldach, nach den
Stadtbränden (seit 1882) jetzige Dachform. Von der Galerie (41 m, 256
Stufen) prachtvoller Rundblick. Beherbergt seit November 2006 das
höchstgelegene Planetarium der Welt, bequem über einen gläsernen Lift
im Turminneren auch für Gehbehinderte und ältere Menschen erreichbar.

Stadtpfarrkirche St. Nikolaus
Der gegenwärtige Bestand der erstmals 1148 genannten Kirche umfasst den
um 1513 erbauten Chor und das nach dem Stadtbrand von 1670 erneuerte
monumentale Schiff. Die Kirche verfügt über einen großen einschiffigen
Hauptraum, an dessen Längsseiten je drei Kapellen mit Emporen darüber
aufscheinen. Vom Kunstbestand der
Kirche sind eine — Hans von Judenburg zugeschriebene — Muttergottes mit
Kind, aus Kalkstein aus der Zeit um 1420, weiters die Schnitzfigur des
hl. Nikolaus, ein Werk der Judenburger Werkstätten (18. Jh.), sowie die
auf Wandpfeiler in Chor und Schiff verteilten Schnitzfiguren von 10
Aposteln und 2 Heiligen, entstanden in der Judenburger Werkstätte des
Bildhauers Balthasar Prandtstätter, zu erwähnen.

Durch eine kleine Freitreppe an der Nordfassade oder über das linke
Steinportal im Presbyterium betritt man die zweijochige, 1990
gereinigte und seitdem in altweiß gefärbelte Marienkapelle
(ein Frauenaltar schon 1338 bezeugt). Über Wandvorlagen mit stukkierten
Kapitellen breitet sich flächiger Gewölbestuck aus. Pro Joch halten
vier Putten stuckgerahmte Bildfelder im Wölbescheitel, während die
Zwischenräume gleichmäßig von vegetabilen Ranken gefüllt sind (ca.
1705/15, P. ZAAR zugeschrieben). Die Deckenfresken von 1953 zeigen nach
Art der Katechismusbilder Szenen aus dem Leben Mariens und der Passion
Christi von der Verkündigung bis zur Marienkrönung. Die Glasfenster mit
der Unterweisung Mariens durch Anna und einem Abbild des Nährvaters
Joseph sind um 1900 in der Tiroler Glasmalerei Innsbruck hergestellt
worden.
Der barockisierende Altaraufbau von 1838 ist eine Stiftung des
Handelsmannes A. L. Pfeifer. In der blauen Mittelnische steht als
kostbarstes Ausstattungsstück der Kirche die 1,45 m hohe Kalksteinfigur
der „Judenburger Madonna"; sie geht auf drei bürgerliche Stiftungen
zwischen 1415 und 1425 zurück und ist vielleicht in der WERKSTÄTTE des
HANS von JUDENBURG entstanden. Im Typ ist sie den „Schönen Madonnen“‘,
insbesondere der Pilsner Madonna und Salzburger Beispielen verwandt,
das Kind steht in etwas älterer Tradition. Die zarte blau-weiße Fassung
wurde erst 1947 freigelegt. Die Judenburger Madonna ist eine der
qualitätvollsten spätgotischen Plastiken der Steiermark. Sie wird von
Barockstatuen des Joachim und der Anna flankiert.
Einen bewußten Kontrast bildet die davor aufgestellte hölzerne, mit
Glaselementen bereicherte Möbelgruppe Volksaltar, Ambo, Sitzgruppe und
Leuchter (Entwurf: MANFRED FUCHSBICHLER 1990, Ausführung: GUNTHER
ÖBERZAUCHER). An den Wänden stilistisch unterschiedliche Konsolfiguren:
der Servitenheilige Peregrin, eine vorzügliche Arbeit der Judenburger
Werkstätte um 1750; die Pestpatrone Rochus und Sebastian aus dem späten
17. bis frühen 18. Jahrhundert.

Die Kanzel am südlichen
Triumphbogenansatz ist von der Sakristei aus betretbar. Ein 1534/37
vielleicht vom heimischen Bildhauer Gallus Seliger, dem Schöpfer der
vielfigurigen steinernen Kanzel der Villacher Stadtpfarrkirche,
angefertigter Vorgänger wurde bereits in der Barockzeit ersetzt; die
heutige Kanzel aus dem Jahre 1781 (Chronogramm am Schalldeckel) stammt
aus der Dominikanerkirche in Leoben und wurde nach deren Schließung
1815 erworben. Es ist eine späte Rokokoarbeit mit Evangelistensymbolen,
Gesetzestafeln und drei in Gold und Silber gefaßten Brüstungsreliefs
mit zwei Szenen aus dem Leben des hl. Dominikus (Predigt sowie
Überreichung des Rosenkranzes durch Maria).
Seitenkapelle rechts: Allerheiligenkapelle
Bereits 1339 bezeugt, seit einer Fronleichnamsstiftung des Hermann
Heinricher von 1644 (Gedenktafel aus Messing am Kapellenbogen unter der
Konsolfigur) Gruftkapelle seiner später als Grafen von Heinrichsberg
geadelten Familie, 1694 als Gottesleichnamsaltar geweiht,
Fertigstellung in heutiger Form im ersten Jahrzehnt des 18.
Jahrhunderts. Über dem Kapellenbogen in Stuckkartusche Allianzwappen
der Grafen Heinrichsberg und Trauttmansdorf (um 1690); im Gewölbe
unorganischer, lederner Stuck, die hochbarocken Fresken mit der
Anbetung der Eucharistie durch teilweise musizierende Engel
(Deckenspiegel und seitliche Kartuschen) sowie Putten mit
Leidenswerkzeugen Christi (in der Bogenlaibung) wurden 1990 gereinigt.
Der hochbarocke, säulengefaßte Stuckmarmoraltar u. a. mit Allianzwappen
der Heinrichsberg, das vielfigurige Altarbild „Allerheiligen“ 19.
Jahrhundert, im Aufsatz Ölbild „Letztes Abendmahl“ 18. Jahrhundert. Auf
der Altarmensa bemerkenswerte Madonna auf der Mondsichel (Holz, ca.
1480/1500, das Kind barock ergänzt, die originale Fassung
wiederhergestellt) aus der Augustiner- und späteren Jesuitenkirche
(heute Festhalle), auf barokkem Sockel. Am Kapellenbogen bunt gefaßte
Konsolfigur hl. Florian, Judenburger Werkstätte 2. Viertel des 18.
Jahrhunderts.

Der beeindruckend weite Innenraum (Gesamtlänge 46 m, davon das Langhaus
26 m, Gesamtbreite 22 m, ohne Kapellen 12,4 m, Höhe des Mittelschiffes
18,7 m) ist von klarer Tektonik: In einen rechteckigen Langhausgrundriß
sind drei Wandpfeilerpaare derart eingestellt, daß sie Platz für ein
etwas schmäleres westliches Joch mit Stiegenhauspaar und drei
kreuzgewölbte Seitenkapellenpaare mit darüberliegenden, ebenfalls
kreuzgewölbten Emporen bieten. Der eingezogene und etwas erhöhte
Chorraum wird links durch eine abgeschlossene Marienkapelle und rechts
symmetrisch durch die Sakristei dermaßen eingefaßt, daß die
Langhausmauern in gleicher Flucht bis zum Apsisansatz weiterlaufen;
darüber öffnen sich Oratorien in je zwei Rundbögen mit ornamentierten
Sohlbänken zum Chor. Die überaus geschickte Disponierung der tragenden
Gebälkteile (im Langhaus unterbrochen, in Chor und Apsis durchlaufend),
der Gurt- und Schildbögen, Wölbungen und Wandfüllungen verleiht dem
Raum Harmonie, Ordnung und Monumentalität und besticht durch
HellDunkel-Effekte; wirkungsvoll ist auch der weitgehende Verzicht auf
füllende Dekoration insbesondere im mächtigen Stichkappengewölbe. Das
spätgotische Mauerwerk ist fast unmerklich in das barocke Raumkonzept
integriert; die westliche Orgelempore wurde nicht von Sciassia geplant,
sondern nachträglich eingefügt. Die Restaurierung von 1990 brachte eine
verstärkte Akzentuierung der Architektur durch unterschiedliche Tönung:
grau die vorderste Pilasterschicht, die Gurtbögen, das Chorgewölbe und
die Gewölbe zweier Seitenkapellen, die Deckenspiegel sowie die
Ortsteine der Apsisfenster, weiß das Gebälk samt Verkröpfungen, der
Stuck, die Wölbegrate, Deckenspiegelrahmen und Eierstabprofile,
cremefarbig der Hintergrund (Wandflächen und Schildbögen); die
Pilastersockel sind steinfarbig.

Judenburger Weihnachtskrippe
„ER ist Mensch geworden" - „INCARNATUS EST" steht als Überschrift der
Judenburger Weihnachtskrippe. Die historisch bedeutsame
Weihnachtskrippe aus dem 18. Jahrhundert (erbaut 1750-1760) wurde 2023
von der Langenwanger Werkstätte Sebastian Fankl restauriert. Die
ursprünglichen Baumeister sind Balthasar Prandstätter und Johann
Nischlwitzer (aus der Judenburger Schnitzwerkstätte) und der Faßmaler
Ignaz Loy. Mit ihren ca. 105 Figuren zählt sie zu den größten Krippen
der Steiermark.
Dr. Michael Georg Schiestl vom Stadtmuseum Judenburg hält fest: „Die
nicht nur kunstgeschichtlich, sondern als Zeugnis barocken
Glaubenslebens auch volkskundlich und nicht minder touristisch
bedeutende Judenburger Panoramakrippe wurde nach ihrer um- fassenden
Restaurierung in der Barbarakapelle aufgestellt und kann nun ganzjährig
besichtigt werden."

Im Blickfeld steht die „Menschwerdung Jesu" und Geschehnisse rund um
seine Geburt: die Anbetung der Hirten, die Beschneidung (am achten Tag
nach Jesu Geburt), die Anbetung der Könige (Erscheinung des Herrn -
Dreikönig), der Kindermord zu Bethlehem und die damit verbundene Flucht
nach Ägypten sowie das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana.
Dem „Verein der Freunde und Förderer der Judenburger
Weihnachtskrippe" und allen Spender:innen ist herzlichst zu danken,
dass dieses Werk „vollendet" wurde. Am zweiten Adventsonntag, dem 10. Dezember 2023, dem „Patrozinium
HI. Nikolaus", dem Namensfest der Stadtpfarrkirche, wurde die
Krippe gesegnet.

Im Chorraum liegen sich zwei Steinportale mit gesprengten und
gedrückten Segmentgiebeln nach Art des D. Scıassıa symmetrisch
gegenüber. Daneben zwei bunt gefaßte marmorne Wappengrabsteine der
Maria A.J. von Königsbrunn auf Neuliechtenstein (+ 1738) und des
Andreas Heyss zu Grubhofen und Rosenbach (+ 1748) mit Gattin und Neffen
(+ 1769).

Auf Stufen und säulengefaßtem Marmorsockel erhebt sich der in Form
eines Reliquienschreines aufgebaute, neugotische Hochaltar (Plan H.
PASCHER, Ausführung P. NEUBÖCK, geweiht am 13. Oktober 1901 durch
Fürstbischof Leopold Schuster). Zuseiten des querschiffartigen
Tabernakels stehen in mit Wimpergen und Fialen bekrönten Nischen die
Figuren der hll. Rupert, Petrus, Paulus und Martin sowie zweier Engel.
Die mit neugotischem Maßwerk versehenen Apsisfenster enthalten figurale
Glasmalereien der Tiroler Glasmalerei-Anstalt Innsbruck von 1900/1901
(von links nach rechts): der hl. Nikolaus als Retter der drei Mädchen
vor Armut und Schande, als Lehrer sowie als Wundertäter bei einem
Meeressturm. Im Chor auch rotmarmorner Taufstein des späten 17.
Jahrhunderts, der Schnitzaufsatz der Taufe Christi (Judenburger
Werkstätte 3. V. 18. Jh.) in Verwahrung. Marmorner Volksaltar und Ambo
von Ingo Lasserus 1990.

Die Stadtpfarrkirche erhielt 1608 durch Paul Grueber 1608 eine Orgel
auf der neuerrichteten Westempore des Vorgängerbaus. 1706 bis 1708
erfolgte mit der Fertigstellung des barocken Neubaus auch der Bau einer
neuen Orgel mit elf Registern durch den aus Zug in der Schweiz
stammenden Joseph Ignatz Meyenberg. 1827 wurde Simon Anton Hölzl mit
einem Orgelneubau von 20 Registern beauftragt. Die Orgel fand
Aufstellung auf der Westempore mit einem zweigeteilten Prospekt, das
die Sicht auf die Fensterrose freiließ. 1901 kam es zu einem Neubau der
Orgel im bestehenden Prospekt durch die Firma Matthäus Mauracher.
Größere Reparaturen wurden 1928 durch Erwin Aigner aus Innsbruck und
1933 durch Konrad Hopferwieser ausgeführt, 1952 erfolgte ein Umbau
durch Max Dreher aus Salzburg. 2019 wurde durch Francesco Zanin in
Codroipo bei Udine eine weitgehende Rückführung der Disposition auf den
Zustand von 1901 als ein Denkmal der Orgelromantik vorgenommen.

Aussicht vom Stadtturm über die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus zur Kalvarienbergkirche und Burgruine Liechtenstein

Aussicht vom Stadtturm zum Hauptplatz, links das Bezirksgericht Judenburg (ehemalige Neue Burg)

Stadtmuseum - Einst das
St.-Barbara-Bürgerspital (Anfang 15. Jh.). Sehenswertes Museum mit
historischem Bild- und Dokumentationsmaterial und Schaustücken von
überregionaler Bedeutung, zu sehen sind u. a. eine hervorragende
Nachbildung des hallstattzeitlichen Strettweger Kultwagens sowie der
Judenburger Goldgulden.
Ehemalige Augustinerkirche (Veranstaltungszentrum)
- Die. ehemalige Kirche des Augustiner-Klosters wurde nach der Übergabe
an die Jesuiten (1620) umgebaut. Die Umgestaltung zur Festhalle mit
Räumlichkeiten für Theater, Konzerte und Veranstaltungen erfolgte 1950
bis 1953, seit 1996 in ihrer heutigen Fom bestehend.
Das PUCH Museum wurde im
September 2007 eröffnet und gewährt dem Besucher einen tiefen Einblick
in die österreichische Automobilgeschichte. Die gesamte
Vierrad-Palette, die unverwüstlichen Puch-Fahrräder und die legendären
Roller und Mopeds fehlen ebenso wenig, wie das kultige „Pucherl" - der
ewig junge Steyr/Puch 500.

DIE GLOCKEN
Man nimmt an, daß die ersten Glocken von dem Judenburger Hans Mitter
gegossen wurden. Ein Beweis dafür ist nicht zu erbringen, außerdem wäre
dieses Geläute bereits beim Brand im Jahre 1504 zerstört worden.
Genauso im Dunkeln liegt die Herkunft des Geläutes, das nach der
Fertigstellung um 1520 in den Turm kam. Zeitlich käme dafür der
Glockengießer Nikolaus Grünewald, Bürger von Judenburg, in Frage, von
dem zwischen 1508 und 1533 vier Glocken bezeugt sind. Das Geläute des
Turmes bestand aus 5 Kirchenglocken von schöner Konsonanz der 4
Stimmen, 150 Zentner schwer (= 4.200 kg). Die größte Glocke wog 2.775
kg.
Nach der Brandkatastrophe im Jahre 1670 wird berichtet, „daß die
Glocken wegen des damals entstandenen starken Winds zerschmolzen und
dem Regen gleich tröpfend gemacht, davon des meiste Metall (um vieler
unter dem Schutt 4ganze Wochen das Feuer sich aufgehalten) verzehrt und
die übrige weniger zerflossene Teil in der Größe eines subtilen Sandes
muß mit großen Unkosten durch das Waschen zusammengesucht werden."
Nach der Zerstörung im Jahre 1709 (der dritte Großbrand am 23. Oktober 1709 mit 13 Toten) gibt ein Sammelregister Auskunft.
„Am 9. März 1711 zwischen 4 und 5 Uhr
nachmittag sint 3 glogn gosn wordn und gweicht sint sie wordn den
ersten juny zwischen 5 und 6 uhr nachmitag nach judenburg sint sie
khumen den 20. juny, aufgezogen sint sie wordn den 25. juny."
Beim Brand von 1807 zerschmolzen im Stadtturm 5 Glocken. Die vier neuen
Turmglocken wurden 1811 in Graz von Martin und Johann Franz Feltl
gegossen und dort am 8. November 1811 geweiht. Am 29. Oktober 1832
wurde das Geläute um noch weitere 2 vermehrt. Den Brand von 1840
überlebten alle sechs Glocken. Der Erste Weltkrieg brachte dann die
Ablieferung von 5 Glocken. Es verblieb damit nur die 879 kg schwere
Marienglocke.
Nach dem Krieg mußte Judenburg bis 1923 auf ein neues Geläute warten.
Das neue Geläute erfreute die Judenburger nur 19 Jahre. Bis auf die 76
kg schwere fis-Glocke wurden am 25. März 1942 alle Glocken aus dem
Stadtturm entfernt. Am 24. Februar 1942 wird im Sinne der Richtlinien
des Reichswirtschaftsministers zur Anordnung des Beauftragten für den
Vierjahresplan über die Erfassung von Nichteisenmetallen vom Landrat
des Kreises Judenburg die Glockenabnahme angekündigt! Erst im Jahre
1948 konnte man ernstlich an eine Auftragserteilung an eine
Glockengießerei denken. Am 16. Oktober 1949 versammelten sich die
Judenburger auf dem Hauptplatz und in den Straßen, um beim Festzug des
neuen Geläutes durch die Stadt zugegen zu sein. Zum erstenmal erklang
das neue Geläute am späten Nachmittag während einer Gedächtnisfeier
beim Kriegerdenkmal.

Das alte Uhrwerk
Schwer gelitten hat der Turm durch den großen Stadtbrand am 5. Juni
1670. Über die Schäden berichtete der damalige Stadtpfarrer Mag.
Steinschitz (1647-1678) an die Hofkammer:
...der von Quaderstücken weit berühmte hohe Turm ist einem hohlen Rohr gleich ausgebrannt... ...das
über 200 Jahre alte Uhrwerk von 10 Zentner Eisen (= 280 kg) ist auch
vom Turm gefallen und unter Schutt durch das verborgene Feuer in Grund
verbrannt und verdorben.
Eine neue Uhr wurde 1696 nach Judenburg gebracht, hergestellt von dem Uhrmacher Andre Sämmel aus Bruck.
Der dritte Großbrand am 23. Oktober 1709 zerstörte die gesamte Stadt.
Der Stadtturm brannte wieder bis auf die Grundmauern aus. Die
Herstellung der Turmuhr fällt in das Jahr 1724. Es wurde mit „Johann
Georg Geßel, Bürger in Gräz" vereinbart, ...eine
gutte taugliche und proportionierte Uhr mit viertl und ganzen stund auf
die große Gloggen slagendt in gmainer Stattthurm alhier zum Preis von
fl 270 zu liefern..." Perpendickel des alten Uhrwerks, frühere Länge 65 Schuh = 20,5 Meter

Der Stadtturm - Bauzeit von 1449 bis 1520
In den Jahren 1504, 1670, 1709 und 1840 wurden bei den Stadtbränden das
Turmdach, die Glocken und das Uhrwerk zerstört. Das Turmdach wurde
immer dem jeweiligen Baustil entsprechend verändert. Die ersten Glocken
wurden schon während der Bauzeit 1504 zerstört und es wird angenommen,
dass die Glocken aus der weithin bekannten Werkstätte des Hanns Mitter
aus Judenburg stammten. Nach dem Brand von 1840 wurde der Turm um ca.
14 Meter erhöht. Er ist der höchste freistehende Stadtturm mit einer
begehbaren Galerie in Österreich. Die Gesamthöhe beträgt 75,66 Meter.
Seit November 2006 beherbergt der Stadtturm das höchstgelegene
Planetarium der Welt.

Stadtmuseum Judenburg - Seit 1949 sammelt, bewahrt, erforscht und
vermittelt der Museumsverein Judenburg die Geschichte der Stadt und
ihrer Region. Das heutige Museum wurde 1990 eingerichtet und zeigt auf
drei Stockwerken Stadt-Geschichte von der Steinzeit bis zur Gegenwart.
Zu den Highlights der Schausammlung zählen u.a. ein historisches
Panoramamodell der Stadt, wertvolle Urkunden zur Stadtgeschichte,
christliche und regionale Kunst, oder die umfangreiche Sammlung alter
Handwerksgerätschaften.

Schild des ehemaligen Gasthauses „Sandwirt" im Haus Kaserngasse 16

Schild des Geschäftes Johann Steinacher im Haus Hauptplatz 12. - Der
Judenburger Bürger Johann Steinacher betrieb in dem Haus, in dem sich
heute die Raiffeisenkasse befindet, eine Buch-, Kunst- und
Musikalienhandlung. Daneben führte er auch einen kleinen Verlag und
eine Leihbibliothek.

Schild des Einkehr-Gasthauses zu den „Drei Kronen". Das Schild trägt
die Jahreszahl 1668 und ist damit das älteste erhaltene Schild in
Judenburg. Das Gasthaus befand sich im Haus Murgasse 9. Die bereits
stark abgewitterte Rückseite des Schildes zeigt Pferd und Wagen vor
einem Gebäude.

Judenburger Gulden - Kopien (angefertigt 1989)
Albrecht II. (1330-1358), CNA E1 (KHM, Münzkabinett)
Rudolf IV. (1358-1365), CNA E2 (KHM, Münzkabinett)
Albrecht III. (1365-1395), CNA E4 (KHM, Münzkabinett)

Pfarrlade - Eisen, Judenburg 1822 Geschenk der Pfarre.
EISERNE TRUHE - Stadtkassa von Judenburg

Bronze-Amphore aus dem Fürstengrab von Strettweg (ca. 500 v. Chr.)
Die Bronzeamphore, die den Leichenbrand aufnahm, wurde stark beschädigt
gefunden und wie der Kultwagen restauriert. Die Bronzeamphore setzt
sich aus zwei separat getriebenen Hälften, die sich entlang des
„Aquators" Überlappen, zusammen. Beide Teile sind vernietet. Zwei
Bronzehenkel sind mit dem Gefäßkörper verbunden. Den Untersatz bilden
mehrere Vierkantstäbe aus Bronze, die den obersten Ring mit dem
untersten (dem Standring) verbinden. (Die Amphore ruhte auf einem
konischen Bronzeblechfuß mit schmückendem Knauf - bei der Kopie nicht
vorhanden).
Strettweger Kultwagen - Der
bedeutendste steirische Fund aus der Älteren Eisenzeit
(Hallstattperiode) wurde 1851 bei Feldarbeiten vom Strettweger Landwirt
Ferdinand Pfeffer vlg. Trögl entdeckt. Kopie, angefertigt von Gert
Albrecht, Judenburg, Original im Landesmuseum Joanneum
Strettweger Kultwagen
Kopie: von Gert Albrecht / Fundort: Strettweg, Gemeinde Judenburg / Datierung: 7. Jahrhundert v. Chr., Bronze
Der berühmte Kultwagen (Gruppe: Kesselwagen) von Strettweg wurde 1851
auf dem Acker des Landwirtes Franz Pfeffer, vlg. Trögl, am Fuße des
Falkenberges bei Planierungsarbeiten entdeckt. Bei der Bergung sind
außer dem Wagen zahlreiche Grabbeigaben zum Vorschein gekommen, die auf
ein hallstattzeitliches Fürstengrab deuten. Der in seiner Eigenart
einmalige Kultwagen mit Bronzekessel (aus der Hallstattperiode: 700-450
v. Chr.) hat zu zahlreichen Deutungsversuchen Anlaß geboten. Die
Beigaben des Fürstengrabes belegen die „weltweiten" Handelsbeziehungen
der Hallstattfürsten von Judenburg (Salz, Kupfer, Eisen), die
einerseits bis an das Mittelmeer, andererseits bis nach Frankreich und
weit nach Norden und Osten reichten. Die Frage nach dem
Verwendungszweck des Kesselwagens ist bis heute ungelöst. Es gibt
gewichtige Argumente, daß der Wagen kultischen Zwecken diente
(Fruchtbarkeitsgöttin Noreia mit der Opferschale, „Gang ins Jenseits").

Fahrrad „Waldteufel" - Entworfen und angefertigt um 1890 von Thomas Walisch.
Im Jahr 1905 erwarb der Judenburger Fahrradhändler Blasius Wachter am
Landtorberg Nr. 2 das Fahrrad. Seine Söhne Leopold und Josef Wachter
übergaben es Ende der 50er Jahre dem Museumsverein Judenburg.

Klassenfotos

Obermurtaler Tracht - Alltagsdirndl, 1962
Oberteil (Leibl): blauer Wollbrokat, Silberknöpfe Unterteil (Kittl)
roter Wollbrokat, handgezogen, Schürze: Seide, blau-gestreift

Letztes Abendmahl, Johann Nischelwitzer Holzplastik 1760

Die Holzplastik „Hl. Petrus" stammt aus der Judenburger Werkstätt des
Balthasar Prandstätter und Johann Nischlwitzer. Der Hl. Petrus ist der
Schutzpatron der Fischer, Schiffer, Bildhauer, Uhrmacher, Maurer,
Schlosser, Töpfer, Glaser, Weber, Tischler, Sattler sowie der Patron
von Rom.

Judenburger Werkstätte 1713-1780
Balthasar Prandstätter, Bildhauer
Prandstätters Geburtsjahr liegt vor 1689. Am 1. Jänner 1717 wird er
Bürger der Stadt Judenburg und schafft hier eine der bedeutendsten
Kunstzentralen im steirischen Barock (Kaserngasse 5). Seit den 40er
Jahren führt er diese gemeinsam mit Johann Nischelwitzer. Prandstätter
stirbt im Jahr 1756.
Johann Nischelwitzer, Bildschnitzer
Nischelwitzer wird um 1722 als Sohn eines gleichnamigen Kärntner
Bildhauers geboren. Seit den 40er Jahren arbeitet er an der
Schnitzwerkstätte des Balthasar Prandstätter mit, dessen Witwe er 1757
heiratet, um die gutgehende Werkstätte zu übernehmen. In der Zeit
gemeinsamen Schaffens erledigen sie Aufträge im ganzen oberen Murtal,
Ennstal und auch in Teilen Kärntens. Nach dem Tod seines Meisters nimmt
die Produktivität Nischelwitzers enorm ab. 1778 stirbt er in Judenburg.

SCHUBLADENKASTEN um 1804
Wiener Kommoden-Uhr ca. 1840

Hammerherrenzimmer, 1842, Geschenk: Fam. Baron v. Löwenthal, Wasendorf

Biedermeierkasten, 1833

Perkussionsflinte & Fahne der Bürgergarde 1848

Waffeleisen, Hostien-Presse - WAFFEL- und HOSTIENEISEN
Der Name kommt aus dem holländischen, von „wafel" für Honigwabe.
Hostieneisen bilden die Urform für die Waffeleisen. Das Motiv für die
Christen war das Osterlamm mit der Kreuzesfahne des Heiligen Römischen
Reiches im gekrümmten Vorderfuß. Das Waffeleisen ist im Mittel- und
Süddeutschen Raum seit dem 16. Jhdt. nachweisbar. Zuerst wurden die
Waffeleisen geschmiedet, später die Platten auch gegossen. Die
verschränkte Form verkörpert symbolhaft die Einswerdung des
Menschenpaares und eignete sich als sinnige Brautgabe. Die äußere Form
blieb seit Jahrhunderten unverändert, nur die Ausgestaltung zeichnet
den Geist und Stil seiner Entstehungszeit. Häufige Motive sind
Lebensbaum, springender Hirsch, Wappentiere, christ-katholische Motive
und häufig der Doppeladler. Seit der Renaissance sind Waffeleisen im
Bürgertum und bei den Handwerksmeistern als Statussymbol beliebt.
Festtage wurden durch feines Gebäck aus Waffel- oder Oblateneisen
verschönert.

Nach dem so genannten Anschluss wurden einigen zentralen Straßen und
Plätzen der Stadt neue Namen verliehen. Diese Umbenennungen waren Teil
des Personen- und Märtyrerkultes des nationalsozialistischen Regimes,
das damit seine Macht und Präsenz zum Ausdruck brachte.
1934-1938 Dr. Dollfuß-Platz
1938-1945 Adolf Hitler-Platz
ab 1945 Hauptplatz


Werdegang einer Sense
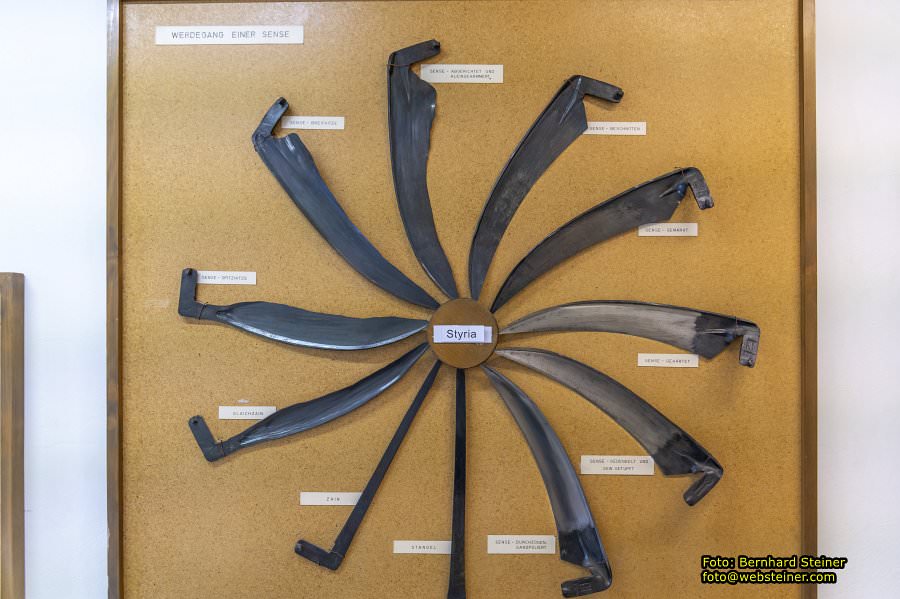
WASCHMASCHINE um 1935

Friseurstuhl mit Dauerwellen-Apparat

Bleistiftspitzer um 1910 verwendet im Büro der Talkum-Werke Weißkirchen
Wurstschneidemaschine

Stadtkino Judenburg: Programmvorschau Jänner 1971
Ankünder 'In 80 Tagen um die Welt' im Juli 1959

Modell der Stadt Judenburg

Puch Museum Judenburg - Die Faszination Puch erleben!
Das Puch Museum Judenburg präsentiert auf über 600m² die Meilensteine
der Fahrzeug-Entwicklung mit legendären Autos, Mopeds, Motorrädern und
Fahrrädern.

Das Puchmuseum Judenburg ist ein Ort des Erlebens und Staunens für die
ganze Familie, der die Meilensteine der Fahrzeugentwicklung hautnah
erleben lässt. Legendäre Fahrräder, Motorräder und Autos werden
anschaulich präsentiert und wecken Erinnerungen an die weltweiten
Erfolge der Marke Puch.

KULTIG: DAS SCHÖNSTE PUCHMUSEUM DER WELT
Der Puch 500, das Puch Maxi, Pinzgauer und Puch G. Nicht nur eine
weltweite Erfolgsstory. Sondern Kultfahrzeuge, die unauslöschbare
Erinnerungen hinterlassen haben. Judenburg bringt den Zauber von Puch
zurück. Die Marke Puch ist aus Österreichs Fahrzeuggeschichte nicht
wegzudenken. Wehmütig denkt die 60er-Generation an ihr erstes
„Pucherl"; in den 70igern und 80igern war das Puch Maxi vielfaches
Erstfahrzeug für angehende Maturanten. Der unverwüstliche Pinzgauer war
ebenso wie der Puch G weltweit über Jahrzehnte einer der gefragtesten
Geländewägen überhaupt.
Kurzum: Meilensteine in der Menschheitsgeschichte der Fortbewegung, Im
von „Puch-Freaks" mit unglaublichem Enthusiasmus arrangierten
Puchmuseum Judenburg versetzt man sich auf zwei Stockwerken zurück in
die Zeit der 50iger und 60iger Jahre. Erinnerungen und Nostalgie für
die Besucher, die die Erfolgsgeschichte von Puch selbst miterleben
konnten: das Freiheitsgefühl auf einer Puch Maxi, das faszinierende
Geländefeeling eines Haflingers, die Strapazen auf einem Waffenrad,
Originale und akribische Restaurationen bis hin zum Scheunenfund mit
Dreck, Rost und Stroh haben 2007 im Puchmuseum Judenburg ein neues
Zuhause gefunden. Eine beeindruckende Schau für Jung wie Alt, die
niemanden kalt lässt.

STEYR-PUCH IMP 700 GT
Bj. 1961, Ps/kW: 40/29,4 bei 5500U/min
2 Zylinder Boxer Viertakt-Motor luftgekühlt (Steyr-Puch Motor)
80 mm Bohrung, 64 mm Hub und 645 cm³ Hub
Leichtmetall Karosserie, Leergewicht (trocken): 460kg, für Wettfahrten: 425kg
4 Vor-, 1 Rückwärtsgang, Höchstgeschwindigkeit: über 145km/h
Benzinverbrauch: 5,5L/100km, Bauzeit: 1960-1961
Stückzahl: 21
Das Kürzel GT steht für Gran Turismo. Damit sind grundsätzlich
verlötete Sportwagen gemeint, also in der Regel Coupés, die gegenüber
dem offenen Roadster etwas mehr Stauraum und Wetterschutz bieten, wenn
die Strecke lang ist. Die vorzügliche und sehr belastbare Technik aus
Graz wurde zur Basis für ein Fahrzeug, zu dem die Fratelli Corna in
Turin die markante Karosserie fertigten. So entstand der spektakulär
wirkende Sportler von Intermeccanica & Puch, daher das Kürzel Imp.
Costruzione Automobili Intermeccanica war ein italienischer Hersteller
von Automobilen. Frank Reisner und seine Frau Paula gründeten 1959 das
Unternehmen North-East Engineering Company in Turin. Später wurde es in
Costruzione Automobili Intermeccanica umbenannt. Als Markenname wurde
Intermeccanica gewählt. Zunächst fertigen sie Fahrzeugtuningsätze. 1960
begann die Produktion von Automobilen. Der Markenname lautete zunächst
IMP für ein Modell. Von 1960 bis 1961 gab es den IMP 700 GT mit dem
Markennamen IMP (für Inter Meccanica Puch).
Der IMP 700 GT war Intermeccanicas erstes Straßenfahrzeug. Er ist ein
kleiner zweisitziger Sportwagen, der 1961 und 1962 gebaut wurde. Der
Name Imp (deutsch: Kobold) ist ein Akronym für Intermeccanica Puch.
Konzeptionell lehnte sich Intermeccanica bei diesem Kleinwagen an den
Abarth 750 GT Zagato an, der 1956 vorgestellt worden war und seit 1957
in Serie produziert wurde. Während der Abarth auf Fiat-Komponenten
aufbaut, basiert der IMP 700 GT auf technischen Komponenten des
österreichischen Kleinwagens Puch 500, hat aber einen getunten Motor
und eine eigenständige Karosserie. Ein Zweizylinder-Boxermotor von
Steyr Daimler Puch mit 80 mm Bohrung, 64 mm Hub und 645 cm³ Hubraum
treibt die Fahrzeuge an. Die Leistung beträgt in der Serienausführung
40 PS. Die Karosserie des Imp besteht aus Aluminiumblechen. Ihre Form
hatte Frank Reisner selbst entworfen; auch hier zeigt sich eine
Ähnlichkeit mit dem Abarth 750 GT Zagato. Die Karosserien baute die
Carrozzeria Fratelli Corna, die auch als Subunternehmer für Zagato
tätig war. Der Imp 700 GT war im Motorsport erfolgreich. Von ihm
entstanden insgesamt nur 21 Fahrzeuge.

Puch 500 - Die Geschichte
1952: Beginn der Arbeiten an einen Kleinwagen mit Zweitakt-Motor
1955: Ubersiedelung des Projektes nach Graz
1956: Prototyp mit der späteren Mechanik steht vor der Serienreife.
1957: Es wird beschlossen, die entwickelte Technik [Motor, Getriebe,
Pendelachse) in Fiat-500-Karosserien einzubauen. Präsentation des
Steyr-Puch 500 am 30. 9. 1957.
1959: Puch 500 D (S 24.200.-) mit festem Hardtop-Dach und 500 DL (S
25.000.-) mit mehr Leistung (19.8 PS) und verbesserter Ausstattung.
1960: Präsentation der Kombi-Modelle 7000/700 E (S 29.500,-/700 C) mit
643 ccm und vollsynchronisiertem Getriebe. Im 500 können die
Wintermäntel ausgezogen werden, die Heizanlage erhält einen zweiten
Wärmetauscher. Weitere Änderungen: Blinker statt der unteren
Lüftungsschlitze, automatische Kuppelung „Saxomat" erhältlich.
1962: 650 T (S 28.280.-) mit 19,8 PS ersetzt den 500 DL Alle Modelle
erhalten einen Aschenbecher, der Benzinhahn wird durch ein
Reservelamperl ersetzt
1963: Der 650 TR (S 31.950.-) ist nun ganz offiziell im Programm, mit
der Steigerungsstufe TR II wird der Höhepunkt an Puch'scher
Sportlichkeit erreicht.
1966: Karosserietechnischer Einschnitt, ab nun sind die Türen vorne
angeschlagen, statt, des bis zur Motorhaube durchgehenden Verdecks gibt
es nur mehr ein kurzes Faltdach. Die vergrößerte Windschutzscheibe
bringt mehr Sicht auf Landschaft und Ampeln. Der TR erhält die
Zusatzbezeichnung Europa, weil er nun auch in ausgesuchte europäische
Länder exportiert werden darf - sogar eine rechtsgesteuerte Variante
wird entwickelt.
1968: Ende der herkömmlichen Produktion in Graz. Ab nun werden
komplette Fiat 500 angeliefert und mit einem Puch-Motor ausgestat tet.
Dazu müssen alle Anbauaggregate umkonstruiert werden. Zwei Modelle 500
mit 16 PS und 500 S mit 19.8 PS.
1973: Endgültiges Produktionsende des Puch 500

Puch Mercedes G - Die Geschichte
1973: Die Daimler-Benz AG und die Steyr-Daimler- Puch AG beschließen, gemeinsam einen Geländewagen zu entwickeln und zu bauen.
1977: Eine eigene Gesellschaft, die GFG (Geländefahrzeug-Gesellschaft),
wird gegründet. Steyr-Daimler-Puch und Daimler-Benz halten je 50
Prozent der Gesellschaftsanteile, als Produktionsstandort des geplanten
Geländewagens wird Graz festgelegt.
1979: Beginn der Serienfertigung. Rahmen und Aufbau werden im Auftrag
der GFG in Graz gefertigt, wo auch die Endmontage erfolgt, die
Aggregate werden von verschiedenen Daimler-Benz-Werken in Deutschland
angeliefert.
1981: Neustrukturierung der Aufgabenteilung zwischen Daimler-Benz und
Steyr-Daimler-Puch, Auflösung der Geländefahrzeug-Gesellschaft.
Daimler- Benz konzentriert sich auf Weiterentwicklung und Vertrieb,
Steyr-Daimler-Puch auf die Produktion. Weiterhin wird der Puch/Mercedes
G auf unterschiedlichen Märkten als Mercedes oder Puch verkauft.
1987: Der 50.000ste Puch/Mercedes G läuft vom Band.
1990: Der Puch/Mercedes G wird komplett überarbeitet. Von nun an läuft
er in zwei unterschiedlichen Versionen vom Band, wahlweise mit
zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb.
1999: Jubiläum 10 Jahre Puch G, 140.000 Stück wurden bisher produziert.

Puch Pinzgauer 4x4/6x6 - Die Geschichte
1965: Die zu geringen Außenmaße und relativ wenig Nutzlast für immer
größer werdenden Transportbedarf machte die Entwicklung eines
Nachfolgers des Haflingers notwendig. Nach genauen Marktanalysen wurde
der Pinzgauer in seien wesentlichen Eigenschaften definiert.
1971: Offizielle Präsentation des Pinzgauers. Schon vorher wurden
Kunden, etwa das Schweizer Militär, mit Prototypen beliefert, um
Wünsche direkt umzusetzen. Der Wagen wurde im Lauf seines Lebens in
etlichen Motorvarianten angeboten. Der Ur-Pinzgauer besaß einen
luftgekühlten Reihenvierzylinder-Benzinmotor (2499 ccm, je nach
Einsatzort 74 bis 87 PS), eine Steyr-Daimler-Puch-Eigenentwicklung.
1979: Präsentation der Zivilversion.
1983: Der luftgekühlte Vierzylinder wurde aus Gründen verschärfter
Abgasbestimmungen durch zwei Versionen mit Benzineinspritzung (Bosch
K-Jetronic, mit/ohne Turbolader) ersetzt. Bei vergrößertem Hubraum
(2679 Kubikzentimeter) betrug die Leistung nunmehr 105 bzw. 115 PS
(maximales Drehmoment 196 bzw. 206 Nm bei 2800 bzw. 3000/min).
1985: Einführung des wassergekühlten Vierzylinder-Turbo-Dieselmotors
(von W zugekauft). Er war in Leistung und Drehmoment etwas schwächer
als die jetztige Version (77 kW/106 PS bei 4250/min, 195 Nm bei
2500/min), es fehlte noch der Ladeluftkühler.
Optisch sind die Dieselpinzgauer durch eine voluminöse Hutze an der Front, hinter welcher der Wasserkühler sitzt, erkennbar.
1989: Der Pinzgauer mit Turbodieselmotor und Ladeluftkühlung wird auf Wunsch mit ZF-4-Gang-Automatikgetriebe ausgeliefert.
Sonst blieben Antrieb und Chassis bis auf zahlreiche Verfeinerungen in
Richtung Komfort (Geräuschisolierung, Servolenkung, geänderte
Bedienungsele- mente) und Optimierung des technischen Auftretens
(Scheibenbremsen, Betätigen des Allradantriebs bzw. der Sperren durch
Kippschalter, Niveauregulierung, Verlängerung des Radstandes und
Verbreiterung der Spur) seit 1971 nahezu unverändert.
1999: Vom Pinzgauer wurden, abgesehen von 18 Vorserienmodellen, von 1971 bis April 1999 24.000 Stück gefertigt.
STEYR-PUCH PINZGAUER 712 M
Baujahr: 1976
Hubraum: 2499 ccm
Leistung: 66 kW/90 PS

Puch-Triebkopf
Der Puch-Triebkopf ist ein Antriebsaggregat mit angetriebener,
gelenkter Vorderachse, einem, Vorderrahmen und einem Fahrerhaus. Er
kann durch seine Rahmenkonstruktion mit entsprechenden
Kommunalmaschinen, Hebeaggregaten oder sonstigen Maschinen, die eines
Antriebsaggregates bedürfen, an drei Punkten mit Zentrierbolzen und
Flanschschrauben verbunden werden. Die Anschlüsse für die hydraulische
Bremse, die Handbremse und die Kabel für die Heckleuchten sind nach der
Montage des Arbeitsgerätes anzuschließen.
Technische Daten:
Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, Bohrung: 80 mm, Hub: 64
mm, Hubraum: 643 ccm, Verdichtungsverhält- nis: 1:7,8, Leistung: 27 PS
DIN bei 4800 U/min, max. Drehmoment: 4,5 mkp bei 3500 U/min, Vergaser:
Spezial-Gelände- Fallstrom-Doppelvergaser, 12-Volt-Lichtanlage.
Kraftübertragung: Mechanisch vom vor der Vorderachse liegenden
Frontmotor über Einscheiben-Trockenkupplung; 5-Gang-Wechselgetriebe;
Kegelradantrieb; (mit sperrbarem Ausgleichsgetriebe) auf die
Vorderachse mit Stirnradvorgelegen. Getriebe: Schaltgetriebe mit
Vorderachsantrieb in einem Gehäuse; 5 Vorwärtsgänge
(sperrsynchronisiert), 1 Rückwärtsgang; Gesamtübersetzung Motor/Achse:
Kriechgang 138,8; 1. Gang 47,22; 2. Gang 27,60; 3. Gang 16,46; 4. Gang
11,28; Rücklaufgang 44,94; Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h bei U/min
max.; Kriechgeschwindigkeit 1,5 km/h bei mkp max.; Steigfähigkeit: 22%
(Haftgrenze); Kraftstoffverbrauch: Straßenfahrt 10 l/100 km; Kriechgang
ca. 3-5 l/h; Vorderachsantrieb: direkt vom Achsantrieb, der zwischen
Motor und Wechselgetriebe liegt; Differentialsperre: während der Fahrt
von Hand einschaltbar; Nebenantrieb: durch eigene Schaltkupplung
zuschaltbar; Übersetzung: 2,11.
rechts: STEYR-PUCH 703 T Triebkopf, Baujahr: 1971
links: 703 AP/L, Baujahr: 1971, Originalzustand
Wurde an die Kommunalbetriebe der Stadt Berlin geliefert. Mit Kehrmaschine und Streugerät.

MEISTER MOTOR-DREIRAD
Kein Bastlerfahrzeug, sondern industriell hergestellt von der Fa. Ing. Meister in Graz.
Als Antriebsquelle dient ein PUCH-Mopedmotor mit 3 PS.
Erstzulassung: 22.04.1975
PUCH RACING
Baujahr: 1970
Getriebe: 5-Gang, 2-Takt
Doppeldrehschieber
Hubraum: 50 ccm
Gewicht: 49 kg
Leistung: 12,3 PS
12.500 U/min
Spitze: 168 km/h

Johann Puch (1862-1914)
1862: Johann Puch wird am 27. Juni als zweites Kind einer Bauernfamilie
in Saku ak im heutigen Slowenien (damals Untersteiermark) geboren
1878: Nach unterschiedlich und nie zweifelsfrei dokumentierten Lehr-
und Wanderjahren wird Puchs Spur eindeutig: Schlossergeselle in
Radkersburg
1885: Ab nun Wohnsitz Graz, Fahrradmechaniker, dann Werkführer
1889: Heirat mit Maria Reinitzhuber, Gründung der Styria-Fahrradwerke
1894: Sieg eines Styria-Rades bei Paris - Bordeaux
1897: Nach Hereinnahme deutscher Gesellschafter scheidet Puch aus den Styria-Werken aus
1899: Gründung der Firma „Erste Steiermärkische Fahrradfabrik Johann Puch, A.G."
1901: Beginn Motorradproduktion
1904: Beginn Autoproduktion
1906: Sieg eines Puch-Motorrads in der „Coupe Internationale"
1909: Mit einem Puch-Auto wird der Geschwindigkeitsrekord von 130,4
km/h erzielt. Ein Puch-Motor treibt das Luftschiff „Estaric I"
1912: Ein länger bestehendes Herzleiden verschlimmert sich.
Offensichtlich nach einem Zerwürfnis mit den Gesellschaftern scheidet
Johann Puch aus seiner Firma aus und wird „Ehrenpräsident". Das Werk
beschäftigt zu diesem Zeitpunkt 1100 Arbeiter und erzeugt 16.000
Fahrräder, 300 Motorräder und 300 Autos. Präsident des Grazer
Trabrennvereins
1914: Johann Puch stirbt am 19. Juli in Zagreb

PUCH V50 E/D, Baujahr: 1959, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,7 PS
PUCH VS 50 D, Baujahr: 1957, Hubraum: 50 ccm, Leistung: 1,24 kW / 1,7 PS
PUCH MV 50 Baujahr: 1979, Hubraum: 48,8 ccm
Puch MS 50 V, Baujahr: 1967, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,24 Kw/ 1,7 PS
PUCH MS 50, Baujahr: 1954-1956, Hubraum: 49,8 ccm, Leistung: 1,6 PS

PUCH ROLLER RL 125
Baujahr: 1953
Hubraum: 125 ccm
Leistung: 5 PS
PUCH RL 125
Baujahr: 1954
Hubraum: 121 ccm
Leistung: 4 kW/5 PS

PUCH M 50 S, Baujahr: 1974, Hubraum: 48,9 ccm, Leistung: 2,8 PS
PUCH X 55-4, Silver Speed, Baujahr: 1984, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 2 PS
PUCH X 50, White Speed, Baujahr: 1987, Hubraum: 49 ccm, Leistung: 2,7 PS, Neupreis: 14.820,00 Schilling
PUCH BOSS, Baujahr: 1990, Hubraum: 49,3 ccm, Leistung: 1,4 kW,
Weiterentwicklung des Puch Maxi bei Piaggio nach dem Verkauf der
Zweiradsparte nach Italien.
PUCH Maxi Turbo, Baujahr: 1981 - 1989, Hubraum: 50 ccm, Leistung: 2 kW / 2,7 PS

PUCH DS 50 V, Baujahr: 1972
PUCH R 50V, 1965-1972, Baujahr: 1970, Hubraum: 48,8 ccm, Leistung: 1,91 kW/2,6 PS
PUCH SRA 150, Baujahr: 1960, Hubraum: 147 ccm, Leistung: 5 kW/6 PS
PUCH SR 150, Baujahr: 1959, Hubraum: 147 ccm, Leistung: 6,3 PS

PUCH RL 125
Mit Original Felber-Beiwagen
Baujahr: 1955
Hubraum: 121 ccm
Leistung: 5 PS

VESPA APE 550 MP
Baujahr 1967
187 ccm
9,4 PS

PUCH 250 S4
Absolute Rarität!
Baujahr: 1938, Leistung: 9 PS
Umbau mit Puch 250 TF Komponenten ca. 1950-1952 durch die damalige Firma Illichmann Wien.
Mit 4-Gang Fußschaltung, Telegabel vorne, Hinterrad Federung etc.

Büste von Friedrich Schiller im Schillerpark

Kalvarienbergkirche - Auf Ansuchen der „Leiden-Christi-Bruderschaft"
der Jesuiten 1720 bis 1722 am Ort einer Andachtstätte erbaut.
Beachtenswert sind die Statuen „Christus an der Geißelsäule und
Schmerzhafte Maria" von Balthasar Prandtstätter (18. Jh.).

Aufstieg zur Kalvarienbergkirche

Die Kalvarienbergkirche befindet sich auf einem Plateau am Nordabhang
des Liechtensteinerberges und wurde um 1720 von einem Judenburger
Ratsherrn als Dank für eine glücklich überstandene Notsituation
errichtet.

Leider ist die Kalvarienbergkirche versperrt, aber immerhin ein Bilick durch das Schlüsselloch möglich.

Ulrich von Liechtenstein, der bedeutendste steirische Minnesänger (geb.
um 1200, gest. 1275/76), hatte seine Stammburg in der Nähe von
Judenburg. Mit seinem großen, 1255 vollendeten Roman „Frauendienst",
dem ersten biographischen Roman in deutscher Sprache, hat er uns einen
wunderbaren Reise- und Geschichtsführer hinterlassen. Ulrich erzählt
darin vom Ritterleben und vom Minnedienst, von der schwierigen Zeit des
Interregnums (1246-1273), der herrscherlosen Zeit. Er führt uns in das
Mitteleuropa seiner Zeit und schildert uns Lebensart und Lebensgefühl
des Mittelalters. Weniger bekannt ist der „Politiker" Ulrich: Er war
Truchseß der Steiermark und Anführer des steirischen Adels gegen den
Ungarnkönig Bela IV. Die Stadt Judenburg verdankt ihm die Anlage des
Stadt- und Burgbaches, der ältesten Wasserleitung, die die weitere
Stadtentwicklung wesentlich beeinflußte.

Weyergasse, 8750 Judenburg

Weyergasse, 8750 Judenburg

Das Wahrzeichen Judenburgs, der Ende des 15. Jahrhunderts erbaute,
heute 75 m hohe viergeschoßige Turm, gehörte einst als freistehender
Wehr- und Feuerturm zur Stadtbefestigung. Das oberste Geschoß in 42 m
Höhe mit der umlaufenden Galerie entstand nach dem letzten großen
Stadtbrand von 1840. Aus dieser Zeit der Erbauung stammt das roh
bearbeitete spätgotische Turmportal. Noch heute ist der Turm ein
weithin sichtbares Symbol vergangenen Reichtums und städtischer
Wehrhaftigkeit. Der einstige Reichtum der Handelsstadt spiegelt sich
nirgendwo eindrucksvoller wider als in den zahlreichen erhaltenen
historischen Bauten im Bereich der Altstadt, etwa den heute liebevoll
restaurierten Bauensembles am Hauptplatz, wo auf den Wochen- und
Jahrmärkten einst auch deutsche und oberitalienische Kaufleute ihre
Waren feilboten.

Hotel Post
Dieses Haus war im Mittelalter ein Gerichtsgebäude (Schranne). Anfang
des 16. Jahrhunderts war es im Besitz des wohlhabenden Judenburger
Bürgers, Bürgermeisters und Stadtrichters Ruprecht Ambring. Ab 1600
befanden sich hier ein Wirtshaus und eine Brauerei. Von 1851 bis ca.
1878 war hier, zusätzlich zur Gastwirtschaft, das Postamt
untergebracht, das vorher im Mittonihaus stationiert war. Im
malerischen Innenhof befinden sich Pfeilerarkaden aus dem 19.
Jahrhundert. Unter dem Renaissance-Erker blickt eine farbig gefasste
Marmorhalbfigur (im Volksmund "Jud am Eck" genannt) auf die
Vorbeigehenden herab. Sie stellt vermutlich den ehemaligen Hausbesitzer
Ruprecht Ambring dar.

Wann ana a Geld hat und ist saudumm, kauft er sich a alt's Haus und baut's wieder um

Die Mur vom Mursteg gesehen

Magdalenakirche - Dieser gotische Bau auf romanischer Grundlage aus der
Zeit von 1270 bis 1350 besteht aus dem dreiseitig schließenden Ostchor
und der zweischiffigen Halle mit Kreuzrippengewölben. Besonders
beachtenswert sind die gotischen Glasgemälde mit Szenen aus dem Alten
und Neuen Testament sowie Bildnissen der Stifter (14. Jh.).
Bemerkenswert auch die gotischen Fresken, die Rundbilder der zwölf
Apostel (14. Jh.) sowie der schöne Hochaltar (17. Jh.).

In dem nüchternen, seit der Überarbeitung der Bodenplatten (1988)
wieder urtümlicher wirkenden zweischiffigen und dreijochigen
Hallenlanghaus gehen die zwei schlanken Achteckpfeiler ohne Kapitelle
in Kreuzrippen (bzw. im östlichsten Halbjoch zum Triumphbogen hin in
ein Sternrippengewölbe) über, während die bis auf die tief
heruntergezogenen Dienste mit polygonalen Konsolen ungegliederten Wände
dazu einen reizvollen Kontrast bilden. Die Schlusssteine sind bis auf
zwei reliefierte mit Farbspuren im Langhaus ungegliedert. Die
Raumwirkung wird im Westen durch die stützenlose Eisenbetonempore mit
Stiegenaufgang aus den Jahren 1962/63 beeinträchtigt.
Hinter einem stark eingezogenen profilierten Triumphbogen erhebt sich
leicht erhöht ein kreuzrippengewölbter Chorraum in zwei Jochen mit
5/8-Schluss, der auffallend stark nach Norden geknickt ist. Die Dienste
der Gewölberippen sind durch Figurennischen mit plumpen, im Barock
überarbeiteten Baldachinen unterbrochen und ruhen unter dem
Kordongesims in Höhe der Fenstersohlbänke auf Konsolen auf. Vor der
Nordostecke ist in die Mauer eine gotische Sakramentsnische mit
Kielbogen- und Fialenbekrönung eingelassen und mit einem durchbrochenen
Schmiedeeisengitter versperrt; dahinter eine Tresortüre aus Judenburger
Edelstahl (1962/63).

Von größtem künstlerischen Wert sind die hochgotischen Glasfenster.
Besonders das Presbyterium wird durch sechs zwei- bis vierbahnige
Fenster mit teilweise erneuertem Maßwerk auf schrägem umlaufenden
Sohlbank- und Kordongesims belichtet. Darin befinden sich die 85 auf
acht Fenster verteilten Glasmalereien aus der Zeit um 1380 bis nach
1400. Ihnen liegt wohl eine Stiftung des Bürgers Niclas des Weniger von
1356 zugrunde, aufgrund welcher allerdings die Fresken ausgeführt
worden zu sein scheinen; tatsächlich wurden sie aus Mitteln des
Landschreibers (Finanzverwalters) Paul von Ramung, des Ritters Erkinger
dem Mössinger und der Bürgerfamilie Massolter finanziert.
Der Zyklus ist aufgrund vielfacher Umgruppierungen, des
Erhaltungszustandes der bestehenden Scheiben und etlicher Verluste nur
bedingt rekonstruierbar, dürfte jedoch auf das Leben Mariä und Jesu
ausgerichtet gewesen sein. Die 1927 nach Vorschlag von Eberhard Hempel
neu zusammengestellten Gläser wurden bei der Neueinfügung nach dem
Zweiten Weltkrieg 1950 ausgebessert und 1988-1993 durch die Werkstätten
des Bundesdenkmalamtes in Wien gründlich restauriert. Angefertigt hat
sie eine möglicherweise lokale Judenburger Werkstätte, deren
volkstümlicher Stil sie deutlich von einer anderen, mehr höfisch
orientierten Werkstätte (mit Sitz in Wien?) abhebt. Die Gläser sind
stilistisch mit Ausnahme einer jüngeren Scheibengruppe im
Langhaussüdfenster einheitlich, lassen jedoch ein konsequentes
Bildprogramm vermissen. Die meisten Scheiben haben jeweils eine ganze
Szene oder eine biblische Gestalt zum Inhalt, mehrere Szenen reichen
über zwei Fenster.
Der linke Seitenaltar (M. 17.
Jh.) am Triumphbogen besitzt einen einfachen Rechter zweigeschoßigen
Ädikulaaufbau in schwarz-gold-rotem Farbakkord. Das Seitenaltar,
rundbogige Altarbild zeigt eine Marienkrönung, darunter Franz von
Assisi und den Stadtpatron Nikolaus mit drei Buben in einem Bottich,
die er gemäß Legende nach ihrer Ermordung durch einen habgierigen Wirt
wieder zum Leben erweckt haben soll. Das Oberbild zeigt die Vision des
Franz von Assisi, dem bei der Andacht das Jesuskind erscheint. Seitlich
flankieren zwei charakteristische frühbarocke Engel das Bild. Im
geschwungenen und durchbrochenen Aufsatz ragt die Monstranz als
gegenreformatorisches Symbol auf, begleitet von Flammenvasen.
Der beträchtlich jüngere rechte Seitenaltar
(3. V. 18. Jh.) besitzt eine illusionistische, etwas vorschwingende
Säulenarchitektur und wird von einem Baldachinaufsatz mit Lambrequins
überhöht. Darauf sehen wir eine Krone mit aufsitzender Monstranz. Die
zentrale Vollplastik der Immaculata ist ein qualitätsvolles Werk der
Judenburger
Schnitzwerkstätte des Balthasar Prandtstätter und wird flankiert von
Kleinplastiken des Johannes Nepomuk und Franz vonAssisi (?).
Seitlich stehen plumpe Standfiguren. von Laurentius und Leonhard (17.
Jh.), im Aufsatz hält ein Engelpaar den Vorhang.
Linker Seitenaltar, Mitte 17. Jahrhundert
Rechter Seitenaltar, 3. Viertel 18. Jahrhundert

Jesus und sein erstes Wunder-Zeichen
Künstler: Judenburger Werkstatt
Datierung: Gotik, Ende 14. Jahrhundert
Material: Glasmalerei
Ort: Judenburg, Pfarrkirche HI. Magdalena
In kontrastreicher Farbgebung erzählen die gotischen Fenster der
Judenburger Magdalenenkirche die Heilsgeschichte. In späteren Zeiten
wurde die Szene des Weinwunders oftmals üppig und detailreich
ausgestaltet. Der mittelalterliche Meister einer örtlichen Werkstatt
konzentriert sich in seiner Darstellung auf das Wesentliche. Fast intim
erscheint der Blick auf die Zentralszene. Sie fasst mehrere
Begebenheiten des Johannesevangeliums (Joh 2,1-11) Zusammen: Hinter dem
gedeckten Tisch führt die Muttergottes das Brautpaar und die Jünger an.
Sie weist auf ihren Sohn: „Was er euch sagt, das tut!" Jesus sitzt auf
einem Thron und wendet sich mit einem Segensgestus den Krügen zu, die
ein Diener vor ihn gebracht hat.
Das Wunder ist noch nicht geschehen, der in Wasser verwandelte Wein
noch nicht gekostet. Und doch wird aus der Art der Darstellung klar,
dass kein Zweifel an der Macht und Wunderkraft des Gottessohnes zu
bestehen braucht. Die Szene nimmt im Johannesevanglium eine
Schlüsselstellung ein: Sie schildert den ersten öffentlichen Auftritt
Jesu. In der bildlichen Umsetzung wird die königliche Souveränität des
Gottessohnes hervorgekehrt, diese aber in ein intimes Zueinander Marias
mit ihrem Sohn hineinverwebt. Die Gottesmutter und ihr Sohn sind sich
näher als in den meisten Darstellungen dieses Themas. Die Bewegung der
Hände verknüpft die beiden expressiv. Göttliche Souveränität und
intimes Zueinander als zwei wesentliche Dimensionen des
Christusgeheimnisses verschmelzen in der Darstellung auf gelungene
Weise.


Links vom Eingang steht eine frühbarocke Marienstatue (17. Jh.), die
ehemals als Assistenzfigur zu einer Kreuzigung gehörte; an der Nordwand
des Langhauses hängt ein Kruzifix der Judenburger Werkstätte (1. H. 18.
Jh.), flankiert von einem Engelpaar. An der Langhaussüdseite steht auf
einer barocken Konsole eine monumentale Figur des hl. Georg zu Pferd im
Kampf gegen den Drachen. Am zweiten Langhauspfeiler sehen wir auf einer
Konsole eine spätgotische geschnitzte Madonnenstatue auf einer
Mondsichel, das Jesuskind hält eine Traube in Händen (um 1485).
An der zuvor kahlen Landhausnordwand wurde 1952 ein
monumentales Fresko des hl. Augustinus im Ornat thronend angebracht,
umgeben von Ottilie und den virgines capitales Margarethe, Katharina,
Barbara und Dorothea, mit kleinfigurigen Stifterfiguren, darunter
einige Augustinermönche, in der unteren Zone. Dieses wichtige Werk des
Internationalen oder Weichen Stiles, datiert 1415 und damit parallel
zum Werk des Hans von Judenburg geschaffen, befand sich ursprünglich an
der Chorwand der Augustiner-Eremitenkirche (später Jesuitenkirche,
heute Festhalle) und wurde nach der Freilegung 1938/39 von Hans Esterer
restauriert (mit deutlichen Spuren etwa am Gesicht der Ottilie); eine
dazugehörige Marienkrönung wird im Stadtmuseum ausgestellt.
Fresko des hl. Augustinus im Kreise heiliger Jungfrauen, 1415

Bereits 1908 hat man bei einer Restaurierung im Chorbereich Teile des
Apostelcredos entdeckt, die jedoch erst ab 1936 durch F. Silberbauer
gesichert wurden, bis 1937/38 die übrigen Chorfresken durch Erich Hönig
freigelegt werden konnten. Die in einem Guss entstandenen Chormalereien
bieten ein typisches Beispiel einer mehrteiligen hochgotischen
Dekoration nach einheitlichem Programm, sind jedoch in einzelne
Bildeinheiten aufgegliedert. Sie stammen vermutlich von einem
einheimischen Künstler namens Franziskus, den eine Inschrift unter der
Kreuzigung nennt und von dem mittlerweile Werke in der Gösser
Stiftskirche, in der Leechkirche in Graz, in Murau und im Gurker Dom
bekannt sind. Die stark von der Friulaner Kunst des Trecento geprägten
Fresken stammenaus der Zeit um 1370.
Die Mitte der Nordwand oberhalb des Gesimses nimmt mit einer
Gesamt‚fläche von 5,50 x 3,70 m im unteren Drittel eine dichtgedrängte
vielfigurige Kreuzigung ein,über der in gemeinsamer Komposition
Marientod und -krönung dargestellt sind. Leider ist das kleinformatige
Stifterpaar in der linken Ecke nicht mehr zu identifizieren, auf das
sich die nicht vollständig erhaltene Inschrift unter dem Gesims mit der
Nennung eines Nicolaus (Weniger?) als Auftraggeber bezieht.
Tod und Krönung Mariens, Fresko an der Chornordwand, um 1370
Kreuzigung, Fresko an der Chornordwand, um 1370

Hochaltar (um 1650): Über der gemauerten Mensa mit einem geschnitzten
Antependium aus Ranken, Blumenschüssel und Monogramm (um 1700) erhebt
sich ein schlanker zweigeschoßiger Aufbau in Knorpelwerkornamentik;
beide Geschoße besitzen ein vorgestelltes Säulenpaar, das untere links
und rechts eine Bogenarkatur. Am Sockel auf den Konsolen unter dem
Säulenpaar finden wir links das Judenburger Stadtwappen und rechts das
Allianzwappen Heinrichsberg-Pagge (Hans Heinricher von Heinrichsperg
war seit 1650 Judenburger Burggraf). Im Hauptgeschoss ist das
Mittelbild „Heiliger Wandel“ (Jesuskind zwischen Maria und Josef bei
der Rückkehr aus Ägypten) angebracht, darüber wird Gottvater von einer
Engelschar flankiert. In die seitlichen Arkaturen sind Statuen der
Katharina und Barbara aufgestellt. Anstelle eines gemalten Oberbildes
sehen wir in einer rundbogigen Nische die Statue der büßenden Maria
Magdalena mit Kruzifix vor einem Totenkopf, seitlich flankiert von
einem eleganten Engelspaar auf Konsolen; im durchbrochenen
Rundbogengiebel erhebt sich auf einem Sockel der Erzengel Michael als
Seelenwäger.
Hochaltar, Altarauszug, Statue der büßenden Maria Magdalena
Hochaltarbild „Heiliger Wandel“ (M. 17. Jh.)

Magdalena Kirche
1271 Marien-Spitals Stiftung
Um 1350 golischer Kirchenbau
1805 Brand, Turmhelm erneuert
1964 als Pfarrkirche renoviert
Innen:Golische Glasfenster und Fresken aus 1356-1420
Die frühere Spitals- und heutige Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena
ist sowohl ein bedeutendes Gesamtkunstwerk der lokalen Hochgotik des
14. Jahrhunderts als auch ein frühes Beispiel einer steirischen
Spitalskirche. Die zweischiffige Halle ist das letzte erhaltene
Beispiel eines lokal weit verbreiteten Grundtyps und besitzt eine
überaus reiche und gut konservierte Ausstattung mit Glasfenstern einer
lokalen Werkstätte sowie eine durchaus originelle Chorfreskierung im
Stile des Friauler Trecento. Durch ihre spätere Vernachlässigung ist
der ursprüngliche Zustand des 14. Jahrhunderts überdurchschnittlich gut
überliefert, doch besitzt die Kirche auch gute barocke
Ausstattungsstücke der ersten frühbarocken Welle in der Mitte des 17.
Jahrhunderts und der Hochblüte der Judenburger Werkstätte im 2. Viertel
des 18. Jahrhunderts.

ZWEISTÄNDERDRUCKLUFT- OBERDRUCKHAMMER
Bargewicht 2400 kg
Gesamtgewicht 13.500 kg
Letzter Standort: VEW-Werk Judenburg

Styriapark mit der Brücke über die Mur namens Gußstahlwerkstraße

DOPPELARMIGE KURBELPRESSE
Gewicht 13.000 kg
Letzter Standort: VEW-Werk Judenburg

Gußstahlwerkstraße 20

Judenburg Bahnhof
Die Stadt Judenburg hat einen Bahnhof an der Rudolfsbahn. Am Bahnhof
hält alle zwei Stunden der Railjet nach Villach Hauptbahnhof und nach
Wien Hauptbahnhof. Eine RJ-Garnitur verkehrt nach Venezia Santa Lucia.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne diese Videos antun:
Judenburg, August 2024
Puchmuseum Judenburg, August 2024
Stadtmuseum Judenburg, August 2024