web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Karlstein an der Thaya
Horologenlandl, Oktober 2023
Karlstein/Thaya ist eine Marktgemeinde im Bezirk
Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. Karlstein an der Thaya
liegt im nördlichen Waldviertel und wird von der Deutschen Thaya
durchflossen. Der Ort ist bekannt für das Kräuterpfarrer-Zentrum, Uhrenmuseum und Schloss Karlstein.

Der Markt Karlstein, einst Zentrum des "Horologenlandes", wird überragt von der auf einem steilen Felssporn liegenden Burg. Das Schloss Karlstein
oder auch Burg Karlstein befindet sich auf einem steilen Felsen in
Karlstein an der Thaya in Niederösterreich. Karlstein wird als
Chadelstain im Jahr 1112 erstmals erwähnt. Als Lehensburg verschiedener
Adelsfamilien gehörte Karlstein dem jeweiligen Landesfürsten. Im Laufe
ihrer Geschichte wurde die Burg sehr unterschiedlich genutzt: als
Adelssitz, 1880 als Uhrenfabrik, im 20. Jahrhundert als Jugendherberge,
in den 1960er Jahren als Pensionsbetrieb und heute für Ferienwohnungen.
Mehrmals diente sie auch als Gefängnis. Berühmtheit erlangte Karlstein
im 18. und 19. Jahrhundert als Zentrum des "Horologenlandes". Die
Uhrenerzeugung führte zur Vergrößerung des Ortes und zur Markterhebung
vor 1784. Jedoch ist die Burg seit Jahren im Privatbesitz und leider
nicht öffentlich zugänglich!

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Pfarrkirche Karlstein an der Thaya

Ausblick auf Karlstein an der Thaya

Erstmals urkundlich genannt wurde Karlstein an der Thaya im Jahr 1112
als Chadelstain, um 1345 bereits Karlstein. Namensdeutung: Burg am
Felsen, die nach einem Mann mit dem Namen Karl benannt ist. Im 18.
Jahrhundert wurde der Ort ein Zentrum der Uhrenindustrie und vor 1784
zum Markt erhoben. Während des Ersten Weltkrieges befand sich hier das
Internierungslager Karlstein an der Thaya.

Jubiläumschronik 800 Jahre - Aus der Geschichte
Das Gebiet um Karlstein wurde etwa im 12. Jahrhundert gerodet, besiedelt und urbar gemacht.
Die erste Nennung der meisten Ortsnamen finden wir in der PRIMA
FUNDATIO des Stiftes St. Georgen (Herzogenburg), wonach dieses Stift
u.a. in folgenden Orten Zehentrechte hatte: Gotfridt Slag, Munichreytt.
Chadelstain, Gossenreytt, Sleter, Griespach, Hachenbart, Ekkrensdorff.
Gerhardsdorff, Tures, Minus Tures, Tumen und Gruenpach. Münchreith (
von Mönchen gerodet) geht auf eine Schenkung des Grafen von Kaabs an
das Kloster Garsten zurück (um 1150). Karlstein wird 1188 in einer
Urkunde der Klöster Pernegg und Geras erstmals erwähnt. Die rasche
Besiedlung des sog. Nordwaldes führte zu Feindseligkeiten zwischen
Böhmen und Österreich, die 1179 in einem Schiedsspruch des Kaisers
Friedrich Barbarossa bereinigt wurden. Die damals festgelegte Grenze
zwischen den beiden Herzogtümern verlief etwas nördlich der heutigen
Staatsgrenze. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Grenzgebiet
immer wieder von feindlichen Heeren heimgesucht (Böhmenkönig Ottokar,
Hussiten, Ungarnkönig Mathias Corvinus). 1645 belagerten die Schweden
vergeblich die Burg. Nach der Niederwerfung des Bauernaufstandes 1597
hatte man den Anführer Andreas Schrembser vermutlich in der Burg
Karlstein festgesetzt, bevor er in Waidhofen gevierteilt wurde. Nach
dem Ersten Weltkrieg (1919/20) war der ungarische Revolutionär Bela Kun
hier interniert.
Die Pfarren Obergrünbach und Münchreith waren anfangs Vikariate der
Mutterpfarre Raabs und wurden 1560 selbständig. Infolge der Reformation
war Münchreith von 1621 bis 1810 eine Filiale von Obergrünbach. Die
Schloßkapelle in Karlstein besteht seit dem 16. Jhdt. 1898-1899 wurde
im Markt die Filialkirche errichtet. 1680 nennen die Kirchenmatriken
erstmals einen „Horologen" (Uhrmacher). Die Uhrenerzeugung erreichte um
1840 ihren Höhepunkt. Damals wurden von 285 Beschäftigten jährlich
140.000 Uhren erzeugt. Aus der Uhren-Hausindustrie entwickelte sich die
heutige feinmechanische Industrie, deren Betriebe ihre Erzeugnisse
größtenteils exportieren. Die alte Tradition führte 1874 zur Gründung
der einzigen Uhrmacher-Fachschule Österreichs, die heute als
Bundesfachschule auch Abteilungen für Mikromechanik und Elektronik
führt. Als Zentrum des „Horologenlandes" wird Karlstein 1732 bzw. 1784
als „Markt" genannt. Seit der Gemeindezusammenlegung 1967-71 umfaßt die
Marktgemeinde Karlstein folgende Orte: Obergrünbach, Thuma, Thures,
Hohenwarth, Münchreith, Göpfritzschlag, Griesbach, Wertenau, Schlader,
Goschenreith, Eggersdorf und Karlstein. 1978 gründete Pfarrer Karl
Rauscher den Verein FREUNDE DER HEILKRÄUTER, der zu einer Bewegung im
ganzen deutschsprachigen Raum geworden ist. Im Paracelsushaus wirkt der
bekannte „Kräuterpfarrer" Hermann-Josef Weidinger.

Kräuterpfarrer-Zentrum - Ein
reiches Angebot wartet auf Sie: Kräutertees, Liköre, Kosmetika, g’sunde
Naturprodukte, der Kräutergarten, Kräuterwanderungen und vor allem eine
kompetente Beratung durch ein freundliches Team! In der Weidinger-
Ausstellung können Sie den Meister der Naturheilkunde in Bild und Ton
erleben.

Hermann-Josef WEIDINGER (1918–2004): Waldviertler Bauernkind, Missionar
in China, Seelsorger, Volksbildner und schließlich Kräuterpfarrer. Mit
seinen Vorträgen landauf, landab, in den Medien und mit seinen Büchern
erreichte er tausende Menschen, denen er den Gebrauch der Heilkräuter,
die Liebe zur Natur und die Ehrfurcht vor dem Leben ans Herz legte.

Der in ganz Österreich bekannte Kräuterpfarrer Hermann-Josef Weidinger
(+ 2004) hatte in Karlstein seine Wirkungsstätte. Sein Werk wird nun
von Kräuterpfarrer Benedikt und einem engagierten Team erfolgreich
weitergeführt. Träger des Ganzen ist der Verein Freunde der Heilkräuter
mit rund 12.000 Mitgliedern weltweit. Im Naturladen findet man ein
reichhaltiges Angebot an Kräutertees, Likören, Salben nach Weidingers
Rezepten sowie viele andere gesunde Sachen und schöne Dinge für Körper
und Seele.

Kräuterpfarrer Benedikt, Prämonstratenser aus dem Waldviertler Stift
Geras, beschränkt sich nicht auf die Vermittlung heilkundlichen Wissens
aus der „Apotheke Gottes”. Für die langjährige rechte Hand des
legendären Kräuterpfarrers Weidinger sind die Heilkräuter ein Zeichen
für die Sympathie Gottes mit den Menschen, ein „Lächeln des Schöpfers”.

Ein Besuch im Kräutergarten mit den Aromaschalen darf nicht fehlen,
ebenso ein besinnliches Verweilen in der
Weidinger-Gedächtnis-Ausstellung, um anschließend in der Teestube bei
einem gemütlichen Plauscherl im Kräuterduft-Ambiente Tee, Kaffee,
Mehlspeisen, Eis oder ein Gläschen „Frohes Gemüt“ zu genießen.

Der idyllischer Kräutergarten wurde liebevoll bepflanzt und wird von
der Mitarbeiterin sorgfältig gehegt und gepflegt. Er ist Lehrpfad und
Schaugarten zugleich. Die Kräuter sind sinnvoll in Themenbereiche
angeordnet und beschriftet. Man kann sie in Ruhe studieren und
genießen. Der Kräutergarten möchte ein kleines Abbild sein von dem, was
man in der Natur findet. Mittendrin der Stein als ruhender Pol auf dem
der Kräuterpfarrer oft gesessen ist.
Frischeerlebnis mit Kräuterduft - Eine völlig neuartige Anlage mit 4
Aromabehältern aus Edelstahl mit Zerstäuberdüsen sorgt seit dem Sommer
2022 im Garten des Kräuterpfarrer-Zentrums für neue Dufterlebnisse. Die
Schalen geben aus Düsen einen angenehmen Aromanebel ab. Diese Anlage
soll auch einen Beitrag zum Klimawandel leisten und Erfrischung an
heißen Sommertagen für Besucher und Besucherinnen bieten. Diese 4
Aromaschalen plante und produzierte die in der Region beheimatete Firma
Sonderanlagenbau Arnhof aus Eggern.
Die Aromaschalen sind witterungsbedingt nur in den Sommermonaten in Betrieb.

Zahlreiche Besucher aus ganz Österreich, einzeln oder in Reisegruppen,
nützen die Gelegenheit, hier Gesundheit zu „tanken“ (auch mit
„geistiger Nahrung“) — oder bei Kräuterwanderungen, Seminaren und
anderen Veranstaltungen tiefer in die Welt der Heilkräuter
„hineinzuriechen“. Viele nehmen als Mitglieder besondere Vorteile in
Anspruch und bleiben über die beliebte Zeitschrift „Ringelblume“ stets
auf dem Laufenden.

Das Uhrenmuseum in Karlstein
gibt einen Einblick in das Uhrmacherhandwerk und in die Uhrentechnik.
Bewundern Sie rund 200 Exponate, unter anderem Modelle von Hemmungen,
Schlagwerke und ewige Kalender, Präzisionspendeluhren sowie
Konstruktionszeichnungen und ein Passageinstrument zur Zeitbestimmung.

Seit 14. Juli 2003 ist das Uhrenmuseum in den Räumlichkeiten des
aufgelassenen Gendarmeriepostens Karlstein für Besucher geöffnet. An
die 200 Exponate sind im Karlsteiner Uhrenmuseum zu bewundern. In einer
"lebenden Werkstätte" werden Uhren repariert und kleine Serien von
Präzisionspendeluhren, Planetarien, Tischuhren und Armbanduhren in
Handarbeit hergestellt. Zu sehen sind auch Modelle über Hemmungen,
Schlagwerke und ewige Kalender, Werkzeuge, Messgeräte und Maschinen.

Das Uhrenmuseum an der Hauptstraße gibt Ihnen einen Einblick in das
Uhrmacherhandwerk und seine besondere Bedeutung für Karlstein. An die
200 Exponate sind im Uhrenmuseum zu bewundern. Sie sehen Maschinen und
Werkzeuge, verschiedene Modelle, Regulatoren und Konstruktionen, ein
Passageinstrument zur Zeitbestimmung sowie Rechenmaschinen,
Konstruktionszeichnungen und natürlich Uhren.

Die hölzernen Schwarzwälder Uhren aus Karlstein wurden über Hausierer
in der ganzen Monarchie vertrieben. Zur Blütezeit um 1840 wurden
jährlich bis zu 140.000 Uhren erzeugt. Im Zuge von Fabriksgründungen im
späten 19. Jahrhundert wurde auch in der Burg 1880 eine Uhrenfabrik
eingerichtet. An die alte Tradition erinnern noch etliche Fabriksbauten
sowie die 1874 gegründete einzige Uhrmacher-Fachschule Österreichs.

Die Geschichte der Karlsteiner Uhrmacherei: Da die Landwirtschaft im
Waldviertel, bedingt durch den kargen Boden und das raue Klima, immer
etwas ärmlich war, suchte die Bevölkerung nach einem Nebenerwerb, den
sie hauptsächlich in der Weberei fand. Für viele Orte blieb die
Textilindustrie bestimmend ("Bandlkramerlandl"), diese erlitt gegen
Ende des 20. Jahrhunderts einen Niedergang. Hingegen hatte sich in und
um Karlstein die Uhrmacherei entwickelt, der dieser kleine Landstrich
den Namen "Horologenland" verdankt.

Die ersten "Horologen" (um 1730)
Um die Thronfolge seiner Tochter Maria Theresia zu sichern, opferte
Kaiser Karl VI. den Engländern zuliebe die Ostindische
Handelsgesellschaft. Die Folge war der Bankrott von Graf Mallenthein,
dem "Vater des Bandlkramerlandls" in Groß Siegharts, und damit
verbunden der Niedergang der Baumwollspinnerei in dieser Gegend.
Eine glückliche Fügung wollte es, dass gerade zu dieser Zeit - um 1730
- ein Einwanderer aus dem Böhmerwald namens Pfeiffer hierher kam. In
Münchreith versuchte er sein Glück mit den Kenntnissen der
Uhrenerzeugung, die er sich in seiner Heimat angeeignet hatte. Er fand
Mitarbeiter, denen er sein Wissen weitergab. Bald darauf finden wir in
Karlstein und Umgebung die Berufsbezeichnung "Horologicus", ein
vornehmes Wort für Uhrmacher.

Es wurden einfache Wanduhren aus Holz erzeugt, die Räder aus
Birnenholz, das man in Leinöl kochte. Sie hatten nur den Stundenzeiger
und eine Gehzeit von 12 Stunden. Die Hemmung besaß erst einen
querliegenden Holzunruhebalken (Schwengel), der später durch die runde
Unruh und erst gegen 1830 durch das Pendel ersetzt wurde, das im
Schwarzwald schon um 1740 in Verwendung stand. Die Räder wurden von
Hand geteilt und zurecht gefeilt, bis es einem Uhrmacher gelang, zum
Schneiden der Zähne ein Werkzeug mit zwei parallel laufenden Fräsen zu
konstruieren. Die eigentliche Schneidemaschine lernten die Karlsteiner
später von einem durchreisenden Uhrmacher kennen.
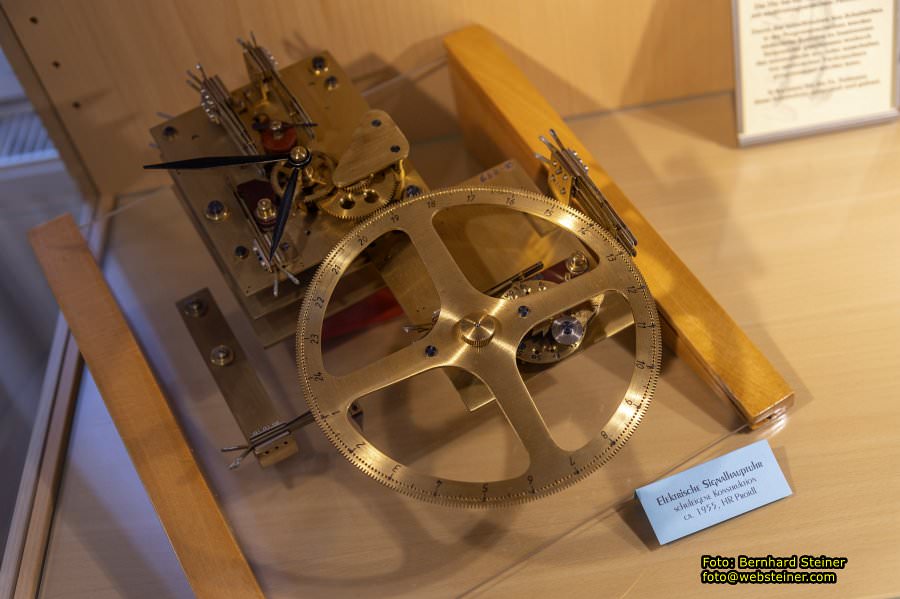
Curt Dietzschold
1852 in Dresden geboren und am 5.5.1922 in Karlstein a.d.Th. gestorben
war Dipl.Ing., wandte sich aber bald der Uhrmacherei zu. In der
Glashütte/Sa unterhielt er eine Werkstatt für den Bau von
Rechenmaschinen, feinmechanischen Apparaten und Präzisionspendeluhren.
Er konstruierte auch außergewöhnliche Uhren und Apparate. Auf Vorschlag
von Moritz Grossmann wurde er 1879 zum Direktor der österreichischen
Uhrmacherschule in Karlstein a.d. Thaya ernannt. Die arg
heruntergewirtschaftete Schule gestaltete Dietzschold zu einer
vollwertigen Fachlehranstalt um. In der Schule, die aus einem Lehrer
und 3 Schülern bestand, wurde zu
dieser Zeit vor allem für die heimische Uhrenindustrie gearbeitet.
Dietzschold und sein von ihm berufener Lehrkörper begründeten den guten
Ruf der Karlsteiner Schule und die gute Verbindung zur Uhrenstadt
Glashütte/Sachsen.
Er verfaßte, teilweise erst nach seiner Erblindung im Jahre 1906, zahlreiche Fachbücher, darunter die folgenden:
„Die Turmuhren mit Einschluß der Kunstuhren", „Die Verzahnung und die
Berechnung der Uhrwerke", „Abriß der Getriebelehre mit besonderer
Anwendung auf die Uhrmacherei und Feinmechanik", „Vorlagen für das
Uhrmachergewerbe", als Ergänzung zu Sauniers „Lehrbuch der Uhrmacherei
in Theorie und Praxis" den Teil „Die Räderuhr und „Cornelius Nepos der
Uhrmacher".
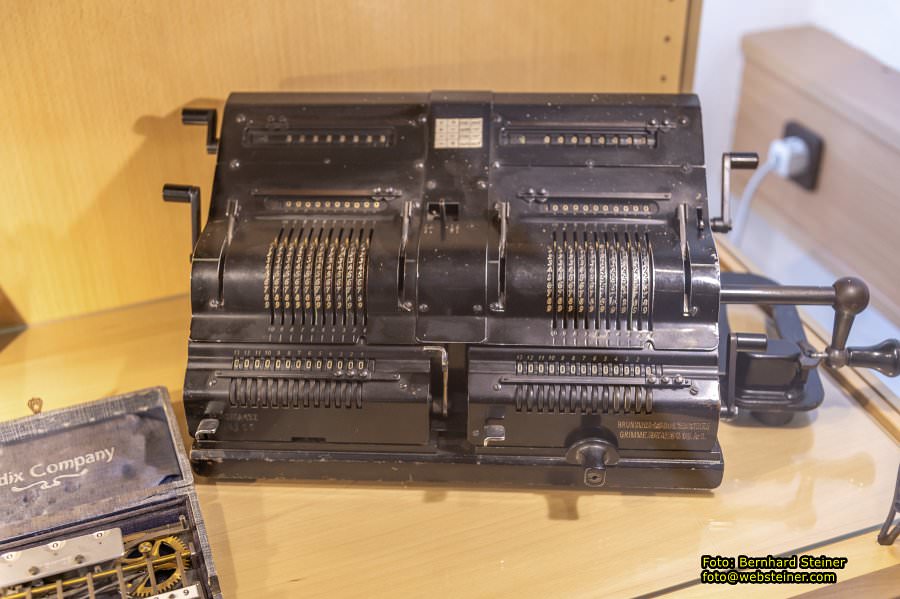
Arithmometre / Arithmometer - Curt Dietzschold beschäftigte sich in
Glashütte mit der Konstruktion und dem Bau von Rechenmaschinen.
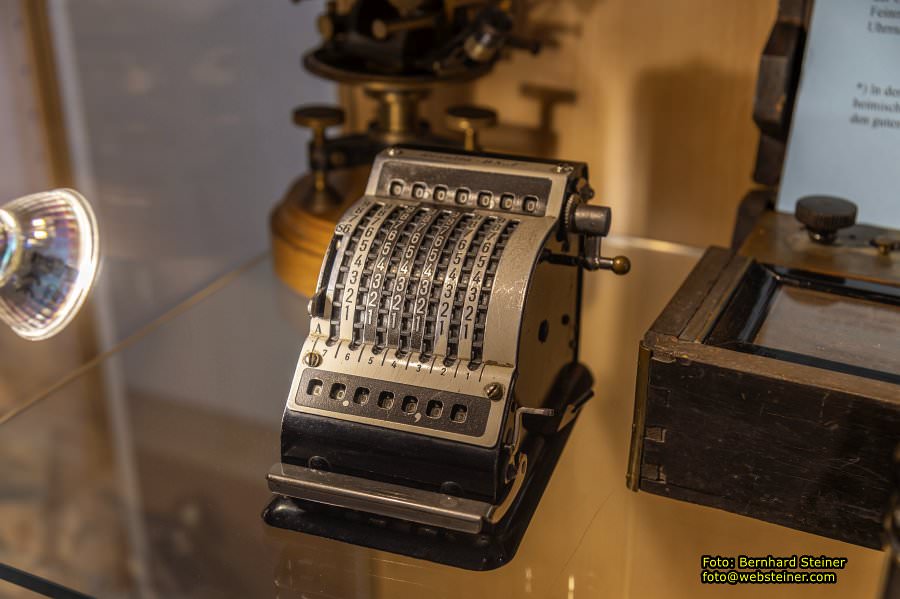
Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich allmählich eine
respektable Hausindustrie. In den 100 Jahren seit 1730 hatte sich in
Karlstein die Häuserzahl von 60 auf 120 verdoppelt. Etwa 100 Familien
(600 Personen) waren mit der Holzuhrenerzeugung beschäftigt; in
Karlstein allein waren es 285 Personen, mehr als diese in den
umliegenden Dörfern bis Groß-Siegharts.

Jährlich wurden etwa 140.000 Uhren hergestellt. Aber nicht nur die
Quantität, auch die Qualität hatte sich im Lauf der Zeit gehoben. Man
ging von dem querliegenden Unruhbalken zum Pendel, von Glasglocken zu
metallenen, von Holztrieben zu Drahttrieben, von Holzrädern zu
Messingrädern über. Hatte man früher Teile wie Messingräder aus
Südmähren (Zlabings) bezogen, so wurden diese nun hier selbst erzeugt.
Es hatte sich ein Spezialistentum entwickelt. Neben den eigentlichen
Uhrmachern gab es Gestellmacher, Zifferblattmacher und -maler,
Tonfedererzeuger, Gießer und Werkzeugmacher. Man brauchte Zangen,
Ahlen, Zirkel, Hämmer, Drehmesser und Stichel, Schraubstöcke, Drehbänke
und Räderschneidzeuge.

Die am häufigsten erzeugten Wanduhren waren die 12-stündigen Holzuhren
mit Tonfedern und Glockenschlag, mit Schnur oder Ketten. Daneben gab es
Viertel- und Repetieruhren mit anfänglich liegendem, später stehendem
Windfang, Uhren mit Weckwerk sowie Kuckucksuhren.

Der Vertrieb der Uhren hat sich etwa so abgespielt: 12 bis 20 Uhren
wurden auf einer Buckelkraxen verpackt und zu Fuß, meist im Winter,
nach der Art der Hausierer abgesetzt. Der Preis lag dabei zwischen 6
und 15 Gulden. War die mitgenommene Ware verkauft, wurden den
Hausierern an bestimmte Orte Uhren nachgeschickt. So zogen die Händler
nach Wien, in die österreichischen Länder, nach Mähren und Schlesien.
Kisten mit etwa 40 bis 60 Uhren wurden an Geschäftshäuser nach Brünn
und Olmütz verschickt. Über Ungarn gelangten die Hausierer bis in die
Balkanländer.

Das Jahr 1848 war zwar für die Bauern ein positiver Markstein, für die
Uhrmacher brachte diese Zeit aber einen Niedergang. In der
Hochkonjunktur hatte sich eine gewisse Sorglosigkeit eingestellt. Die
Uhrmacher im "Horologenlandl" waren stehen geblieben und hatten
verlernt, die Produkte zu verfeinern und mit der Entwicklung Schritt zu
halten. Während die Monarchie durch die Revolution von 1848 und die
folgenden Kriegsjahre wirtschaftlich geschwächt war, kam nun eine
übermächtige Konkurrenz aus dem Schwarzwald hinzu, mit welcher die
Karlsteiner weder in der Qualität noch im Preis mithalten konnten.
Die Uhren dieser Zeit verlangten trotz ihrer Einfachheit einen sehr
hohen Arbeitsaufwand. Messingräder, Zapfen und Triebwerke mussten in
die Holzwellen eingebaut werden. Eine Uhrmacherfamilie konnte
wöchentlich bis zu 10 Uhren bauen, dazu musste die meist vielköpfige
Familie täglich mehr als 10 Stunden arbeiten und erreichte dabei nur
einen Verdienst von ca. 1 Gulden.

Diese Versuche zur Belebung des Absatzes blieben leider erfolglos. Von
1854 bis 1866 sank die Zahl der im Uhrmachergewerbe Beschäftigten von
81 auf 32 (in Karlstein allein von 40 auf 18), das Steueraufkommen von
162 auf 69 Gulden; der Jahresabsatz betrug nur mehr 10.000 Uhren. In
ihrer Not wandten sich die Karlsteiner in einem Gesuch um Unterstützung
an die Niederösterreichische Statthalterei sowie direkt an den Kaiser.
Daraufhin kam 1867 der Regierungsbeauftragte Ritter von Dorn nach
Karlstein und erstattete der Regierung einen Bericht, worin er die
Schaffung einer Musterwerkstätte vorschlug. Durch die Uneinigkeit der
Interessenten und die Wirren einer politisch unruhigen Zeit verstrichen
6 Jahre, bis es 1873 endlich gelang, eine Lehrwerkstätte zu errichten.
1874 wurde diese in eine Fachschule für Uhrenindustrie umgewandelt und
in einem neuen Gebäude (an der Stelle des heutigen Internates)
untergebracht.

Curt Dietzschold - der "Vater" der Fachschule
Für die Fachschule begann nach den anfänglichen Schwierigkeiten 1879
der Aufschwung mit der Bestellung des Diplom-Maschineningenieurs Curt
Dietzschold zum Direktor. Er stammte aus Dresden und brachte reiche
Erfahrung auf dem Gebiete des Präzisionsuhrenbaues mit, die er in
Glashütte (Sachsen), dem Mekka der deutschen Uhrmacherkunst, gesammelt
hatte. Er war ein Pionier und anerkannter Fachmann für mechanische
Rechenmaschinen. In Karlstein organisierte er die dreijährige
Fachschule neu und schuf das Konzept für den Fachunterricht. Er schrieb
Bücher, die auf die deutschen Uhrmacherschulen großen Einfluss hatten,
und sein Lehrplan hatte in allen deutschsprachigen Uhrmacherschulen
Gültigkeit.

Seine Persönlichkeit und seine Beziehungen zur Uhrenwirtschaft zogen
weitere tüchtige Männer nach Karlstein: den Nürnberger Werkmeister Paul
Hellmuth, Johann Triska und Reinhold Pilz aus Wien sowie den ehemaligen
Direktor der Genfer Uhrmacherfachschule Oskar Enzmann. 1881 stand der
Lehrplan in seinen Grundzügen fest. Man unterrichtete wöchentlich mehr
als 60 Stunden, davon 50 in der Werkstätte. Die Schüler mussten selbst
die Bestandteile für ihre Uhren herstellen, auch Lagersteine drehen und
polieren usw. Obwohl abends beim Licht der Petroleumlampe gearbeitet
werden musste, wurden Spitzenleistungen an Präzision erbracht.

Die Schülerzahl stieg sehr rasch und erreichte 1886 die Zahl 54. Etwa
die Hälfte davon kam aus Niederösterreich, der Rest verteilte sich auf
die Kronländer der Monarchie von Schlesien bis Dalmatien (die
Karlsteiner Schule war die einzige in Österreich-Ungarn), einzelne
Schüler kamen aus der Schweiz, aus Deutschland und sogar aus Russland.
20 Schüler waren Söhne von Uhrmachern. Die Schule fand internationale
Anerkennung. Fachprominenz aus Paris und Budapest kam nach Karlstein.
Im Jahr 1900 wurde ein Linienschiffsfähnrich der kk. Marine zum Studium
der Behandlung von Seechronometern nach Karlstein abkommandiert.
Bereits 1894 arbeiteten Karlsteiner Absolventen in London, Paris,
Hamburg, Leipzig, München, in der Schweiz und in Ungarn.

Dietzschold leitete die Schule von 1879 bis 1903. Sein Haus in
Karlstein war das erste am linken Thayaufer (heutiges Haus Philipp). Ab
1900 vertrat den bereits Erkrankten und Erblindeten sein langjähriger
Weggefährte Oskar Enzmann. Dietzschold starb 1922 in Krems.
Nachfolger wurde Prof. Alois Irk,
der selbst diese Schule besucht hatte und hier Lehrer war. Er feilte
das von Dietzschold vorgegebene Konzept des Fachunterrichtes weiter
aus. Für die Lehrlinge der hiesigen Betriebe wurde eine
Fortbildungsschule eingerichtet, die von 6 bis 7 Schülern besucht
wurde. 1912 etablierte sich an der Schule die
Meisterprüfungskommission. Im gleichen Jahr wurde Irk beim Deutschen
Uhrmachertag in Eisenach zum Vorsitzenden des Ausstellungsausschusses
gewählt.

Irk war auf Ordnung und Disziplin bedacht. Die Schüler wohnten
durchwegs in Privatquartieren, soweit sie nicht aus der näheren
Umgebung kamen. Die Privatunterkünfte wurden vom Lehrkörper
stichprobenweise kontrolliert, damit die Schüler ihre Lernstunden und
die Nachtruhe einhielten. Sonntag war gemeinsamer Kirchgang nach
Münchreith. Der Direktor und die definitiven Lehrer waren dabei in
ihrer Uniform zu sehen und trugen den Degen. Nach dem Gottesdienst traf
man sich für den Rest des Vormittags zum zusätzlichen Unterricht. 1913
wurde die Schule baulich erweitert, auch der Längstrakt wurde
aufgestockt. In dieser Form blieb das Gebäude an der Sieghartser Straße
bis zum Neubau des Internates 1983.
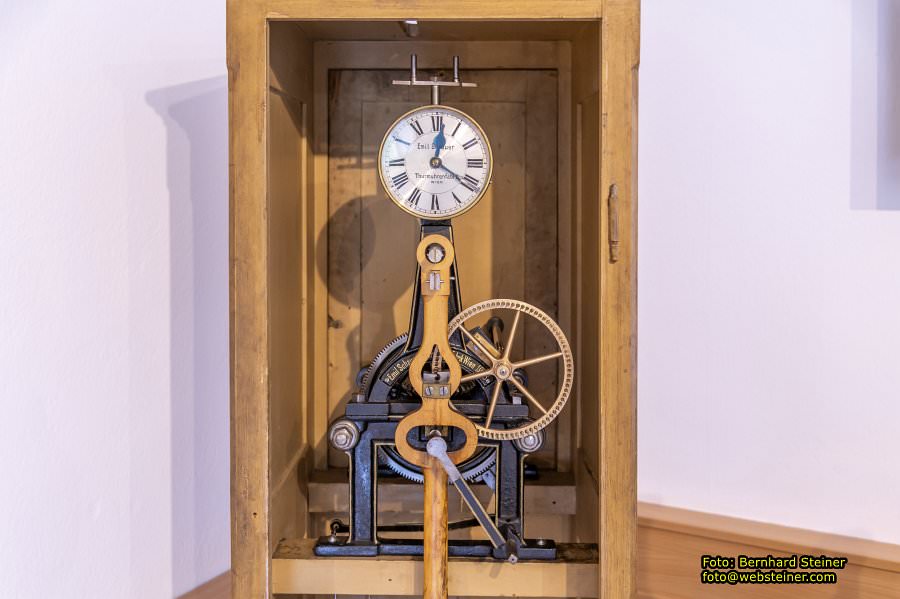
Regulator mit Schwerkrafthemmung, Gangdauer: 1 Monat, Curt Dietzschold Dir 1879-1903
elektro-mechanischer Sekundenregulator mit elektromagnetischem Selbstaufzug ohne Gangreserve
RIEFLER-Schichtungspendel, gestürzte RIEFLER-Federkrafthemmung luftdichten Glaszylinder, Alois Irk Dir 1905-1925

Nachdem 1914 die Vorbereitungen für das 40-jährige Bestandsjubiläum der
Schule schon angelaufen waren fiel dieses dem Attentat von Sarajewo zum
Opfer. Dafür wurde 1923 die 50-Jahr-Feier festlich begangen. Ein Jahr
später besuchten Bundespräsident Harnisch und Landeshauptmann Buresch
die Schule, und 1929 kam ein Generalmajor aus Berlin als Vertreter der
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.
Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 intensivierten
sich die Kontakte zu den deutschen Uhrenzentren. Aus Glashütte in
Sachsen, wo bereits Dietzschold gearbeitet hatte und wo sich die
bedeutende deutsche Uhrmacherschule befand, kam Walter Lange, Sohn
eines berühmten Uhrenfabrikanten, als Schüler nach Karlstein. So konnte
das Know-how, das Dietzschold einst nach Karlstein gebracht hatte,
zurückgegeben werden. Der Kontakt zu Glashütte und Lange ist bis in die
Gegenwart aufrecht.

Durch den Untergang der Donaumonarchie waren große Absatzmärkte
verloren gegangen, so dass nun ein starker Rückgang der Uhrenerzeugung
zu verzeichnen war. Statt 150 Uhrenarbeitern konnten jetzt nur etwa 70
beschäftigt werden die Erzeugung sank auf ein Drittel der
Vorkriegsmenge. Die Weltwirtschaftskrise tat ein Übriges.
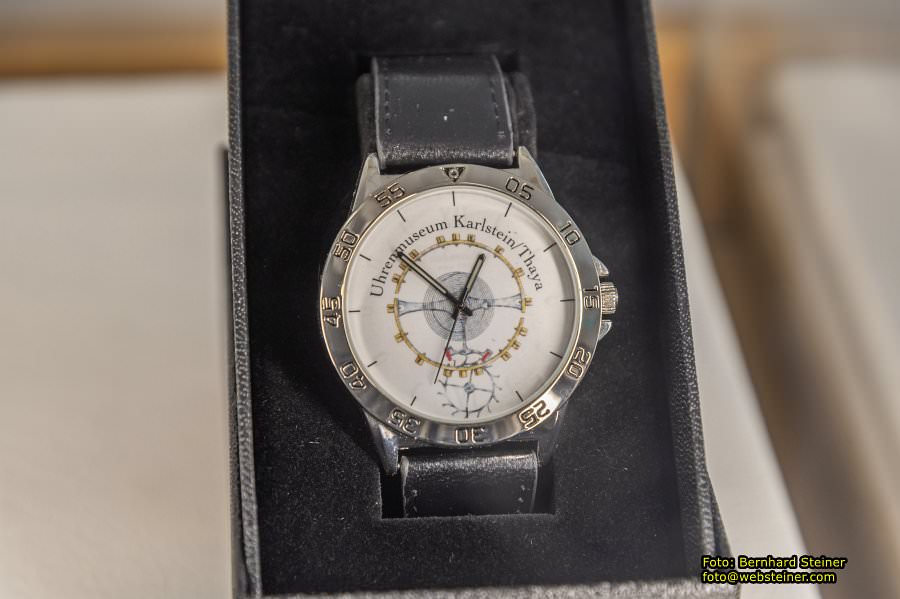

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: