web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Franzensburg
Schlosspark Laxenburg, April 2023
Geschichte und Gartenkunst erleben, spüren und
genießen – dafür steht der Schlosspark Laxenburg. Freizeiterlebnisse
ganz nach Ihrem Geschmack in atemberaubender Kulisse. Das und vieles
mehr erwartet Sie im größten Landschaftsgarten Österreichs. Begeben Sie
sich auf die Spuren der Habsburgerdynastie. Die Schlösser von Laxenburg
befinden sich in der Gemeinde Laxenburg in Niederösterreich etwa sechs
Kilometer südlich der Landesgrenze zum Bundesland Wien. Im großen
Schlosspark befinden sich das Alte Schloss, der Blaue Hof (bzw. das
neue Schloss) sowie die Franzensburg.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Laxenburg steht in der Gemeinde
Laxenburg im Bezirk Mödling in Niederösterreich. Sie ist dem Fest der
Kreuzerhöhung geweiht und gehört zum Dekanat Mödling im Vikariat Unter
dem Wienerwald der Erzdiözese Wien.

Die Gewölbemalereien in Langhaus und Chor aus der Erbauungszeit stammen
von Adam Obermüller (nach einem Entwurf von Johann Michael Rottmayr ?)
und wurden 1931 wieder freigelegt. Die Stuckplastik unter dem
Kuppelgesims stammt von Hieronymus Alfieri (um 1700). Der Hochaltar
wurde um 1784 nach einem Entwurf von Johann Ferdinand Hetzendorf von
Hohenberg errichtet. Die spätbarocke Kanzel hat Johann Baptist Straub
1730/32 geschaffen. Die Orgel hat Franz Ullmann 1864 in das alte
Gehäuse (1782), wo das Positiv noch von Johann Friedrich Ferstl stammt,
neu gebaut.

Die Kapitelle der Pilaster zeigen den klassischen Akanthus
(Distelblätter), der in Voluten (Schnecken) endet. Im Gegensatz zur
üblichen Form sind die Voluten hier nach oben gerollt (wie in der
Dörflkirche in Vöcklabruck), ein Hinweis auf C. A. Carlone.
Rechter Seitenaltar mit Altarbild „Madonna unter den Säulen". Es wird
in der Literatur ausschließlich in Zusammenhang mit „Geistlichen
Blumenstilleben" behandelt und in der Funktion des Erzherzogs Leopold
Wilhelm als Sammler. Beides erfasst nur einen Teil der damit
verbundenen Fragen, wie die zu Füssen der Madonna niedergelegten Waffen
und die im Hintergrund gezeigte Schlacht beweisen. Leopold Wilhelm
(1614-1662) war der jüngere Bruder Kaiser Ferdinands III. und wurde für
die kirchliche Laufbahn bestimmt. Parallel dazu wurde er auch oftmals
zum militärischen Befehlshaber ernannt. Ab 1647 war er Statthalter in
den Niederlanden und wurde da sofort in die Kriege mit Frankreich und
Spanien verwickelt. Die Einnahme von Gravelingen 1652 war einer der
wenigen militärischen Erfolge dieses Krieges. Darauf geht
wahrscheinlich der Auftrag für dieses Gemälde zurück. Der Erzherzog
legt der Madonna die Waffen zu Füßen; die Schlacht von Gravelingen ist
nur im Hintergrund zu sehen. Bald darauf legte er sein Amt nieder und
kam mit seiner umfangreichen Kunstsammlung nach Wien zurück.
Als Maler sind Daniel Seghers, Jan Davidsz de Heem, Paul de Vos,
Cornelis de Vos und David Teniers überliefert. Bei der Übertragung aus
der Wiener-Gemäldegalerie in die Laxenburger Kirche wurde das Bild zur
Einpassung in den vorhandenen Altaraufbau oben beschnitten. Das Motto
„Si Deus pro nobis, quis contra nos?" (Wenn Gott für uns ist, wer ist
dann gegen uns? Röm 8, 31) blieb erhalten.

Linker Seitenaltar mit dem Altarbild „Geburt Christi" von Ludwig Kohl,
das auf Befehl Maria Theresias 1773 kopiert wurde. (Gegenstück in der
Augustinerkirche in Wien).
14 Kreuzwegbilder nach den berühmten Gemälden von Josef Führich.
Vorlage war die älteste Version dieser Serie von 1834 für die
Stationskapellen am St. Lorenzberg in Prag, die 1836 im Druck
verbreitet wurden.

Als optischer Ausgleich gegen den hohen Raum wirkt das stark
vorspringende den ganzen Raum umlaufende Gesims, das allen Krümmungen
der Wand und allen Wandvorlagen folgt. Es kann darauf hingewiesen
werden, dass viele Bauteile sphärisch gewölbt sind.
Die künstlerische Ausstattung ist von höchster Qualität; Stuckfiguren
und Stuckdekor (Blumenkränze, Fruchtgehänge) stammen im Wesentlichen
von Hieronymus Alfieri. Als Maler wird der Franziskaner Frater Adam
Obermüller genannt, dem der Tod den Pinsel aus der Hand nahm"; also war
1713 die Ausmalung noch nicht beendet. Für das zentrale Bild des
himmlischen Jerusalems" gibt es eine Skizze von Johann Michael Rottmayr
in Privatbesitz, das als Vorbild in Frage kommt.

Das Patrozinium,, Kreuzerhöhung" ist seit dem Frühchristentum bekannt
und wurde vielleicht durch die Reise Friedrichs III. ins Hl. Land 1436
wieder in Erinnerung gebracht. Er wurde in Jerusalem zum Ritter vom
Heiligen Grab geschlagen. Friedrich III. stiftet in Nürnberg in der
Lorenzkirche das „Kaiserfenster" mit Szenen aus der Kreuzlegende (um
1477); er wird hier als Kaiser Konstantin, und seine Gattin Eleonore
als Kaiserin Helena dargestellt. Das Patrozinium „Kreuzerhöhung" für
die Pfarrkirche Laxenburg wurde wohl früh übernommen, aber erst in
Zusammenhang mit der Abhaltung des Markttages am Fest „Crucis" 1516 ist
es schriftlich belegt.
Das Thema „Kreuzerhöhung" ist zunächst durch den Hochaltar vorgegeben;
es wird aber auch durch Zitate aus den Tagesgebeten zu diesem Fest
bestätigt. Die Erstellung des Bau- und Bildprogramms auf der Grundlage
von Zitaten aus der Hl. Schrift (Gegenüberstellung von Altem und Neuen
Testament) ist wohl nur in gemeinsamer Absprache von Bauherr und
Baumeister möglich. Ähnliches gilt für die Bilder der dreizehn Apostel
in den Stichkappen, die von den Fenstern ausgehen. Diese Stichkappen
unterhalb der Kuppel mit den zwischen ihnen liegenden Verstrebungen
müssen schon beim Kirchenbau geplant worden sein.

Kanzel von Johann Baptist
Straub (1704-1784) entstand zwischen 1726 und 1730 neben anderen
Arbeiten für die Schwarzspanierkirche in Wien. Sie wurde 1783 auf ein
Angebot des General-Hofbauamtes hin durch die Pfarre angekauft. Der
Kanzelkorb hat drei deutlich markierte Ansichtsseiten, die seitlich
durch die Propheten Isaias und Jeremias und in der Mitte durch zwei
Engelkinder mit einem Tempietto (=kleiner Tempel) mit drei Fenstern und
drei Türen als Symbol der Ekklesia betont sind. Dazwischen sind zwei
Reliefs, - der Prophet Jonas predigt in Ninive, (Vgl. Jona, 3) und
Johannes der Täufer predigt in der Wüste (vgl. Mt 3, 1-12). Auch der
Schalldeckel ist dreifach geschweift, die Bekrönungsfigur ist der
Evangelist Johannes „Gott ist das Wort", dazwischen ist der Engel des
göttlichen Gerichtes mit dem zweischneidigen Schwert. Das Hauptthema
des Bildschmuckes ist das Wort Gottes.

Hochaltar: Tabernakel mit Cherubim und Muttergottes (Kopie nach
Gnadenbild von Alt-Ötting) unter Baldachin, mit anbetenden Engeln

„Christus als Sieger über Tod und Hölle" von Michael Nußbaumer
(1785-1861). Die Statuengruppe geht auf eine Auftragsarbeit der Wiener
Akademie der bildenden Kunst zurück. Anlässlich der Ausschreibung des
sogenannten Kaiserpreises 1819 erhielt das von Nußbaumer vorgelegte
Modell den ersten Preis. Dazu gehörte die Bewilligung zur Ausführung in
mit Carrara-Marmor verbunden einem Stipendium zum langjährigen
Aufenthalt in Rom. Dort arbeitete er von 1823 bis 1831 an der
Ausführung des Entwurfes. Das vollendete Werk kam nach Wien und wurde
vom Kaiser für das Alte Schloss erworben, wo es in der Kapelle 1839
aufgestellt wurde. Von dort kam es 1931 in die Pfarrkirche.


Orgelpositiv 1762 (oder 1782) von Johann Ferstel, aus der Kapelle des Alten Schlosses.
Orgel von Josef Ullmann 1864 mit älteren Teilen; Orgelkasten um 1782.

Kuppelfresko „Das Himmlische Jerusalem“ mit dem Hinweis des Engels auf die geheime Offenbarung.

Stephanuskapelle - Abraham und Isaak, Kreuzigung, Steinigung des Stephanus

Der Ort Laxenburg ist heute vor allem durch sein Schloss Laxenburg
(Blauer Hof), das neben Schönbrunn der wichtigste Sommersitz der
Habsburger war, und den daran angrenzenden weitläufigen Schlosspark mit
der zu besichtigenden Franzensburg bekannt.
Blauer Hof
Ursprünglich ein alter Freihof mit oft wechselnden Besitzern. Um 1715
Umbauten durch Lucas von Hildebrandt für den Reichsvizekanzler
Friedrich Carl Schönborn. Ab 1762 als neues kaiserliches Lustschloss
für Maria Theresia durch Niccolo Pacassi und Johann Ferdinand von
Hohenberg umgebaut. Hier wurde 1858 Kronprinz Rudolf geboren.

Abbildung der Kirchenfassade, oberhalb des Tores Statue Christus
Salvator, oben Kaiserin Helena und Kaiser Heraklius, die das Kreuz
Christi gefunden haben.
Pfarrkirche
Patrozinium zur Kreuzerhöhung. Zentralbau mit anliegenden Konchen, alle
Bauteile mit sphärischen Gewölben. Erbaut 1693 bis 1699 als Neubau und
Vergrößerung der alten Pfarrkirche. Nach stilistischen Vergleichen wohl
von Carlo Antonio Carlone. Fassade und Turm 1724 bis 1739 wohl von
Mathias Steinl.

Die Franzensburg ist eine
Wasserburg in Laxenburg im Bezirk Mödling in Niederösterreich, die
zwischen 1801 und 1836 im Stil einer alten Burg errichtet wurde. Der
Name rührt vom damaligen Kaiser Franz II. bzw. I., der sie mitten im
Schlosspark als Museum neben den bereits bestehenden Schlössern von
Laxenburg auf einer künstlichen Insel im Parkteich errichten ließ.
Mit 25 Hektar Gesamtfläche hat der Schlossteich
im Schlosspark Laxenburg eine beindruckende Dimension erhalten. Der
Zufluss wird seit über 200 Jahren durch die Triesting im benachbarten
Münchendorf hergestellt. Über den Laxenburger Kanal und den
Forstmeister Kanal werden bis zu 500 Liter Wasser pro Sekunde in den
Schlossteich geleitet. In 24 Stunden erreichen somit bis zu 43.200.000
Liter den Schlossteich. Das entspricht einer Füllmenge von rund 308.570
Badewannen. Das Inhaltsvolumen des Schlossteichs ist nicht minder
beeindruckend. Bei einer durchschnittlichen Wassertiefe von etwa 1
Meter ergibt das ein Gesamtvolumen von rund 250.000.000 Liter Wasser,
das entspricht etwa einer Menge von 1.785.700 Badewannen. Das Wasser
verlässt nach etwa 5-6 Tagen wieder den Schlossteich bei den Schleusen
hinter der Marianneninsel und macht sich wieder auf den Weg in Richtung
Triesting bei den „Kaiser Ablässen" in Achau.

1806 wurde eine Fähre eingerichtet, die über den Teich vom Festland zur
Insel mit der Franzensburg führt. Diese ist bis heute, konzessioniert
als Schifffahrtsunternehmen, in Betrieb. Im Winter wird sie durch eine
Holzbrücke ersetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Insel
ganzjährig über eine Steinbrücke erreichbar.
Die Burg und der umgebende Schlossteich sind eingebettet in einen rund
250 ha großen Schlosspark, der im späten 18. Jahrhundert im Stil
englischer Landschaftsgärten gestaltet wurde. Darin befinden sich
Wälder, Wiesen, mehrere Kanäle, ein Turnierplatz, der Concordiatempel
und weitere Bauwerke wie die „Rittersäule“, eine Marmorbüste des
Kaisers und das Lusthaus.

Die Burg wurde von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg in zwei
Teilen (Ritterburg und Knappenburg) geplant und war von Anfang an als
Museum gedacht. Mit ihrem Rückgriff auf mittelalterliche Bauformen gilt
die Franzensburg als Meilenstein auf dem Weg zum Historismus.
Bestandteile der im Zuge des Josephinismus abgetragenen Pfarrkirche in
Heiligenkreuz wurden dazu verwendet. Auch Versatzstücke älterer Bauten
sind in der Burg integriert, vor allem die Rekonstruktion der
Klosterneuburger Capella Speciosa, des ersten gotisch beeinflussten
Bauwerks im Donauraum.

Der Bau der Burg fiel in die Zeit, in der die Ziegelherstellung südlich
von Wien ihren Anfang nahm. Da ihm der Preis des einzelnen Ziegels zu
hoch schien, kaufte Kaiser Franz kurzerhand die Ziegeleien in Vösendorf
und zusätzlich noch das Schloss Vösendorf.

Beim Durchgang durch das Museum in der Burganlage können verschiedene Räume besucht werden:
Waffensaal
In diesem Raum sind an der Decke die Schilde mit den Wappen der 44 österreichischen Länder und Provinzen montiert.
Habsburgersaal
In der Franzensburg befindet sich im Habsburgersaal eine Hälfte
der Kaiserstandbilder von Paul Strudel (die andere Hälfte steht in der
Hofbibliothek). Im Lothringersaal sind Gemälde der späteren Kaiser um
ein Kupelwieser-Porträt Franz I. gruppiert, sie stammen unter anderem
von Ferdinand Georg Waldmüller und Friedrich von Amerling.
Erster Empfangssaal
Zweiter Empfangssaal
Luisenzimmer
Im „Luisenzimmer“ sind die Raumdecke, die beiden Türverkleidungen
sowie die Türen aus der Burg Rappottenstein aus der Zeit um 1600 zu
sehen.
Speisesaal
Lothringersaal



Namensgeber der Franzensburg ist Kaiser Franz I., der dieses Gebäude
als „Schatzhaus Österreich" von 1798-1801 errichten ließ. Die
Franzensburg ist ein Hauptwerk des romantischen Klassizismus im Stile
der Neogotik. Bis in das Jahr 1835 wurden noch prächtige Erweiterungen
vorgenommen, wie etwa der äußere Burghof mit seiner imaginären
Ahnengalerie im Form von Sandsteinbüsten. Im Inneren befinden sich
durch Ankäufe und Geschenke prunkvolle Inventare wie Kassettendecken,
Marmorböden, Ledertapeten und vieles mehr.







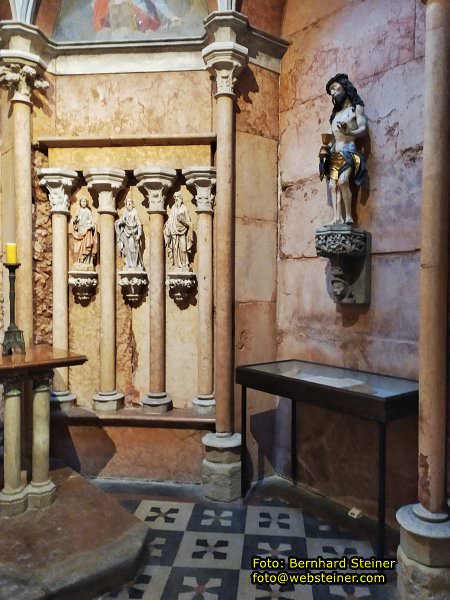
Die Franzensburg - „kleines Schatzhaus Österreich"
Die majestätische Krönung des Schlossparks ist die Franzensburg, eines
der bedeutendsten Bauwerke des Neoklassizismus. Kaiser Franz I. hat
dieses Gartenhaus im altdeutschen Stile von 1798-1801 errichten lassen.
Von Anfang an als Museum und Repräsentationsfläche konzipiert befindet
sich im Inneren eine reiche Ausstattung an Holzkassettendecken,
Ledertapeten, Marmorböden und zahlreichem Mobiliar. Erleben Sie bei
einem Rundgang in der Franzensburg Glanz und Schicksal der
Habsburgerdynastie. Die Franzensburg ist mit dem österreichischen
Museumsgütesiegel ausgezeichnet.






Schlosspark
Seit dem Mittelalter um das Schloss angelegt. Seit etwa 1785 als
weitläufiger Englischer Landschaftsgarten mit zahlreichen
Staffagegebäuden wie „Franzensburg", „Grünes Lusthaus" oder
„Turnierplatz". Einer der bedeutendsten historischen Landschaftsgärten
Europas, reich an wertvollen Gehölzen, Baumgruppen und künstlichen
Gewässerflächen.


Bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie war Laxenburg ein
wesentlicher Aufenthaltsort der Habsburger. Diese Tradition begann
schon mit Kaiser Karl VI. So wurde von Maria Theresia auch eine lange,
durchgehende Allee von Schönbrunn, nämlich auf der Trasse der heutigen
Schönbrunner Allee, nach Laxenburg errichtet. Die heute nicht mehr
existierende Laxenburger Bahn wurde ebenfalls eigens für den
kaiserlichen Hof zwischen der Südbahn in Mödling und Laxenburg
errichtet.
Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth verbrachten 1854 ihre
Flitterwochen in Laxenburg. Auch zwei ihrer vier Kinder – Gisela
(1856–1932) und Kronprinz Rudolf (1858–1889) – wurden auf Schloss
Laxenburg geboren. Der letzte Kaiser, Karl I., residierte 1917/1918
fast ständig in Laxenburg, weil er damit das von ihm persönlich
geleitete Armeeoberkommando in Baden bei Wien ganz in der Nähe hatte
und politische Kontakte pflegen konnte, ohne dauernd von Wienern
beobachtet zu werden.

Kunst und Antiquitäten im Schloss Laxenburg
Bei der 75. NÖ Kunst- und Antiquitätenmesse trifft Tradition auf
Moderne. Es lädt die größte und bedeutendste Kunst- und
Antiquitätenmesse Niederösterreichs wieder in die prunkvollen Säle des
Schlosses Laxenburg. Bereits zum 75. Mal präsentieren die renommierten
Kunstexperten aus Österreich und Deutschland die absoluten Höhepunkte
ihres Portfolios. Gezeigt werden Kunstschätze von der Gotik bis zur
Gegenwart - Museales für versierte Sammler wie auch Exponate für ein
jüngeres Publikum. In der Art Lounge mit Blick in den prachtvollen
Laxenburger Park sind einzigartige Skulpturen von Mario Dalpra,
Hans-Peter Profunser, Sebastian Rainer und Maximilian Verhas zu
bestaunen.


JUDITH WAGNER - Men, Bronze, 3-teilig, 2/3, 2016, 280 x 220 x 180 cm
MARIO DALPRA - The Optimist, Bronze patiniert, Unikat, 2021, 190 x 110 x 70 cm


Der Schlosspark Laxenburg mit seiner riesigen Parklandschaft, dem Alten
Schloss, dem Blauen Hof und der romantischen Franzensburg gilt als
eines der bedeutendsten Denkmäler historischer Gartenkunst des 18. und
19. Jahrhunderts mit einer Geschichte bis weit in das 13. Jahrhundert
zurück. Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, genannt „Sisi",
haben einst ihre Flitterwochen hier verbracht, Kronprinz Rudolf hat in
Laxenburg das Licht der Welt erblickt. Von 1306-1918 sommerliche Jagd-
und Privatresidenz der kaiserlichen Familie Habsburg ist der
Schlosspark heute ein äußerst beliebtes Ausflugsziel vor den Toren
Wiens und größter Landschaftspark Österreichs!


Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: