web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Leipzig
Mitteldeutschland, September 2024
Leipzig ist eine kreisfreie Stadt sowie mit über
600.000 Einwohnern die einwohnerreichste Stadt im Freistaat Sachsen.
Sie belegte 2023 in der Liste der Großstädte in Deutschland den achten
Rang. Für Mitteldeutschland ist sie ein historisches Zentrum der
Wirtschaft, des Handels und Verkehrs, der Verwaltung, Kultur und
Bildung sowie gegenwärtig ein Zentrum für die „Kreativszene“ und eine
wichtige Messe- und Universitätsstadt.
Leipzig Hauptbahnhof ist der
zentrale Personenbahnhof in Leipzig und gehört mit täglich rund 135.000
Reisenden und Besuchern zu den 15 meistfrequentierten Fernbahnhöfen der
Deutschen Bahn. Der Eisenbahnknoten und Kopfbahnhof verfügt über 23
Bahnsteiggleise. Das Bahnhofsgebäude mit den Bahnsteighallen ist mit
einer überdachten Grundfläche von 83.640 Quadratmetern das flächenmäßig
größte Europas. Die Fassade des Empfangsgebäudes zur Innenstadt ist 298
Meter breit.

Stein Palmen in Leipzig, Deutschland, ist eine einzigartige
Kunstinstallation, die natürliche und urbane Ästhetik verbindet. Dieser
Ort im lebhaften Stadtteil Plagwitz zeigt hoch aufragende Stahlpalmen,
die einen starken Kontrast vor der Kulisse der Industriearchitektur
bilden. Diese Gegenüberstellung bietet eine surreale, fotogene Szene,
die mit der Widerstandsfähigkeit der Natur in städtischen Umgebungen
spielt.
Steinpalmen als Innnehof der Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB)

Evangelisch Reformierte Kirche zu Leipzig am Goerdelerring

Auf dem Richard-Wagner-Platz fanden die Pusteblumen-Brunnen vom
Leipziger Bildhauer Harry Müller ihr neues Zuhause. Bereits 1972 wurden
sie von ihm erbaut und machen mit ihrem originellen Aussehen ihrem
Namen alle Ehre. Der Richard-Wagner-Platz (bis 1913 Theaterplatz) ist
ein Platz in Leipzig im Nordwesten der Innenstadt. Der Platz ist nach
dem Komponisten Richard Wagner (1813–1883) benannt, dessen Geburtshaus
sich in der Nähe befand. Auf der freien Fläche des Platzes wurden die
drei von Harry Müller gestalteten Kunstbrunnen aufgestellt, die bis
1999 auf dem ehemaligen Sachsenplatz standen und von den Leipzigern
„Pusteblumen“ genannt
Pusteblumen-Brunnen am Richard-Wagner-Platz

Das erste Barockgebäude in der Stadt Leipzig war das Romanushaus Katharinenstraße Ecke Brühl. Den Namen erhielt das Haus nach seinem Bauherrn Franz Conrad Romanus.
Im Alter von dreißig Jahren trat er das Amt des Bürgermeisters an und
erwarb sich ein Ansehen bei der Leipziger Bevölkerung. Er setzte sich
konsequent für die kommunale Infrastruktur der Stadt ein. Das
Romanushaus umfasst vier Grundstücke, hat ein sockelartiges Erdgeschoß
und drei verschieden hohe Stockwerke. Das Dach ist als Mansardendach
konzipiert. Das Eckhaus wird durch einen zweistöckigen Erker und einer
abgeschrägten Ecke mit darin befindlichen Fenstern verbunden. Typisch
barocke Schmuckelemente, wie Girlanden, sind an den Eingängen und
Fenstern zu sehen.

Hermes-Statue an der Ecke des Romanus-Hauses - Im Erdgeschoß an der
abgeschrägten Seite des Gebäudes befindet sich zwischen zwei Säulen
eine Nische. Hier ist eine Hermesstatue aufgestellt. Hermes ist in der
griechischen Mythologie der Schutzgott der Reisenden und Kaufleute,
aber auch der Gott der Diebe und Kunsthändler.

Marktplatz Leipzig - Umgestalteter öffentlicher Platz, der für seinen Weihnachtsmarkt und mittelalterliche Architektur bekannt ist.
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus - Museum mit Kunstwerken, Handwerken, Dokumenten und anderen Artefakten der Leipziger Geschichte und Kultur.

Barfußgäßchen 11

Zum Arabischen Coffe Baum - Traditionshaus mit bürgerlich-rustikalen
Gaststuben, gehobenem Restaurant, Drei-Länder-Café und Kaffeemuseum.

Commerzbank, Thomaskirchhof 22

Seit 1212, dem Gründungsjahr von Thomaskirche, Thomanerchor und
Thomasschule, singt der Thomanerchor regelmäßig in der Thomaskirche.
Berühmtester Thomaskantor war Johann Sebastian Bach. Seine
Matthäus-Passion und viele Kantaten wurden hier uraufgeführt. An den
Orgeln der Thomaskirche spielten Wolfgang Amadeus Mozart, Felix
Mendelssohn Bartholdy und Max Reger.
Thomaskirche - Gotische Kirche, in der J. S. Bach als Kantor wirkte, mit regelmäßigen Auftritten des berühmten Knabenchors.

Auf einem 3,20 m hohen Muschelkalksteinsockel, der vom Leipziger
Architekten und Stadtbaurat Otto Wilhelm Scharenberg entworfen wurde
und den Namen des Geehrten trägt, befindet sich eine 2,45 m hohe
Bronzestatue, die vom Leipziger Bildhauer Carl Seffner entworfen und
von der Firma Noack & Brückner gegossen wurde. Sie zeigt den
Thomaskantor Johann Sebastian Bach vor einer (allerdings völlig
ahistorisch im Jugendstil geschmückten) Orgel stehend, die rechte Hand,
eine Notenrolle umfassend, zum Dirigieren erhoben, die linke Hand
gerade vom Orgelmanual gelöst – also mitten in der Arbeit. Der lange
Staatsrock ist offen; die Jacke nur unvollständig zugeknöpft.
Neues Bach-Denkmal im Thomaskirchhof

Am 28. Juli 1750 stirbt Johann Sebastian Bach in Leipzig und wird am
31. Juli auf dem Spitalfriedhof der Johanniskirche bestattet. Im Zuge
der Bach-Renaissance im 19. Jahrhundert beginnt sich eine breite
Öffentlichkeit für die Gebeine Bachs zu interessieren. 1894 wird der
Professor für Anatomie, Wilhelm His, damit beauftragt, aus exhumierten
Knochen die Gebeine Bachs zu identifizieren. Sein abschließendes Urteil
lautet: „Die Annahme, daß die am 22. October 1894 an der
Johannis-Kirche in einem eichenen Sarg aufgefundenen Gebeine eines
älteren Mannes die Gebeine von Johann Sebastian Bach seien, ist im
hohen Grade wahrscheinlich." Die Gebeine werden am 16. Juli 1900 in
einem Steinsarkophag in der Krypta der Johanniskirche beigesetzt.
Bei der Bombardierung Leipzigs 1943 wird die Johanniskirche zerstört.
Nach dem 2. Weltkrieg verständigen sich Stadt, Landeskirche und
Thomaskirche darauf, die Gebeine Bachs in seine alte Wirkungsstätte zu
überführen. Der Rat der Stadt stimmt dem zu. Maurermeister Malecki
erhält den Auftrag, die Gebeine Johann Sebastian Bachs in die
Thomaskirche zu überführen. Da er die Gebeine in einem unverschlossenen
Zinksarg in der Krypta der zerstörten Johanniskirche vorfindet,
entscheidet sich Malecki am 28. Juli 1949 (Bachs Todestag) für eine
sofortige Überführung. Er fährt den offenen Zinksarg auf seinem
Handkarren quer durch die Stadt zur Thomaskirche. Er soll die Gebeine
Bachs Superintendent Heinrich Schumann mit den Worten übergeben haben:
„Tach, Herr Superintendent, ich bring'n Bach'n." Die Gebeine werden in
der Nordsakristei notdürftig aufgebahrt und bis zur Schließung des
Sargdeckels am 13.8.1949 Tag und Nacht von Gemeindemitgliedern bewacht.
1950 wird die Grabstätte nach einem Entwurf des Architekten Fritz
Bornmüller in den Stufen zum Chorraum errichtet und am 28. Juli 1950,
dem 200. Todestag Bachs, feierlich eingeweiht. Im Zuge der
Innenrenovierung 1961-1964 wird die Ruhestätte unter Verwendung der
Bronzeplatte von 1950 in den Chorraum verlegt.
Neugotischer Altar, Hochaltar 1888/89 - Nach Entwurf von Constantin Lipsius erbaut, 2016 wieder im Chorraum der Thomaskirche aufgestellt
Bachgrab - Ruhestätte von Johann Sebastian Bach, seit 1950
Bach-Grab - 1949 wurden die Gebeine von Johann Sebastian Bach von der
im Krieg zerstörten Johanniskirche in die Thomaskirche überführt. 1950
wurde zum 200. Todestag des großen Thomaskantors im Chorraum das
Bach-Grab errichtet.

Neugotischer Jesus-Altar - Der
architektonische Entwurf des neugotischen Jesus-Altars wurde 1888
angefertigt und stammt von Constantin Lipsius (1832-1894). Er stand bis
zur Innenrenovierung 1964 in der Kirche und wurde im Jahr 2016 nach der
Überführung des Pauliner-Altars in die Neue Universitätskirche St.
Pauli (2014) wieder aufgestellt.

Von 1723 bis 1750 war Johann Sebastian Bach als Director Musices
Lipsiensis und Cantor zu St. Thomae der ranghöchste Musiker Leipzigs.
Damals wie heute war der Thomaskantor Angestellter der Stadt. Zu Bachs
Amtspflichten gehörte die musikalische Ausbildung der Knaben an der
Thomasschule sowie die musikalische Gestaltung der Gottesdienste an den
beiden Hauptkirchen St. Thomas und St. Nicolai sowie an der Neukirche
(später Matthäi-Kirche genannt) und an der Petri-Kirche. Bach lebte mit
seiner zweiten Frau Anna Magdalena Bach geb. Wilcke in der alten
Thomasschule am Thomaskirchhof. Hier ging er zur Beichte und zum
Abendmahl.
In den ersten Leipziger Amtsjahren hat Bach wöchentlich neue Kantaten,
insgesamt etwa 150 Kompositionen, geschaffen. Aus späterer Zeit sind
weitere 30 nachweisbar. Hinzu kommen Passionsmusiken, Kantaten zur
jährlichen Feier des Ratwechsels sowie zahlreiche Kompositionen für
besondere Anlässe. Bach hat in den Leipziger Kirchen auch Werke fremder
Komponisten aufgeführt, die er teilweise überarbeitete. In der
Thomaskirche wurden unter anderem die Matthäus-Passion (1727) und die
verschollene Markus-Passion (1731) erstmals aufgeführt, in der
Nikolaikirche die Johannes-Passion (1724) und das Weihnachts-Oratorium
(1734/35).
Die Inneneinrichtung der Thomaskirche aus der Bach-Zeit ist fast
vollständig beseitigt worden. Das gilt auch für die beiden Orgeln. Die
große Orgel stammte in ihren ältesten Teilen aus dem Jahre 1511. Die
kleinere Orgel ging sogar auf das Jahr 1489 zurück. Neben verschiedenen
Abendmahlsgeräten und den Superintendentenbildern im Altar-raum stammen
das Löbelt-Kreuz und der Taufstein aus der Bach-Zeit.

Der Taufstein aus Marmor und Alabaster wurde in den Jahren 1614/1615
geschaffen und steht in der Mitte des Chorraums zwischen Altar und
Bach-Grab. Der Deckel ging im vorigen Jahrhundert verloren. An diesem
Taufstein wurden elf Kinder Johann Sebastian Bachs aus seiner Ehe mit
Anna Magdalena Bach getauft.
Taufstein von Franz Döteber 1614/15, Marmor und Alabaster

Kreuzrippengewölbe und Sauer-Orgel
Das prachtvolle Gewölbe des gotischen Langhauses verleiht der
Thomaskirche eine eindrucksvolle Akustik. Das farbige Rippensystem
bringt in seinem Kontrast zum getünchten Putz die dynamischen
Kräftebahnen der Hallenkirche sehr plastisch zum Ausdruck. Die
Sauer-Orgel auf der westlichen Chorempore baute Wilhelm Sauer im Jahre
1889. Ursprünglich hatte das romantische Instrument 63 klingende
Stimmen, 1908 wurde diese Zahl auf 88 erhöht. 2005 wurde sie
restauriert und auf ihren Originalzustand aus dem Jahr 1908
zurückgeführt.

Bach-Fenster - Das Fenster
wurde 1885 vermutlich von Carl de Bouché gestaltet und ist Teil der
Memorialfenster auf der Südseite des gotischen Langhauses.

Bach-Orgel - Im Zuge der
vollständigen Restaurierung der Thomaskirche wurde auf der Nordempore
gegenüber dem Bach-Fenster die Bach-Orgel von Gerald Woehl (Marburg)
gebaut. Ihr Klangbild orientiert sich am Stil des mitteldeutschen
Orgelbaus des 18. Jahrhunderts. Die Bach-Orgel verfügt über 61 Register
auf 4 Manualen und Pedal, Zimbelstern und ein Glockenspiel. Das Gehäuse
zitiert die Orgel der 1968 gesprengten Universitätskirche. Diese hat
Johann Sebastian Bach 1717 begutachtet und auf ihr hat er immer wieder
gespielt.

Die dreischiffige Hallenkirche hat eine Gesamtlänge von 76 m. Die Länge
des Hauptschiffs beträgt 50 m, die Breite 25 m und die Höhe 18 m. Der
Chor ist gegen das Langhaus leicht nach Norden abgewinkelt. Das Dach
hat einen ungewöhnlich steilen Neigungswinkel von 63° und ist damit
eines der steilsten Giebeldächer Deutschlands. Im Inneren verfügt es
über sieben Ebenen (Firsthöhe 45 m). Die Decke des Langhauses besteht
aus einem farblich abgesetzten Netzrippengewölbe.

Neben dem Altar ist ein kleiner musealer Bereich.


Mendelssohn-Portal - Während
der neugotischen Umgestaltung wurde die Thomaskirche Richtung Westen
geöffnet und das von Constantin Lipsius gestaltete Portal angesetzt.
Heute steht vor dem Portal auf dem Promenadenring das 1936 von den
Nazis zerstörte und 2008 rekonstruierte Mendelssohn-Denkmal. Aus Anlass
des 200. Geburtstages von Felix Mendelssohn am 3. Februar 2009 wurde
das Portal nach ihm benannt.

Das Mendelssohn-Denkmal in der
Nähe des als Mendelssohn-Portal bekannten Westportals der Thomaskirche
in Leipzig ehrt den Komponisten und ehemaligen Leipziger
Gewandhauskapellmeister sowie Gründer des Conservatoriums der Musik
Felix Mendelssohn Bartholdy.
Felix Mendelssohn Bartholdy steht als 2,8 Meter hohe bronzene
„Gründerzeit-Figur mit Toga“ auf einem gestuften Sockel aus Granit. Der
obere Sockelteil wurde aus rotem Meißner Granit gefertigt, die unteren
beiden Stufen bestehen aus grauem Granit. Die Gesamthöhe des Denkmals
beträgt 6,8 Meter. Mendelssohn hält in der linken Hand eine Notenrolle
und in der rechten, vor einem Notenpult stehend, einen Taktstock, ein
Hinweis darauf, dass er als erster Dirigent im modernen Sinne wirkte.
Zu Mendelssohns Füßen sitzt die Muse der Musik Euterpe auf den Stufen,
auf eine Lyra gestützt. An den Seiten gruppieren sich je zwei
musizierende Engel, die linken singend, die rechten auf Flöte und
Violine spielend. Der Sockel trägt vorn den Namen des Tondichters und
hinten die Inschrift „Edles nur künde die Sprache der Töne“. Auf der
linken Seite des Sockels symbolisiert eine Orgel in einem
Bronze-Medaillon die geistliche Musik; auf der rechten Seite stehen
Masken, eine Vase mit Tanzszene, Flöten und Schwert für die weltliche
Musik.

Neues Rathaus Stadt Leipzig - Monumentales Rathaus mit beeindruckendem Blick auf die Stadt von seinem 114,7 m hohen Turm.

Das Neue Rathaus in Leipzig ist seit 1905 der Sitz der Stadtverwaltung.
Es befindet sich an der südwestlichen Ecke des Innenstadtrings in
Sichtweite des Reichsgerichtsgebäudes, dem Sitz des
Bundesverwaltungsgerichtes. Der 114,7 Meter hohe Rathausturm gilt als
höchster in Deutschland und ist eines der Wahrzeichen der Stadt.

Das Gebäudeensemble aus Rathaus (Martin-Luther-Ring 4–6) und dem
dazugehörigen Stadthaus (Burgplatz 1) verzeichnet auf einer
Nettogrundfläche von ca. 65.870 m² insgesamt 1.708 abgeschlossene
Räume. Der seinerzeit größte Rathausneubau im Deutschen Reich ist auch
heute noch der größte Profanbau dieser Art weltweit.

Die Passage Petersbogen befindet sich im Einkaufszenturm Petersbogen

Fanshop 1. FC Lokomotive Leipzig in der Schloßgasse 6-8
Der 1. FC Lokomotive Leipzig, Verein für Bewegungsspiele e. V., kurz 1.
FC Lok oder Lok Leipzig, ist ein Fußballverein aus dem Leipziger
Stadtteil Probstheida. Der Verein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als
VfB Leipzig dreimal deutscher Fußballmeister. 1945 zwangsweise
aufgelöst, wurde an gleicher Spielstätte die Traditionslinie durch den
1. FC Lokomotive Leipzig erfolgreich fortgesetzt. Der Verein galt als
einer der erfolgreichsten Fußballvereine in der DDR.

Die Moritzbastei ist der
einzige erhaltene Teil der ehemaligen Stadtbefestigung der Stadt
Leipzig. Sie liegt am Kurt-Masur-Platz im Südosten der Leipziger
Innenstadt. Von 1979 bis 1993 wurde sie von der Universität Leipzig als
deren Studentenclub betrieben. Seit 1993 wird sie im Auftrag der
Stiftung Moritzbastei Leipzig durch eine GmbH als Kulturzentrum
bewirtschaftet.

Schiller-Denkmal - Das
Schillerdenkmal steht in der Lenné-Anlage, nahe der Schillerstraße in
der Innenstadt Leipzigs. Die Büste Friedrich Schillers auf der hohen
Stele zeigt sein Abbild. An der Stele lehnen zwei lebensgroße nackte
Figuren, die die Trauer und die Erhabenheit darstellen. Schiller schaut
mit hohlem, dämonisch anmutendem Blick nach Westen zur Deutschen Bank.
August Schmiemann aus Leipzig-Plagwitz war es, der nach dem Entwurf von
Johannes Hartmann den 4,5 Meter hohen Marmorblock bearbeitete und
gestaltete.

Das City-Hochhaus Leipzig steht am südwestlichen Rand des
Augustusplatzes in Leipzig. Das Hochhaus mit 34 Etagen ist ein
Wahrzeichen der Stadt und mit 142,5 Metern (Gesamthöhe mit
Antennenträger: 155 m) das höchste Gebäude Leipzigs. Aufgrund der drei
langen, leicht nach innen gewölbten Längsseiten bei einer überhöhten
Schmalseite kann die Form des Gebäudes aus Straßensicht als ein
aufgeschlagenes Buch interpretiert werden. Wegen seiner ursprünglichen
Nutzung durch die Universität Leipzig entstand im Volksmund der Name
Uniriese.
Das im Jahr 1972 als Sektionsgebäude der Universität errichtete
Hochhaus, wurde nach den Entwürfen des Architekten Herrmann Henselmann
gebaut, der unter anderem auch als Architekt des Berliner Fernsehturms
internationale Beachtung fand. In Form eines aufgeschlagenen Buches
wurde das weithin sichtbare Gebäude auch bald im Volksmund als
„Weisheitszahn“, „Uniriese“ oder auch „Steiler Zahn“ benannt.

Am besten lässt sich das wunderschöne Panorama von Leipzig auf der
Aussichtsplattform in der 31. Etage genießen. Blick auf die
Thomaskirche und am Thomaskirchhof.

Red Bull Arena - Fußballstadion, Heimspielstätte von RB Leipzig und regelmäßig Konzertort für internationale Künstler.

Russische Gedächtniskirche beim Friedenspark, dahinter das Völkerschlachtdenkmal

Leipzig Hauptbahnhof

Die größte und zugleich prachtvollste Brunnenanlage des Leipziger Stadtgebiets ist der Mendebrunnen.
Er befindet sich auf dem Augustusplatz vor dem (neuen) Gewandhaus
(♁Lage) und ist der einzig erhaltengebliebene Teil des alten
Platzensembles. Namensgeberin des Brunnens ist Marianne Pauline Mende
geb. Thieriot († 25. Januar 1881).

Der Mendebrunnen ist als eine Allegorie auf die Bedeutung des Wassers
für den Menschen zu verstehen. Die maritimen Darstellungen verkörpern
Gestalten der griechischen Mythologie: Gleich zweimal wird Triton, der
Sohn des Poseidon, mit menschlichem Oberkörper und doppelschwänzigem
Fischleib dargestellt. Die Tritonfiguren zügeln sich kraftvoll
aufbäumende Hippokampen, Fabelwesen halb Pferd, halb Fisch, was als
Beherrschung der Meeresgewalten durch den Menschen gedeutet werden
kann. Die Nereiden auf den Konsolen des fast 18 m hohen Obelisken
symbolisieren den Nutzen, den die Menschen aus dem Umgang mit dem Meer
ziehen.

Die Oper Leipzig ist ein
Drei-Sparten-Theater, bestehend aus der eigentlichen Oper, dem
Leipziger Ballett und der Musikalischen Komödie (Operette und Musical)
am Augustusplatz. Anfang 1868 eröffnete mit Goethes Iphigenie auf
Tauris das von Carl Ferdinand Langhans geschaffene Neue Theater.
Nachdem die Ruine des von Bomben zerstörten Baus abgetragen worden war,
wurde dort das Opernhaus gebaut und 1960 mit den Meistersingern von
Nürnberg eingeweiht.

Das Krochhochhaus in Leipzig
wurde in den Jahren 1927/1928 für die Privatbank Kroch jr. KGaA
errichtet und war das erste Hochhaus der Stadt. Der als Uhrturm
gestaltete und 43,2 m hohe Stahlbetonbau befindet sich an der Westseite
des Augustusplatzes (Goethestraße 2).
Herausragendes Merkmal des Hochhauses und damit Wahrzeichen des
Augustusplatzes ist das auf dem Dach befindliche Schlagwerk. Es besteht
aus drei Glocken, die von der Glockengießerei Schilling & Söhne in
Apolda gegossen wurden. Die Glocken werden von zwei 3,30 m großen
Glockenmännern – die damals als das größte Turmschlagwerk der Welt
galten – geschlagen. Die Glockenschlägerplastiken stammen von Joseph
Wackerle (1880–1959). Unterhalb der Glocken ist die lateinische
Inschrift OMNIA VINCIT LABOR (Alles überwindet [die] Arbeit)
angebracht. Darunter befindet sich die von zwei
Löwenreliefdarstellungen flankierte Anzeige der Mondphasen, welche die
gesamte Frontpartie des 12. Geschosses einnehmen, Fenster gibt es
deshalb im 12. Geschoss nur an der Gebäuderückseite. Das 11. Geschoss
besitzt auch nur zwei statt der in den anderen Etagen verwendeten 3
Fenster, zwischen denen sich eine Turmuhr mit einem Zifferblatt von
4,30 m Durchmesser befindet. Die Uhr wurde 1928 gefertigt von der
Bernhard Zachariä Thurmuhrenfabrik Leipzig, dem damals weltweit
führenden Produzenten von Turmuhren.

Völkerschlachtdenkmal ist ein 91 Meter hohes Denkmal der Völkerschlacht von 1813 mit Aussichtsplattform und historischem Museum. Davor befindet sich der See der Tränen.
Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig wurde 1898 bis 1913 unter der
Leitung von Bruno Schmitz im Monumentalstil errichtet. Es erinnert an
den entscheidenden 18. Oktober 1813 der Völkerschlacht bei Leipzig
während der Befreiungskriege. Das Monument stellt einen Turm dar, in
dem sich eine Ruhmeshalle und eine Krypta befinden. Mit einer Höhe von
rund 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas.

Vom 16. bis 19. Oktober 1813 fand vor den Toren der Stadt Leipzig die
sogenannte Völkerschlacht statt. Sie führte im Rahmen der
Befreiungskriege zu einer Niederlage Napoleons gegen die Truppen
Russlands, Österreichs, Preußens und Schwedens. In der Schlacht, die
bis zum Ersten Weltkrieg als die größte der Geschichte galt, kämpften
Deutsche auf beiden Seiten. Bereits am 18. Oktober 1813 war die
Völkerschlacht zugunsten der Verbündeten Preußen, Österreich, Russland,
Schweden und weiterer europäischer Staaten entschieden worden.
Die bildhauerischen Elemente des Völkerschlachtdenkmals entstanden
unter der Leitung von Christian Behrens und Franz Metzner. Sowohl
außerhalb als auch innerhalb besitzt das Denkmal einen reichen
Skulpturenschmuck. An der Außenwand des Kuppelbaus befinden sich zwölf
kolossale Freiheitswächter. Sie stellen Ritterfiguren dar, die ihre
Köpfe gesenkt haben und sich auf ihre Schwerter stützen. Am oberen Rand
des Turmbaus steht die Inschrift „18. OKTOBER 1813“, welche sich auf
den entscheidenden Tag der Völkerschlacht bezieht. Am oberen Rand der
Freitreppe steht die Inschrift „GOTT MIT UNS“, welche sich auf den
Schlachtruf der Preußen in den Befreiungskriegen bezieht.

Beim Bau des Völkerschlachtdenkmals und bei der Fertigung seiner
Monumentalfiguren ist der Granitporphyr als Beuchaer Werkstein bekannt
geworden. Für das Bauvorhaben wurden 26.500 Steinblöcke in Beucha
gewonnen, bearbeitet und nach Leipzig gebracht.
Von der Freitreppe aus gelangt der Besucher in den Innenraum, der sich
in die unterhalb gelegene Krypta und die oberhalb gelegene Ruhmeshalle
teilt. Die Krypta stellt das symbolische Grab der mehr als 120.000
Gefallenen der Völkerschlacht dar. Die acht Pfeiler der Krypta sind als
riesige Totenmasken ausgebildet, vor denen jeweils zwei monumentale
Totenwächter stehen. Sie stellen Ritterfiguren dar, die ihre Köpfe
gesenkt haben und sich auf ihre Schilde stützen. Darüber öffnet sich
als zentraler Gedenkraum die Ruhmeshalle mit vier kolossalen Tugenden
der Deutschen in den Befreiungskriegen: Volkskraft auf der Nordseite,
Opferbereitschaft auf der Ostseite, Tapferkeit auf der Südseite, und
Glaubensstärke auf der Westseite. Als Vorbilder der 9,5 Meter hohen
Statuen dienten dem Bildhauer Franz Metzner die altägyptischen
Memnonsäulen bei Theben. Die massiven Rundbögen zwischen den
Tugendfiguren sind mit bunten Glasfenstern und schweren Eisentüren
versehen, die der Ruhmeshalle den Anschein einer Kathedrale verleihen.
Totenwächter in der Krypta und Tugendfigur Volkeskraft in der Ruhmeshalle

Unmittelbar vor dem Völkerschlachtdenkmal befindet sich ein künstlich
angelegtes 162 × 79 Meter großes Wasserbecken, in dessen
Wasseroberfläche sich das Monument spiegelt. Die Umfassung des
Wasserbeckens ruht auf einer Pfahlgründung. Zu diesem Zweck entwickelte
Rudolf Wolle vorgefertigte Säulen aus Eisenbeton, die auch patentiert
wurden.
See der Tränen

Reiterfiguren innerhalb der Kuppel - Den Abschluss des Figurenprogramms bilden 324 Reiterfiguren an der Innenwand des Kuppelbaus.

Tugendfiguren in der Ruhmeshalle: Glaubensstärke und Volkeskraft

Mit 91 Metern Höhe ist es das höchste Denkmal Europas und eines der
bekannten Wahrzeichen Leipzigs. Es bildet eine weithin sichtbare
Landmarke mit markanter Silhouette, das bei klarer Luft vom 105
Kilometer entfernten Fichtelberg zu sehen ist. Die New Yorker
Freiheitsstatue ist zum Vergleich nur rund 2 Meter höher als das
Leipziger Völkerschlachtdenkmal.
Ausblick nach Süden auf Südfriedhof und Krematorium Leipzig, am Horizont das Kraftwerk Lippendorf

Napoleons Schreibtisch
Im Jahre 1801 ließ der Besitzer des Hôtel de Prusse am Leipziger
Roßplatz für einen Aufenthalt des russischen Zaren Alexander I. das für
diesen vorgesehene Zimmer angemessen ausstatten. Dazu gab er bei dem
Leipziger Tischlermeister Johann Jacob Petutschnigk unter anderem
diesen Schreibtisch in Auftrag. Er bildete das zentrale Objekt in der
fortan „Fürstenzimmer" genannten Suite. Die Nacht vom 18. auf den 19.
Oktober 1813 verbrachte Napoleon I. in diesem Zimmer, wo er sich mit
seinem Generalstabschef Berthier und dem französischen Außenminister
Maret über den Rückzug seiner Truppen in der bereits verlorenen
Völkerschlacht beriet. Die Vorstellung, dass Napoleon an diesem
Schreibtisch möglicherweise die letzten Befehle für die bis dahin
größte Feldschlacht der Menschheitsgeschichte ausfertigte, ist
faszinierend. Im Jahre 1921 wurde der Hotelbetrieb eingestellt, das
Inventar verkauft. Den Schreibtisch erwarb eine Leipziger Familie in
deren Besitz er sich bis heute befindet.
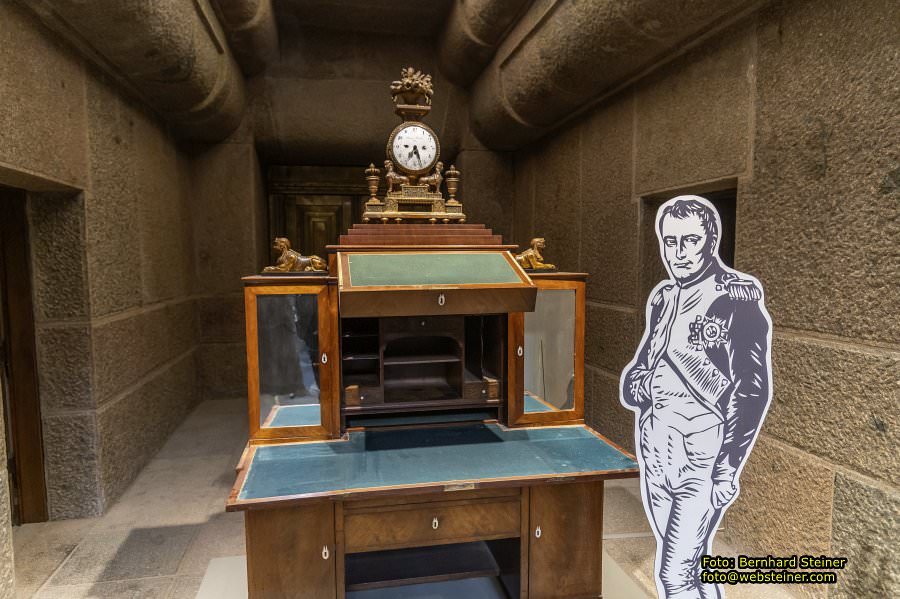
Fassade von Fischer-Art in der Karl-Liebknecht-Straße. Michael
Fischer-Art (* 13. März 1969 in Leipzig) ist ein deutscher Maler und
Bildhauer. In Anlehnung an den Sozialistischen Realismus bezeichnet
Fischer-Art seine Arbeiten als dem „Marktwirtschaftlichen Realismus“
zugehörig. In seiner Bildsprache bedient er sich satter Farben, großer
Flächen, einfacher Strukturen und comicartigen Muppets, wodurch ein
hoher Wiedererkennungswert entsteht.
Fischer-Art-Haus, Karl-Liebknecht-Straße 43, Leipzig, Deutschland

Der Bayerische Bahnhof in Leipzig liegt südöstlich der Leipziger
Altstadt südlich des Bayrischen Platzes. Der Bahnhof wurde 1842 von der
Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn-Compagnie in Betrieb genommen und galt
bis zu seiner Schließung im Jahr 2001 als der älteste in Betrieb
befindliche Kopfbahnhof Deutschlands (andere Quellen sprechen vom
ältesten noch erhaltenen Kopfbahnhof der Welt). Die Gleisanlagen wurden
im Rahmen der Bauarbeiten für den City-Tunnel Leipzig vollständig
abgebrochen.
Altes Bahnhofsgebäude des Sächsisch-Bayerischen Bahnhofs

An ihre Stelle trat eine unterirdische Station, die im Dezember 2013 in Betrieb genommen wurde.
Bayerischer Bahnhof, Rolltreppe der S-Bahn-Haltestelle

Der Reichshof ist ein
Geschäfts- und ehemaliges Messehaus in der Leipziger Innenstadt und das
Eckgebäude Reichsstraße 2/Ecke Grimmaische Straße. Die Ecke ist
abgeschrägt und trägt drei Ziergiebel. Der Eckbau wird gekrönt von
einer kupfergedeckten Kuppelkonstruktion mit einem Laternenaufbau. An
der Ecke weist der Eingang ein kleines bekröntes Kupferdach auf. Die
Dachschrägen tragen sieben bzw. drei Gauben mit Bogendach. Die durch
Lisenen und Simse gegliederten Fassaden weisen neobarocke
Schmuckelemente auf.

Alte Börse - Prächtiges Barockgebäude aus dem 17. Jahrhundert und ehemaliger Sitz der Leipziger Börse. Davor das Goethedenkmal.
Das Goethedenkmal in Leipzig
ist eine auf einem hohen Sockel stehende Bronzestatue auf dem
Naschmarkt vor der Alten Handelsbörse. Sie stellt Johann Wolfgang von
Goethe (1749–1832) mit Bezug auf seine fast dreijährige Studienzeit in
Leipzig als jungen Mann dar. Es wurde von Carl Seffner (1861–1932)
geschaffen. Die 2,65 Meter große Bronzestatue des jungen Goethe steht
auf einem 2,5 Meter hohen Sockel aus rotem Granit. Haltung, Untergrund
der Statue und das Rokokokostüm zeigen, dass der Student im Freien
lustwandelt.

Die Alte Börse am Naschmarkt
ist Leipzigs ältester Barockbau. 1678 von Leipziger Kaufleuten
errichtet, diente sie 200 Jahre lang als repräsentativer
Versammlungsort. Hier wurden Geschäfte abgeschlossen, Auktionen
abgehalten und Wechsel gehandelt. Heute wird die Alte Börse für
Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, Kongresse sowie
private und öffentliche Feste genutzt.

Riquethaus - Die Riquet &
Co. AG war ein Unternehmen für Herstellung und Vertrieb von Kakao,
Schokoladen, Pralinen und Bonbons in mit Sitz in Leipzig. 1888
eröffnete das Unternehmen einen Verkauf im Haus Goethestraße 6
gegenüber dem Neuen Theater. Um die Mietkosten dafür zu sparen, wurde
1908–1909 ein vom Architekten Paul Lange entworfenes eigenes Messe- und
Geschäftshaus auf dem Eckgrundstück Schuhmachergäßchen 1–3 /
Reichsstraße errichtet. Sein pagodenhafter Dachaufbau und die
außergewöhnliche Fassadengestaltung durch aufwändige farbige
Jugendstil-Mosaike mit werbendem Charakter lehnen sich an die
klassische chinesische Baukunst an. Der seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts zum zentralen Bildmotiv in Riquet-Werbeanzeigen gewordene
Elefant schmückt mit zwei kupfergetriebenen lebensgroßen Köpfen der
Tiere den Eingangsbereich des Geschäftshauses.

Passage Speck's Hof - Specks
Hof erstreckt sich über 82 Meter längs des Schuhmachergäßchens zwischen
Reichs- und Nikolaistraße, in denen das Gebäude Frontlängen von 40 bzw.
47 Metern besitzt. Nach Süden grenzt es an den Reichshof, das Hansahaus
und an den Nachkriegsneubau mit dem Fürstenerker.

GESCHICHTE - Der Speck's Hof im Zeitenwandel
Im Jahre 1815 erwarb Maximilian Speck von Sternburg das Eckhaus und gab
ihm den Namen „Speck's Hof". Es blieb 74 Jahre im Besitz der Familie.
Schon 1430 befand sich an der Adresse des heutigen Speck's Hof ein
großes Gebäude. Es diente als Wohnhaus, Brauhaus und Weinkeller in
einem. 1904-1906 wurde das HansaHaus erbaut. Im Jahre 1909 wurde der
Speck's Hof als Handelshaus mit 5000 m² Ausstellungsfläche eröffnet.
Die Erweiterung zur Nikolaistraße war 1912 abgeschlossen. Mit 10.000 m²
Ausstellungsfläche wurde der Speck's Hof zum größten Messehaus seiner
Zeit. 1928 entstanden üppig ausgestattete Lichthöfe, Passagen und
Treppenhäuser.
Das Erdgeschoss des Gebäudes durchziehen tonnengewölbte Passagengänge,
zum Teil noch mit geprägter Kupferdecke. Ein Gang verläuft von der
Reichs- zur Nikolaistraße mit einer Abzweigung ins Schuhmachergäßchen;
ein Zweig führt ins Hansahaus.

Die Gänge werden durch drei glasbedachte Lichthöfe unterbrochen, die im
Westen beginnend, mit A, B und C bezeichnet werden und Grundflächen
zwischen 40 und 50 m² besitzen. Ihre Wände sind künstlerisch gestaltet.
Details im Lichthof B - Moritz Götze schuf in moderner Tradition des
Art Brut, der Pop Art und des Comics und in Anlehnung an
mittelalterliche Bilderbögen eine Geschichte der Leipziger Messe.

Das Hansahaus in Leipzig ist ein in der Innenstadt gelegenes Büro- und
Geschäftshaus, dessen Geschichte eng mit der Leipziger Messe verbunden
ist. Das Hansahaus stellt in Verbindung mit Specks Hof einen Teil des
Leipziger Passagensystems dar.
Glasdach des Lichthofs

Das Gebäude in der Leipziger Ritterstraße 8–10, heute Geschwister-Scholl-Haus,
ist in den Jahren 1908–1910 als Sitz der ersten deutschen
Handelshochschule (gegründet 1896) auf einem der ältesten Grundstücke
der Universität Leipzig, dem Großen Fürstencolleg, errichtet worden. Am
20. Februar 1948 wurde in einer Feierstunde der Leipziger
Studentenschaft das Haus dem Andenken der Geschwister Sophie und Hans
Scholl (Angehörige der Widerstandsgruppe Weiße Rose, 1943 hingerichtet)
gewidmet und in der Portalnische der Schriftzug Geschwister-Scholl-Haus
angebracht.

Die Nikolaikirche (offiziell:
Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai) ist die älteste und größte Kirche
in der Innenstadt von Leipzig sowie neben der Thomaskirche die
bekannteste Kirche der Stadt. Der nach dem heiligen Nikolaus benannte
Sakralbau ist Hauptkirche der evangelisch-lutherischen
St.-Nikolai-Kirchengemeinde Leipzig. Die Umgestaltung und Ausstattung
des Innenraumes der Nikolaikirche stellt eine bedeutende Schöpfung des
Klassizismus dar.
Nikolaikirche Leipzig - Bedeutendes Architekturdenkmal, vom
französischen Klassizismus inspirierter Innenraum & Säulen in
Palmenform.

St. Nikolai - Evangelisch-Lutherische Stadt- und Pfarrkirche
Der Mut zu baulichen und konzeptionellen Veränderungen schuf eine
Kirche, an der die Stadt-, Kirchen-, Glaubens-und Kunstgeschichte von
Beginn an ablesbar wird: In Folge der Verleihung des Stadt- und
Marktrechtes an Leipzig im Jahr 1165 beschlossen die Bürger der Stadt
den Bau der Kirche, die dem Heiligen Nikolaus geweiht wurde. Der
Heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron der Handelsleute und Reisenden.
Noch heute erkennt man an der westlichen Fassade (Haupteingang) die
ursprünglich romanische Bauform mit Rundbögen und Doppelturmanlage. Aus
romanischer Zeit stammt auch das Kruzifix im Altarraum (um 1250).
Im Jahr 1525 war der Umbau der romanischen Basilika zu einer
spätgotischen Hallenkirche vollendet. Die sogenannte Lutherkanzel im
gotischen Stil aus dem Jahr 1521 befindet sich heute in der
Nordkapelle. Die Reformation wurde 1539/40 in Leipzig eingeführt, in
St. Nikolai durch Pfarrer Johannes Pfeffinger, den ersten
Superintendenten der Stadt. In den Jahren 1723-1750 sorgte Johann
Sebastian Bach für eine lebendige kirchenmusikalische Ausgestaltung der
Gottesdienste in St. Nikolai und St. Thomae. Seine Amtseinführung als
„Director musicae" fand am 30. Mai 1723 in St. Nikolai statt. Er war
gleichermaßen für beide Kirchen zuständig. Die im Jahr 1998
aufgestellte Bachstele in der Nähe des Eingangsbereichs erinnert an das
Wirken des Komponisten.

Orgel mit restauriertem Ladegast-Prospekt
Die heutige Orgel geht auf ein Instrument, das 1862 von dem Orgelbauer
Friedrich Ladegast (Weißenfels) mit mechanischen Trakturen und 83
Registern auf vier Manualen und Pedal erbaut wurde, zurück.

In der ältesten Leipziger Kirche führte Johann Sebastian Bach mit dem
Thomanerchor im wöchentlichen Wechsel mit der Thomaskirche seine
Kirchenmusik auf. Hier erklangen u. a. Kantaten und erstmals die
Johannes-Passion. Der Kirchenraum wurde um 1790 durch eine
klassizistische Neugestaltung grundlegend verändert. Die Ladegast-Orgel
von 1862 ist die größte Kirchenorgel in Sachsen. Mit mehr als 1400 Sitzplätzen gehört die Nikolaikirche zu den größten Kirchen Sachsens.

Neben dem Hauptaltar wurde 1982 für das erste Friedensgebet auf einem Ständer aus Metall ein einfaches Holzkreuz aufgestellt.

Aus der Barockzeit stammen Hauptturm (1730) und Portal (1759). Unter
der Leitung des Stadtbaudirektors Johann Friedrich Carl Dauthe wurde in
den Jahren 1784-1797 der Kircheninnenraum im klassizistischen Stil
ausgestaltet. Im Zuge dieser konzeptionellen Umgestaltung entstanden im
Altarraum und in den Vorhallen die Gemälde von Adam Friedrich Oeser
(1717-1799), dem ersten Direktor der Leipziger „Zeichen- und Malerey-
und Architectur-Academie". Die von dem Weißenfelser Orgelbaumeister
Friedrich Ladegast gebaute Orgel wurde im Jahr 1862 geweiht und im Jahr
2004 durch die Bautzner Orgelbaufirma Eule restauriert und erweitert.
Mit 6804 Pfeifen, 103 Registern und fünf Manualen ist sie die größte
Kirchenorgel Sachsens. Im Zusammenhang mit Restaurierungsarbeiten an
der Kirche gestaltete der Leipziger Künstler Felix Pfeifer im Jahr 1905
vier Passionsreliefs aus Alabaster im Altarraum.
Die „Offene Kirche" entwickelte sich seit 1980 mit der Friedensdekade
und den seit 1982 wöchentlich montags 17 Uhr durchgeführten
Friedensgebeten. Im Herbst 1989 wurde die Nikolaikirche Ausgangspunkt
der gewaltfreien Montagsdemonstrationen, die den Zusammenbruch des
DDR-Staates wesentlich herbeiführten und die Einheit Deutschlands ohne
Krieg und Sieg ermöglichten: Ein Wunder biblischen Ausmaßes. Der
Osterlichtbaum „Gesprengte Fessel" (Ostern 1995) im Mittelgang der
Kirche erinnert an die Ereignisse von 1989. Ein weiteres Symbol für
Frieden und Versöhnung stellt das 1996 der Kirchgemeinde verliehene
Nagelkreuz von Coventry dar. Umfassende
Restaurierungsarbeiten, die in drei Perioden zwischen 1968 und 2004
durchgeführt wurden, lassen heute den Kircheninnenraum wieder in seiner
frühklassizistischen Ausstattung erstrahlen. Mit mehr als 1500
Sitzplätzen gehört die Nikolaikirche zu den größten Kirchen Sachsens.

Der Nikolaikirchhof ist ein Platz in der östlichen Innenstadt von
Leipzig. Auf ihm steht die Nikolaikirche. Kirche und Platz besitzen
besondere Bedeutung für die Friedliche Revolution 1989. Der zweite Bau
auf der Nordseite ist das 1886/1887 nach Plänen von Hugo Licht erbaute Predigerhaus
- das Pfarr- und Gemeindehaus der Kirchgemeinde St. Nikolai. Von der
Straßenseite wirkt das Predigerhaus wie ein normales Eckhaus.
Tatsächlich ist es eine Dreiflügelanlage, deren kurze Seitenflügel mit
den Nachbargebäuden zwei kleine Innenhöfe bilden. Das Predigerhaus ist
viergeschossig. Neun Fensterachsen wenden sich zum Nikolaikirchhof,
drei zur Ritterstraße. Die Ecke ist gebrochen und trägt einen mit einem
Türmchen bekrönten polygonalen Eckerker.
Nikolaisäule auf dem
Nikolaikirchhof - Ausgehend von den Friedensgebeten in der
Nikolaikirche eroberte 1989 der Protest den öffentlichen Raum. Eine mit
Palmwedeln gekrönte Säule aus dem Kirchenschiff ist auf dem Platz
nachgebildet worden. Das Projekt des Leipziger Künstlers Andreas
Stötzner trägt den Gedanken des Aufbruchs symbolisch aus der Kirche
hinaus. Zwei Drittel der zum Bau benötigten Mittel wurden durch Spenden
von Bürgern, Unternehmen und Einrichtungen erbracht.

Nikolaisäule auf dem Nikolaikirchhof und Nikolaikirche Leipzig

Nikolaisäule auf dem Nikolaikirchhof und Nikolaikirche Leipzig

Speck's Hof

Alte Börse und Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus am Marktplatz

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus am Marktplatz

Neues Rathaus Stadt Leipzig mit Rathausturm am Stadthaus, Burgplatz

Uni-Riese Leipzig

Mendebrunnen und Oper Leipzig am Augustusplatz

Das Gewandhaus zu Leipzig ist
ein 1981 eingeweihtes Konzertgebäude am Augustusplatz in der Innenstadt
von Leipzig. Sighard Gille schuf 1980–1981 das 714 m² große und 31,80 m
hohe Deckengemälde Gesang vom Leben für die Foyers. Es ist das größte Deckengemälde Europas und von keiner Stelle aus als Ganzes sichtbar.

Ägyptisches Museum der Universität Leipzig

Oper Leipzig am Augustusplatz

Johannapark - Vom Leipziger Bankier Wilhelm Seyfferth angelegter und nach seinem Tod 1881 der Stadt gestifteter Landschaftspark.

Blick vom Johannapark in den Osten: City-Hochhaus = Uniriese =
Weisheitszahn mit 142,5 m und davor rechts der 114,7 Meter hohe
Rathausturm

Lutherkirche beim Johannapark, leider geschlossen

Gohliser Schlösschen - Landhaus im Rokokostil mit Park und Restaurant für kulturelle Veranstaltungen, Hochzeiten und Konferenzen.

Unzeitgemäße Zeitgenossen ist
der Titel einer Bronzeplastik des Hallenser Bildhauers Bernd Göbel (*
1942) nahe dem östlichen Beginn der Grimmaischen Straße in Leipzig.
Eine quadratische Säule in 1,90 Meter Höhe (Oberkante) mit einem 2,90
Meter langen Querbalken gleichen Querschnitts verbunden. Die Höhe ist
so bemessen, dass ein normal großer Mensch den Balken nicht unterqueren
kann, ohne dass es zu einem (Denk-)Anstoß kommt. Die Säule, entstanden
in den letzten Jahren der DDR, hat im oberen Teil einen breiten Riss,
den ein kleiner Mann mit primitiven Mitteln – Ast und Seil – zu
stabilisieren versucht.
Auf diesem „unsicheren“ Unterbau stehen auf unterschiedlichen
Balancierunterlagen fünf 1,40 Meter hohe nackte Bronzefiguren, die
abwechselnd in die entgegengesetzte Richtung orientiert sind. Sie haben
alle ein kleines, in Gold gefasstes Detail. Das Balancieren deutet an,
dass sie zunächst mit sich selbst beschäftigt sind. Es sind dies, von
der nördlichen Seite beginnend,
die Pädagogikerin mit einem goldenen (Holz-)Hammer,
der Diagnostiker mit einem goldenen Hörrohr,
die Rationalisatikerin mit einer goldenen Säge,
der Stadtgestaltiker mit einem goldenen Lorbeerkranz, den Finger
am Sprengzünder und den Blick in Richtung der 1968 gesprengten
Universitätskirche
der Kunsttheoretiker mit goldener Nase und goldenen Ohren.

Das Alte Rathaus ist ein Wahrzeichen der Bürgerstadt Leipzig und gilt
als einer der schönsten Renaissancebauten Deutschlands. Von den Resten
alter Gefängniszellen im Keller über die historischen Räume des
Hauptgeschosses bis hin zum Turm ist das Haus gleichsam ein Kompendium
Leipziger Stadtgeschichte und damit das wertvollste Museumsobjekt
selbst. Das Alte Rathaus in Leipzig – die Ostseite des Marktes der
Messestadt dominierend – gilt als einer der bedeutendsten deutschen
Profanbauten der Renaissance. An seiner Rückseite liegt der Naschmarkt.
Bürgermeister und Stadtverwaltung sind seit 1905 im Neuen Rathaus
untergebracht. Höhe Rathausturm: ca. 41 Meter

"Mann und Frau" von Carver K. Schwabein von 1968, platziert in der Reichsstrasse in Leipzig

Nikolaikirchhof mit Richard Wagner Ausstellung in Alte Nikolaischule, Antikenmuseum der Universität Leipzig und Predigerhaus

Fischer-Art auf Brühl-Arkade, Ostseite von Leipzig Marriott Hotel

Leipzig Hauptbahnhof- historisches Gebäude
Der imposante Bau in einer Länge von 300 m und den 26 Bahnsteigen ist
eine Kathedrale für die Eisenbahn. Die alten Wartesäle, der Speisensaal
und der Querbahnsteig lassen den Glanz der vergangenen Eisenbahnepoche
fühlen. Der Bau des Hauptbahnhofes war eine technische und
organisatorische Meisterleistung. Aus vier alten Bahnhöfen wurde der
neue Leipziger Zentralbahnhof. 1913 wurde der erste Teil - die
Westhalle - in Betrieb genommen. Bei der Konstruktion der Gleishalle
wurde das Prinzip von Gustave Eiffel - genietetes Eisenfachwerk -
verwendet. 1915 war der gesamte Querbahnsteig fertig. Er erreicht eine
Länge von 270m und macht deutlich, dass ein Palast für die Reisenden
gebaut worden ist.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: