web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Mondsee
am Mondsee, Juli 2024
Die Marktgemeinde Mondsee mit 4.000 Einwohnern liegt
im oberösterreichischen Salzkammergut am gleichnamigen See, dessen
Südufer teilweise die Grenze zum Land Salzburg bildet. Der Ort liegt im
Gerichtsbezirk Vöcklabruck auf 493 m Höhe im Hausruckviertel am Mondsee.
Das Amtshaus der Landgemeinden befindet sich in den Räumen des ehemaligen Gymnasiums in Mondsee im Salzkammergut.

In der Römerzeit bestand hier eine Siedlung, wie Funde beweisen, eine
Straße verband sie mit Juvavum, dem römischen Salzburg. Um 600 begannen
die Bayern das Mondseerland zu besiedeln und rodeten die Wälder. 748
gründete der Baiernherzog Odilo aus dem Geschlecht der Agilolfinger das
Kloster Mondsee. Die Entwicklung wurde von da an sowohl in
geistig-kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht vom Kloster
geprägt.
Ursprünglich im Ostteil des Herzogtums Bayern liegend, kam der Ort mit
dem Mondseeland nach dem Landshuter Erbfolgekrieg 1506 zum Erzherzogtum
Österreich. Noch im selben Jahr verpfändete Kaiser Maximilian das
Mondseeland an den Erzbischof von Salzburg. Erst nach 60 Jahren wurde
die Rückkaufklausel geltend gemacht und somit kam das Mondseeland 1565
zum Land Österreich ob der Enns. Während der Napoleonischen Kriege war
der Ort zwischen 1809 und 1816 nochmal Bayern zugeschlagen.

Herzog Odilo-Straße 36, 5310 Mondsee

Mein Handwerk kommt von altersher /
Ich schaff euch Fleisch und noch viel mehr:
Ich schlacht den Ochsen und die Kuh /
Den Stier und auch das Kalb dazu /
Ich mach die Wurst / den Schinken zart /
Und Leberkas nach bester Art /
Ob Wild / Geflügel oder Fisch /
Das alles ist bei mir stets frisch /
Drum Hausfrau komm zu mir herein/
Du wirst gewiss zufrieden sein.
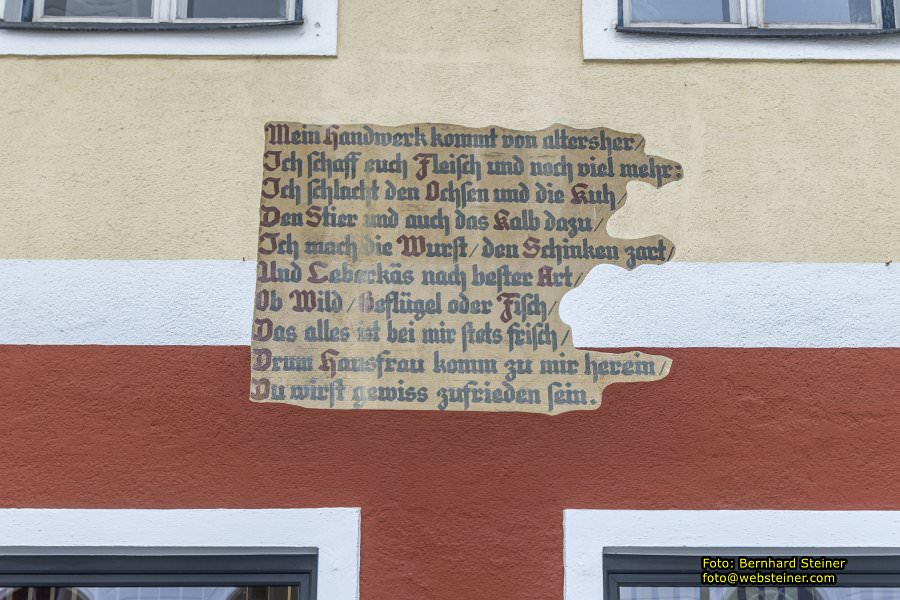
Herzog Odilo-Straße 26, 5310 Mondsee

Herzog Odilo-Passage '96

Basilica Minor St. Michael
739-748 Klostergründung durch den Hl. Bischof Pirmin und Bayernherzog Odilo II.
1470-1487 Gotischer Kirchenbau unter Abt Benedikt II. Eck.
Reiche Barockausstattung durch die Bildhauer Hans Waldburger, Meinrad Guggenbichler und Franz Anton Koch.
Bis 1791 Benediktinerabteikirche, seither Pfarrkirche.
2005 Verleihung des Ehrentitels Basilica Minor durch Papst Johannes Paul II.
2005-2008 Innenrestaurierung,
dabei Neugestaltung des Altarraums durch den Südtiroler Bildhauer Lois
Anvidalfarei - Auffindung und Restaurierung des 1867 in
Glasmosaikarbeit hergestellten Heiligen Grabes.
2013 erhielt die Basilika eine offizielle Kopie der Schwarzen Madonna von Altötting.

Die bemerkenswerte dreischiffige Staffelkirche hat einen langen Vorchor
und einen erhöht gelegenen Chor. Die gotischen Bauformen zeigen den
Einfluss der Braunauer Bauschule bzw. der Burghauser Bauschule. Das
vierjochige Langhaus hat Netzrippengewölbe, im Mittelschiff mit der
Wechselberger Figuration, in den Seitenschiffen mit einer geknickten
Reihung. Im Westjoch zieht sich über alle drei Schiffe eine hölzerne
Empore aus 1670. Der vierjochige Vorchor hat die gleiche Höhe und
Breite wie das Mittelschiff und ein Netzrippengewölbe wie im
Mittelschiff.

Die Basilika zum Heiligen Michael in Mondsee - ein besonderer Kunstschatz nahe Salzburg
ehemalige Benediktiner-Stiftskirche; Patrozinium: 29. September
Im Jahr 748 gründete der Bayernherzog Odilo II aus dem Geschlecht der
Agilolfinger das Kloster Mondsee auf den Überresten einer römischen
Besiedelung. Mit der Gründung erhielt das Kloster umfangreiche
Schenkungen, die sich in der folgenden Zeit noch vermehrten. Sie
bezogen sich auf das heutige Mondsee- und Wolfgangland. Es gab aber
auch Schenkungen in Bayern und im übrigen Ober- und Niederösterreich.
Die ersten Mönche sollen nach der Klostertradition von Monte Cassino
gekommen sein. Es gibt allerdings auch ernstzunehmende Überlegungen,
dass die ersten Mönche nach der Regula mixta gelebt haben. Nach dem
Sturz Herzog Tassilo III durch Kaiser Karl wurde Mondsee Reichskloster.
Um 800 erlebte es eine erste Blüte. Sie hing mit Abt Hildebald
(804-814) zusammen, dieser war der Hofkaplan Kaiser Karl des Großen und
späteren Erzbischofs von Köln, der Mondsee regierte. 833 kam Mondsee
durch einen Klostertausch unter die Herrschaft der Regensburger
Bischöfe. 943 Brandschatzung des Klosters durch die Magyaren. Von 976
bis 977 soll sich der Heilige Wolfgang als Bischof von Regensburg in
Mondsee aufgehalten haben. "Er floch in das pirg, haust zu Mainse im
closter, das derselben Zeit dem pistumb zu Regensburg zugehöret"
(Aventin). Sein Aufenthalt in dieser Gegend führte später zur
Entstehung des bedeutenden mittelalterlichen Wallfahrtsortes St.
Wolfgang. Unter Abt Rudbert (1072-1115) wurde eine romanische Kirche
erbaut, diese wurde 1104 eingeweiht. 1142 konnte Abt Konrad II
Bosinglother die freie Abtwahl durchsetzten, das Kloster erhielt somit
seine Selbständigkeit. Abt Konrad wurde am 15. Jänner 1145 in Oberwang
ermordet und bereits sehr früh im Kloster als Seliger verehrt. Das
Kloster Mondsee und das Mondseeland gehörten bis 1506 zu
Bayern-Landshut. Im ausgehenden Mittelalter gab es sogar Tendenzen zu
einer selbständigen Landwerdung. Maximilian I bekam nach dem Landshuter
Erbfolgestreit 1506 das Mondsee- und Wolfgangland für Österreich. Er
wollte sogar nach einem später aufgehobenen Testament in diesem
Klosterland seine letzte Ruhestätte errichten.
Im 15. Jh. erlebte das Kloster neuerlich eine Blütezeit. Abt Johannes
II Trenbeck (1415-1420) nahm am Konzil zu Konstanz teil. Er soll auch
der Verfasser einer Geschichte über dieses Konzil sein. Das prächtig
ausgestattete Urbar von 1416 entstand unter sein Amtszeit. Sein
Nachfolger als Abt Simon Reuchlin (1420-1463) führte hier die vom
Kloster Melk ausgehende Reform ein. Das hatte zur Folge, dass fast alle
Kirchen des Mondseelandes neu gebaut wurden und auch neue
Klostergebäude errichtet wurden. 1444 entstand der Kapitelsaal und 1448
der Kreuzgang. Abt Benedikt Eck (1463-1499) ließ unter Baumeister Hans
Lenngdörffer aus Burghausen die heutige spätgotischen Kirche errichten.
Die Weihe des Hauptschiffes konnte 1487 gefeiert werden. Abt Wolfgang
Haberl (1499-1521) ließ für die Wallfahrer die Hochkreuzkapelle
erbauen. Auch gründete er 1514 in Mondsee das erste Stiftsgymnasium in
Oberösterreich, das bis zur Auflösung des Klosters bestand. 1626
gestaltete der Salzburger Bildhauer Hans Waldburger den bis zu 18 m
hohen frühbarocken Hochaltar.
Es war Abt Coelestin Kolb (1668-1683), der Meinrad Guggenbichler (geb.
1649 in Einsiedeln) nach Mondsee holte. Dieser wirkte von 1679 bis zu
seinem Tod 1723 in Mondsee. So schuf er folgende Altäre für die
Klosterkirche: Den Heilig-Geist-Altar, den Wolfgang-Altar, den
Corpus-Christi-Altar, den Arme-Seelen-Altar, den Sebastianaltar, den
Marienaltar und den Petrus-Altar. Die Kanzel und das Orgelgehäuse
entstammen ebenfalls seinem künstlerischen Tun. Unter Abt Coelestin
wurde der Kirchenraum stark verändert. Der Lettner (die Trennung des
Altarraumes vom übrigen Kirchenraum) wurde entfernt. Im nördlichen und
südlichen Seitenschiff wurden niedrige barocke Kapellen mit
Kreuzgratgewölbe eingebaut. Später kamen noch vom Tiroler Franz Anton
Koch (1700-1756) weitere Altäre hinzu: der Johannesaltar, der
Josefsaltar, der Anna- oder Jungfrauenaltar und der Antoniusaltar. Der
Kreuzaltar wurde vom Mondseer Bildhauer Leopold Schindlauer
zusammengestellt.
In die Amtszeit von Abt Bernhard Lidl (1729-1773) fiel die 1000 Jahr
Feier. Das nahm er zum Anlass um die vierachsige, viergeschossige
Doppelturmfassade zu errichten. Die Türme sind heute 52 m hoch. In der
Fassade finden sich die Figuren des Heiligen Petrus und Paulus. Der Abt
selbst verfasste eine umfangreiche Geschichte (Chronicon Lunaelacense)
des Klosters von seinen Anfängen an. Nach dem Marktbrand von 1774 dem
auch das Kirchendach zum Opfer fiel, wurden die Pultdächer im Süden
durch das heutige Mansardendach ersetzt. Nach dem Tode von Abt
Opportunus (1773-1784) wurde die Wahl eines neuen Abtes verboten und
ein Administrator eingesetzt. 1791 wurde das Kloster Mondsee, das
damals älteste auf österreichischen Boden, aufgehoben. Der Bischof der
neu gegründeten Diözese Linz erhielt das Klostergut als Dotation. 1809
übergab Kaiser Napoleon das Kloster samt Gütern dem bayrischen
Feldmarschall Karl Philipp von Wrede. Dessen Nachkommen hatten es als
"Schloss" und "Herrschaft Mondsee" in Besitz bis zum Verkauf im Jahre
1986.
Im Jahr 2005 wurde die ehemalige Klosterkirche unter Papst Johannes
Paul II zur Basilika minor erhoben. Im Jahr 2005 begann eine drei Jahre
dauernde Kircheninnenrenovierung, im Zuge derselben die Raumschale der
Kirche vollständig renoviert wurde. Auch alle Altäre, Bilder, Böden in
den Altarräumen und Fahnen wurden einer gründlichen Überprüfung,
Reinigung, Konservierung und notwendiger Restaurierungsarbeiten
unterzogen. Die Ostseite der Kirche täuscht eine doppelchörige Anlage
vor. An ihrer Nordseite ist die Kirche mit dem ehemaligen Kloster
(heute Schloss) verbunden. Der dreischiffige basilikale Kirchenraum
zählt zu den hervorragendsten wie auch größten Baudenkmälern
Österreichs (70 m lang, 34 m breit und 22 m hoch). In den Kirchenbau
integriert sind die ehemalige Schatzkammer (jetzt Sakristei) des
Klosters, der Betchor der Mönche und die 36 m lange gotische
Klosterbibliothek, die einst eine mittelalterliche Pultbibliothek war.
Der ehemalige Betchor und die Bibliothek sind zurzeit Teil des Museums
Mondseeland.

Die schön gerahmten Stationen des Kreuzwegs aus den Jahren zwischen
1740 und 1745 stammen ebenfalls von dem Salzburger Hofmaler Jacopo
Zanusi. Bei der Restaurierung 2007 konnten Überma-lungen entfernt und
die originale barocke Fassung freigelegt werden.

Das Kloster Mondsee war bei seiner Aufhebung das älteste
Benediktinerkloster Österreichs das Erzbistum Salzburg gehörte damals
noch nicht zu den österreichischen Erblanden und hatte durch die
Jahrhunderte auf geistlichem, künstlerischem und kolonisatorischem
Gebiet wesentlich zur Ausprägung der Kulturlandschaft Mondseeland
beigetragen. Seine aus der Spätgotik stammende Kirche erzählt von der
Blütezeit des Klosters in dieser Epoche und gehört zu den bedeutendsten
und größten Baudenkmälern des Landes. Eine starke Ausdruckskraft
besitzen die Altäre des Bildhauers Meinrad Guggenbichler, der die Kunst
Mondsees während der Barockzeit und darüber hinaus prägte. Mit seinen
kraftvollen, bewegten Heiligengestalten spricht er den heutigen
Betrachter ebenso an wie Franz Anton Koch mit seinen feingliedrigen,
geradezu ätherischen Figuren. Wurde auch das Kloster selbst wie so
viele andere aufgelöst, blieb doch die Klostertradition bis zum
heutigen Tag lebendig und wirkt in der Feier der Liturgie, der
Kirchenmusik und der Pflege historisch gewachsener Traditionen weiter.
Nicht nur der gewaltige Kirchenbau mit seinen Kunstwerken, sondern auch
die historische und kulturelle Bedeutung und insbesondere die
hervorragende Pflege der liturgischen Feiern waren Grundlage für die
Verleihung des Ehrentitels einer Basilica Minor durch Papst Johannes
Paul II. im Jahr 2005 eine Ehrung, die zugleich Verpflichtung und
Aufgabe für den künftigen Ausbau dieses religiösen und kulturellen
Zentrums im Mondseeland bedeutet.

Das Sakristeiportal (um 1487) an der Nordseite des Chores ist eines der
wenigen Zeugnisse der gotischen Ausstattung der Klosterkirche. Die
spitzbogige Türöffnung wird von einem reich an Birnstab und Kehlungen
profilierten, spitzbogigen Gewände mit durchsteckten Stäben gerahmt,
das ein schmuckloses Tympanonfeld freilässt. Den kielbogigen, auf
Konsolen aufsitzenden äußeren Abschluss krönt eine Kreuzblume, auf der
die Figur Christi thront. Zur Seite tragen Konsolen weitere sechs
Holzskulpturen, die jeweils von einem Baldachin bekrönt werden. Sie
bilden Paare, oben Maria und Johannes Evangelist, in der Mitte Petrus
und Paulus sowie unten Wolfgang und Benedikt. Ein bemerkenswertes
Beispiel mittelalterlicher Schmiedekunst ist das auf das Jahr 1487
datierte Türblatt mit Zugring und reich an Ranken verziertem
Schlüsselschild. Bei der Renovierung 1955/56 wurde die ursprüngliche
Bemalung mit roten Bändern und grünen Feldern freigelegt. Das
kunstvolle Schloss verschließt die Tür mittels 10 Riegeln.

Bereits unter Abt Wolfgang Haberl (1499-1521) soll in Mondsee eine
Orgel existiert haben. In den Jahren 1597-99 schuf Jonas Faber aus
Waidhofen an der Thaya eine neue Orgel, die schon 1674 unter Abt
Coelestin Kolb durch eine weitere Neuanschaffung abgelöst wurde. Auch
die Empore und das schwarz-golden gefasste Gehäuse mit dem
zeittypischen Knorpelwerkornament, das von M. Guggen-bichler stammt,
entstanden in dieser Zeit. Der Salzburger Hoforgelmacher Christoph
Egedacher schuf das Orgelwerk mit 17 Registern, zwei Manualen und
Pedal. 1883 führte Johann Lachmayr aus Linz nach etlichen Reparaturen
Erweiterungen durch, die die barocke Substanz reduzierten. 1966/67
wurde die pneumatische Orgel durch ein elektrisches System ersetzt. Als
sich ein Orgelkomitee der Pfarre im Jahr 1988 mit dem Neubau
beschäftigte, galten bei der Planung u. a. der Erhalt des
Guggenbichler-Gehäuses und die Integration eines Großteils des barocken
Pfeifenbestandes als Voraussetzung. Am 10. Oktober 1993 erfolgte die
Weihe der von der Manufacture d'Orgues Alfred Kern & Fils aus
Straßburg angefertigten neuen Orgel.

Zwei weitere Altäre Guggenbichlers befinden sich in der Petrus- und der
Marienkapelle. Sie entstanden um 1680 und sind einfachere Aufbauten
ohne flankierende Figuren. Die beiden Altarblätter von dem Mondseer
Laienbruder Ämilian Rösch zeigen die Schlüsselübergabe an den hl.
Petrus sowie die Verkündigungsszene.
Marienaltar aus der Werkstatt Guggenbichler
Schwarze Madonna von Altötting, Gnadenbildkopie (2013) vor dem Marienaltar

Der über 18 Meter hohe, frühbarocke Hochaltar, der noch deutliche
Elemente der Renaissance aufweist, ist auf das Jahr 1626 datiert und
stammt von dem Bildhauer Hans Waldburger. Dieser wurde nach 1571 in
Innsbruck als Sohn des dortigen Hofbildhauers Leonhard Waldburger
geboren und von Erzbischof Wolf Dietrich nach Salzburg berufen. Er ist
dort 1610 als Meister nachweisbar und war für die Klöster St. Peter und
Nonnberg tätig. Der Altar in Mondsee ist das einzige unversehrt
erhaltene Altarwerk Waldburgers und bildete den Auftakt zur
künstlerischen Erneuerung der Stiftskirche nach den Wirren der
Reformationszeit. Das in Schwarz und Gold gefasste Retabel im Schema
eines Triumphbogenaltares steht im Chorhaupt vor dem mittleren
Chorfenster. Der über dem Altartisch sich erhebende Tabernakel wird von
einem riesigen, siebenteiligen Reliquienaufsatz umgeben, dessen reich
verzierte Schreine ab 1731 bis zur Millenniumsfeier 1748 nach und nach
mit besonderen Reliquien gefüllt wurden, sodass in Mondsee einer der
größten Reliquienaltäre überhaupt entstand. Er enthält in der Mitte
erhöht die Gebeine des seligen Abtes Konrad II., dessen Skelett 1732 in
Passau zu einer Sitzfigur zusammengefügt wurde (s. S. 37) sowie an den
Seiten die liegenden Skelette von vier Katakombenheiligen: unten die
Märtyrerinnen Acatemera und Praejectitia, deren Namen sogar durch
Grabinschriften belegt sind (1731), darüber die Märtyrer Liberatus und
Castus (1736) und schließlich ganz oben in den schwungvoll gerahmten
Rokokoschreinen Einzelreliquien von weiteren 40 Märtyrern, die als
letzte vor der Millenniumsfeier 1748 erworben wurden.

Die beherrschende plastische Mittelszene zeigt die Krönung Mariens
durch die Hl. Dreifaltigkeit, deren Zeugen die Heiligen Benedikt (li.)
und Wolfgang sind. Flankiert wird die Marienkrönung von den
Apostelfürsten Petrus (li.) und Paulus in den seitlichen
Muschelnischen, über denen zwei hochrechteckige Tafelbilder mit der
Darstellung der Verkündigung, gemalt vom Laienbruder Romanus 1626,
angebracht sind. Die äußeren, in der Art gotischer Schreinwächter
platzierten Skulpturen stellen den Agilolfingerherzog Odilo II. als
Gründer sowie dessen Sohn Tassilo III. als Förderer des Klosters dar.
Das Zentrum des Auszuges nimmt die Figur des Kirchenpatrons Erzengel
Michael ein, flankiert von den Heiligen Stephanus und Laurentius.
Ergänzt wird die Altarsituation im Chor durch die liturgischen Orte
Volksaltar, Ambo und Vorstehersitz - ein durch Schlichtheit und
Ausgewogenheit bestechendes Ensemble, das 2008 vom Südtiroler Künstler
Lois Anvidalfarei für die Basilika geschaffen wurde. Im Chorraum fanden
auch die Ehrenzeichen der Basilica Minorihren Platz: das gelb-rot
gestreifte Conopeum (ursprünglich ein Schutzschirm für das
Allerheiligste bei Prozessionen) und das Tintinnabulum (ebenfalls aus
dem Prozessionswesen stammendes Glöckchen auf einer Vortragestange).

Bedeutender Wallfahrtsort - Von
976 bis 977 soll sich der Heilige Wolfgang als Bischof von Regensburg
in Mondsee aufgehalten haben. „Erfloch in das pirg, haust zu Mainse im
closter, das derselben Zeit dem pistumb zu Regensburg zugehöret"
(Aventin). Sein Aufenthalt in dieser Gegend führte später zur
Entstehung des Wallfahrtsortes St. Wolfgang. Nach Rom und Aachen war
das Mondseeland zu dieser Zeit das am meisten besuchte Wallfahrtsziel
der Welt. Noch heute finden Pilgerreisen und Wallfahrten über den
Falkenstein, wo sich der Hl. Wolfgang in einer Einsiedelei aufhielt und
dessen Quelle heilende Wirkung hat, mit dem Ziel St. Wolfgang statt.

Von besonderem kunsthistorischem Wert sind die Werke des Bildhauers
Meinrad Gug-genbichler (1649-1723). Unter anderem in der Basilika zu
besichtigen: sieben Altäre, Kanzel, Orgelgehäuse und diverse weitere
Arbeiten.
Der Josefsaltar zeigt auf dem Hauptbild die Heilige Familie, während im
Auszugsgemälde die Vierzehn Nothelfer versammelt sind. Die Figuren
stellen den Evangelisten Lukas und die hl. Theresa von Avila dar sowie
im Auszug die Heiligen Drei Könige.
„Die Heilige Familie“ - Altarblatt von Jacopo Zanusi (dat. 1741) am Josefsaltar

Die schwarz-golden gefasste Kanzel südlich am Chorbogen entstand um
1679 und gehört somit zu den frühesten Werken Meinrad Guggenbichlers in
der Stiftskirche Mondsee. Sie weist wie der 1678 gefertigte
Orgelprospekt noch Knorpelwerkornament auf. Der polygonale Korb
präsentiert in Muschelnischen, die durch weinlaubumrankte Säulchen
getrennt sind, die Statuetten der vier Evangelisten und des hl. Paulus.
Den volutengeschmückten Schall-deckel bekrönt die Skulptur des
Auferstandenen mit der österlichen Fahne, der die Schlange der Erbsünde
zertritt.

Der als Pendant gestaltete Wolfgangsaltar (1679-81) zeigt auf dem
Altarblatt den Patron der berühmten Wallfahrt als Schutzherr der
Kranken. Situiert ist die Szene am Mondsee; im Mittelgrund links sind
die Türme der Stiftskirche zu erkennen. Die am linken Bildrand auf den
Betrachter blickende Person soll angeblich ein Porträt des Bildhauers
Meinrad Guggenbichler darstellen. Flankiert wird das Gemälde von den
Heiligen Placidus und Maurus, Schülern des Ordensvaters Benedikt.
Der Wolfgangsaltar von Meinrad Guggenbichler (1679-81)

Im Vorchor ist nördlich der Hl.-Geist-Altar (1679-81) aufgestellt. Das
Altarblatt zeigt die Herabkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten, der
in Form von Feuerzungen über den Häuptern der um Maria versammelten
Apostel schwebt. Im Vordergrund rechts weist ein Engel mit Weltkugel
darauf hin, dass die Jünger die Botschaft des Evangeliums in aller Welt
verbreiten sollen. Die hll. Äbte Benedikt von Nursia, eines seiner
großartigsten Werke (li.), und Bernhard von Clairvaux fungieren als
Schreinwächter.
Der Hl.-Geist-Altar von Meinrad Guggenbichler (1679-81)

Netzrippengewölbe im Mittelschiff mit spätgotischen vegetabilen Ornamenten

Hilfbergstraße in Mondsee

Wallfahrtskirche Maria Hilf - Kirche zu Maria Hilf (Hilfbergkirche)
Das Gnadenbild ist eine Kopie des Marienbildes von Lucas Cranach d. Ä.
1449 als Kapelle zum Hl. Ulrich errichtet.
1678 stiftet der Mondseer Bader Göbl das Marienbild.
1706 Vergrößerung und Barockisierung der Kirche.
Altäre und Kanzel stammen vom Bildhauer Meinrad Guggenbichler.
Größte Wallfahrt nach St. Wolfgang im Klosterbereich.
Auch heute kommen noch viele Wallfahrer und Bittprozessionen auf den Berg.
Die Kirche erhebt sich auf einem ebenen Platz, den ebenen Platz, den
eine schindelgedeckte Mauer umgibt. An ihr stehen Bänke, die für die
Wallfahrer gedacht sind. Im Nordwesten der Umfassungsmauer ist noch ein
Verkaufsstand aus früherer Zeit für Wallfahrtsandenken aufgestellt. Im
Südosten wird die Mauer vom kleinen Mesnerhäuschen unterbrochen, in dem
wahrscheinlich einst die „Mayrknechte“, die von hier aus ihre Wachgänge
durchführten, geschlafen haben. Sie wurden mit zwei Gulden jährlich
entlohnt und erhielten auch Geld für Bettzeug. In den Kirchenrechnungen
sind – im Gegensatz zu anderen Wallfahrtskirchen im MondSeeLand – hier
keine Opferstockeinbrüche erwähnt, was wohl aus die sehr gute Bewachung
zurückzuführen ist. Beim nordwestlichen Zugang ist noch ein Stück des
alten, gepflasterten Wallfahrerweges zu sehen. Immer wieder musste
einst Geld zum Herrichten des steilen Weges oder für Stangen zum
Anhalten ausgegeben werden. Auch die Schneeräumung im Winter war mit
hohen Kosten verbunden. Außerhalb der Mauer steht an der
Hilfberg-Straße eine Kapelle mit einem Donatus-Bild. Beim Umbau der
alten gotischen Kirche im Jahr 1706 wurde der Kirchenraum durch
Seitenschiffe erweitert, um mehr Pilgern Platz zu bieten. Zwei
Seiteneingänge ermöglichten auch größerer Wallfahrergruppen ein
bequemes Betreten des Kirchenraumes. Im Osten ist an den Chor eine
Sakristei mit einer Holzdecke angebaut, im Westen erhebt sich auf dem
steilen Satteldach ein achteckiger Dachreiter mit offener Glockenstube
und Zwiebelhelm. Die kleinere Glocke stammt noch aus der Erbauungszeit
des gotischen Gotteshauses. Nach dem Turm schließt das Dach im Osten
mit einem trapezförmigen Giebel ab, in dessen Mittelpunkt sich das
Ziffernblatt der Uhr befindet. Darunter führt ein gotisches Portal ins
erste Kirchenjoch, das von der Orgelempore in zwei Ebenen geteilt wird.

Von der ehemaligen Klosterkirche in Mondsee erreicht man in östlicher
Richtung über eine steile Straße bergaufwärts in wenigen Minuten die
Wallfahrtskirche Maria-Hilf. Sie war früher dem hl. Ulrich geweiht.
Im Spanischen Erbfolgekrieg hatte sich der bayerische Kurfürst auf die
Seite Frankreichs gestellt, die Bayern bauten 1702 die Hausruckgrenze
militärisch aus. Für die Österreichische Verteidigung wurden auch
Schanzarbeiter und Schützen aus Mondsee verpflichtet. In der
Bevölkerung des MondSeeLandes war daher die Angst vor fremden Truppen
sehr groß. Abt Amand Göbl wandte sich an die heilige Jungfrau Maria um
Hilfe. Er gelobte, eine neue Kapelle zu Ehren Marias zu errichten. Der
Sieg über das bayerisch-französische Hauptheer bei Höchstätt im Jahr
1704 beendete die Gefahr und der Abt löste sein Versprechen ein. Er
ließ die erneuerungsbedürftige Ulrichskirche in eine Maria-Hilf-Kirche
umbauen, vergrößerte sie um Seitenschiffe und versah sie mit Turm,
Sakristei, Altären und Orgel. Am Fest Mariae Heimsuchung wurde bei
einem festlichen Umzug das Maria-Hilf-Bild in die Kirche übertragen.
Alljährlich „in festo visitantis“ – zum Fest „Mariae Heimsuchung“ am 2.
Juli – fand eine feierliche Prozession auf den Maria-Hilf-Berg statt.
Auch die Schützen und viele Zünfte mit ihren Zunftstangen und Fahnen
nahmen daran teil. Die Anziehungskraft der neuen Wallfahrtsstätte war
für die Menschen so stark, dass viele die traditionelle Mariawallfahrt
nach Zell am Moos innerhalb weniger Jahre vernach-lässigten, das zeigte
sich am drastischen Rückgang der Opfergelder nach 1706.
Die Marienwallfahrt zum Gnadenbild auf dem Berg war zu einem wichtigen
Bestandteil im religiösen Leben der Menschen geworden, was auch aus
einem Liederbuch des Jahres 1827 der Familie Perner aus Mondsee
hervorgeht. Von den zwölf enthaltenen Marienliedern beziehen sich
einige direkt auf die Wallfahrt zum Maria-Hilf-Berg. Auch im Winter
besuchten Gläubige die Kirche. Als Wind- und Wetterschutz wurde
jährlich ein Holzportal angebaut und im Frühjahr wieder abgebrochen.
Nach dem Tod des letzten Abtes setzte sich der Administrator des
Stiftes, Pater Georg Socher, sehr für die von der Schließung bedrohte
Kirche ein. Man argumentierte, dass das Armenhaus ohne die Opfergelder
aus der Maria-Hilf-Kirche kaum existieren hätte können. Die Kirche
blieb geöffnet – die Wallfahrt lebt bis heute fort. Immer noch besuchen
gläubige Menschen von nah und fern das Gotteshaus. Die Beliebtheit der
Wallfahrtskirche beweisen auch die zahlreichen Taufen und Trauungen,
für die das Gotteshaus auf dem Berg gerne aufgesucht wird. Wundertätige
Orte beflügelt schon seit alters her die Phantasie der Menschen. So
geht die Sage, dass vom Hilfberg ins Kloster hinab ein unterirdischer
Gang führt, in dem ein Schatz vermauert wäre, oder geheimnisvollen
Unterbergmännchen zogen manchmal in der Nacht zum Gnadenkirchlein.
* * *
Abt Bernhard Lidl erwähnt in seiner 1748 verfassten Klostergeschichte
(Chronicon Lunaelacense) keine Kanzel für die Mariahilfkirche. Die
heutige Kanzel wird in die
Jahre um 1730 datiert und damit in die Zeit nach dem Tod
Guggenbichlers. Der Künstler ist unbekannt, möglicherweise handelt es
sich um eine Werkstattarbeit. Die am nordöstlichen Pfeiler angebrachte
Kanzel zeigt, wie die übrige Ausstattung, vergoldete Ornamentik auf
schwarzem Grund. Am Korb sind vier Reliefs mit Szenen aus dem Leben
Mariens angebracht. Zu sehen sind eine Immaculata-Darstellung als
Hinweis auf die unbefleckte Empfängnis Mariens, eine
Verkündigungsszene, die Heimsuchung sowie die Himmelfahrt Mariens. Den
Schalldeckel bekrönt die Skulptur Christi als Guter Hirte. Begleitet
wird er von Putten mit Limmern und Hirtenschippen. Letztere dienten
dazu, Tiere, die sich von der Herde entfernen, mit etwas Erde zu
bewerfen und so wieder zurückzuholen. Das Motiv des Guten Hirten mit
Lämmern findet sich des öfteren auf Kanzeln und wurde auch von Meinrad
Guggenbichler gerne verwendet, so z. B. in der Wallfahrtskirche St.
Wolfgang.
In den Jahren 1704-06 schuf der Mondseer Klosterbildhauer Johann Meinrad Guggenbichler den Hochaltar
und die beiden Seitenaltäre. Archivalien hierzu haben sich nicht
erhalten, doch erwähnt das von Abt Bernhard Lidl zur Tausendjahrfeier
Mondsees 1748 verfasste Chronicon Lunaelacense — eine Geschichte des
Klosters von den Anfängen bis ins 18. Jh. — die Aufstellung
vorgenannter Ausstattungsstücke. Guggenbichler wurde 1649 in Einsiedeln
in der Schweiz geboren und taucht im Jahre 1675 erstmals im
Zusammenhang mit der Ausstattung der dem Kloster Mondsee inkorporierten
Pfarrkirche Strasswalchen in der Gegend auf. In den Unterlagen des
Klosters
Mondsee erscheint Guggenbichler ab 1678. Von da an stand er als
Klosterbildhauer in Diensten Mondsees und schuf für dieses zahlreiche
Schnitzwerke. Darüber hinaus finden sich seine Arbeiten u. a. in der
Wallfahrtskirche St. Wolfgang, den Klöstern Michaelbeuern und Mattsee
sowie in zahlreichen Pfarr- und Filialkirchen des Salzburger- und
Mondseelands. Für den 10. Mai 1723 meldet das Totenbuch der Pfarre
Mondsee den Tod des 74-jährigen Künstlers.
Der schwarz-golden gefasste Hochaltar füllt den Chorschluss in seiner
ganzen Breite und Höhe aus und bildet die prunkvolle Rahmung für das
Mariahilfbild..Er wirkt auf den Betrachter wie eine monumentale
Monstranz, ein Schaugefäß, für das Gnadenbild. Verstärkt wird dieser
Eindruck durch die reiche Vergoldung,die silbern glänzenden Wolkenbänke
und die wie funkelnde Edelsteine aufblitzenden, bunten Gewandpartien.
Im Zentrum des viersäuligen Aufbaus präsentieren zahlreiche Putten das
von einer himmlischen Gloriole umgebene Marienbild. Zwei Engel knien in
Anbetung zu Füßen des Gnadenbildes und leiten optisch über zu den
beiden Schreinwächtern, den Erzengeln Gabriel (li.) und Raphael (re.).
Der Verkündigungsengel, der Maria die frohe Botschaft überbrachte, ist
mit seinem Attribut einer weißen Lilie dargestellt, dem Symbol für
Reinheit, Unschuld und Gnade. Sein Pendant Raphael gilt aufgrund der
Tobias-Legende, auf die der Fisch in seiner Rechten hinweist, als
Inbegriff des Schutzengels. Durch den Pilgerstab übernimmt er aber auch
das Patronat über die Wallfahrer. Der dritte Erzengel, der
antikisierend gewandete Michael, bekrönt den Altaraufbau, begleitet von
girlandentragenden Engeln und Putten. Flammenschwert und Waage weisen
auf seine Rollen als Bezwinger des Satans sowie als Seelenwäger während
des Jüngsten Gerichts hin. Im Altarauszug schwebt die Büste Gottvaters
mit Szepter auf einer Wolkenbank, zu seinen Füßen schultert ein Putto
die Weltkugel. Zusammen mit der Taube als Hl. Geist und dem Jesuskind
auf dem Gnadenbild stellt somit die Hl. Dreifaltigkeit die Achse des
Altares dar.

Der unter der Orgel liegende niedrige Raum ist durch ein eisernes
Gitter vom übrigen Kirchenraum getrennt. Auf einem Holzbrett hängen
noch Votivtafeln aus jüngerer Zeit. An die drei anschließenden
Kirchenjoche sind niedrigere Seitenschiffe angebaut. Dann folgt ein
eingezogener einjochiger Chor mit einem 3/8 – Schluss. Die Kreuzgewölbe
der einzelnen Joche sind mit Stuckbändern versehen. Durch die breiten
Segmentbogenfenster der Seitenschiffe fällt reichlich Licht ins
Kircheninnere. Der Chor der Kirche wird links und rechts durch
ebensolche Fenster erhellt.

Der Hochaltar gilt vor allem in seinem Aufbau als eine Meisterleistung
Guggenbichlers. In der Mitte des Untergeschoßes hängt in einem
verglasten Schrein das Gnadenbild – eine Kopie des Originals von Lukas
Cranach dem Älteren, das sich in Innsbruck befindet. Kleinere und
größere Engelfiguren umschweben das Bild. Zwischen den glatten Säulen
neigt sich links der Erzengel Gabriel mit der Lilie dem Bild zu, rechts
hält Raphael Fisch und Stab. Über den nach vorne geschwungenen,
geschlossenen Gieben befinden sich Blumenkränze streuende Engel mit
weit ausgebreitet Flügeln. In der Mitte des Aufsatzes umschweben Putten
den segnenden Gottvater, darüber schließt der dritte Erzengel Michael
mit der Seelenwaage das Gesamtbild ab. Bei den Seitenaltären sind die
Säulen durch Figuren ersetzt. Neben den Altarblättern befinden sich
links der hl. Martin und Ulrich, rechts der hl. Georg und Florian.
Zwischen den gesprengten Giebeln sind im Aufsatz Halbfiguren – links
der hl. Wolfgang und rechts wiederum der hl. Ulrich. Bei der Planung
der drei Kirchenaltäre hat man auf den bisherigen Kirchenpatron Ulrich
und seine Verehrung besondere Rücksicht genommen und ihn auf jedem
Altar dargestellt. Auf dem Hochaltar kniete früher auf einer am
Tabernakel stehende Konsole eine 68 cm hohe Ulrich-Figur. Diese ragte
sogar mit dem Kopf ins Gnadenbild hinein. Der hl. Ulrich als früherer
Kirchenpatron konnte so mit dem neuen Gnadenbild zugleich verehrt
werden. Er stand sozusagen auf dem Weg der Augen oder Gedanken zum
wundertätigen Bild. Beachtenswert ist der Schalldeckel der Kanzel. Wie
bei jenem in St. Wolfgang steht in der Mitte die Freifigur des „Guten
Hirten“ mit dem Schaf auf den Schultern. Ringsum tragen Engel
Hirtenschaufeln und Lämmer.
Vom Gnadenbild wird folgende Legende erzählt: Im Haus des Baders Göbl,
das unweit der Ulrichskirche am Bergfuß stand (Haus Schießstattgasse,
neben Aufgang zur Hilfbergstrasse), sah das etwa achtjährige
Töchterlein ein Marienbild im Brunnen. Die herbeigerufenen Eltern
konnten jedoch nicht von dem besagten Bild entdecken. Da das Kind
weiterhin fest behauptet, es zu sehen, gingen die Eltern zusammen mit
mehreren Männern der Sache auf den Grund. Zur Überraschung aller wurde
ein völlig trockenes und herrlich glänzendes Muttergottes-Bild ans
Tageslicht befördert. Es fand in einem Zimmer das Baderhauses einen
gebührenden Platz. Am nächsten Tag war es plötzlich verschwunden und
wurde in der Ulrichskirche wieder aufgefunden. Nachdem es ins Baderhaus
zurückgebracht worden war, wiederholte sich dieser seltsame Vorgang
erneut. Das Marienbild kam dann in die Abteikapelle des Klosters und
vor dort 1706 in die neue Maria-Hilf-Kirche.
Die Legende von der wundersamen Auffindung des Gnadenbildes in einem
Brunnen hat wohl ihren Ursprung darin, dass sich die Wallfahrer kaum
vorstellen konnten, dass das Maria-Hilf-Bild im Zentrum des prächtigen
Guggenbichler-Altares aus einem Bürgerhaus stammen sollte. Franz Göbl
war Wunderarzt in Innsbruck und hat vermutlich anlässlich seiner Heirat
mit einer Mondseerin das Gnadenbild hierher gebracht und dem Kloster
übergeben. Ein Votivbild im Pfarrhof weist ihn eigens als „Stifter des
Gnadenbildes“ aus. Die Familie der Göbls war eng mit dem Kloster
verbunden – ein jüngerer Bruder des Franz Göbl war unter dem Namen
Amand ins Kloster eingetreten und 1697 zum Abt gewählt worden. Er war
jener Abt Göbl, der auch die Ulrichskirche in eine Maria-Hilf-Kirche
umbauen ließ und schließlich das Gnadenbild dorthin übertrug.
* * *
Das Gnadenbild der Wallfahrtskirche Mariahilf
ist eine der zahlreichen Kopien eines Gemäldes von Lucas Cranach d. Ä.
(1472-1553), das dieser 1514 - oder nach einer anderen Überlieferung
1537 - für die Heiligkreuzkirche in Dresden geschaffen hatte. Während
der Wirren der Reformationszeit kam es in die Privatsammlung des
sächsischen Kurfürsten. Anfang des 17. Jh.s gelangte es in den Besitz
des am sächsischen Hof weilenden Passauer Fürstbischofs Leopold, der es
als Gastgeschenk mit in seine Bischofsstadt nahm. Dort war der Domdekan
Marquard von Schwendi so angetan davon, dass er eine Kopie für sich
erbat. Wundersame Ereignisse auf dem Schulerberg oberhalb Passaus
brachte er mit diesem Marienbild in Zusammenhang und gründete deshalb
1622 eine Wallfahrt, die rasch starken Zuspruch in der Bevölkerung
fand. Sie zog auch die Gründung weiterer Wallfahrten in der näheren und
weiteren Umgebung nach sich, denn der Ruf „Maria Hilf!" ging den
Gläubigen in Notzeiten und Bedrängnis leicht über die Lippen. Schon
bald wurde auch die Errettung aus Krieg und Türkengefahr, die das 17.
Jh. in Bayern und Österreich prägten, dem wundertätigen Marienbild
zugeschrieben. Das Original des Bildes gelangte später mit Leopold nach
Innsbruck und befindet sich heute im Hochaltar des Domes St. Jakob zu
Innsbruck.
Das Marienbild im Hochaltar der Mariahilfkapelle ist eine Kopie des
Innsbrucker Originals, bei dem im Unterschied zur Passauer Kopie die
untere Gewandpartie etwas kürzer ausfällt. Der wesentlichste
Unterschied jedoch ist der zarte Schleier auf dem Kopf Mariens, der
sowohl beim Innsbrucker Original als auch bei der Mondseer Kopie das
Köpfchen des Kindes mit bedeckt, aber nicht bei dem Passauer Bild. Um
ein anderes Marienbild, das sich heute in der Sakristei der
Mariahilfkapelle befindet, rankt sich folgende Legende: Die Tochter des
Mondseer Baders erblickte auf dem Grund des Hausbrunnens ein
Marienbild. Dies berichtete sie ihren Eltern, die zunächst kein Bild
erkennen konnten. Im Laufe einer nochmaligen Nachforschung barg man ein
vom Wasser völlig unbeschädigtes Marienbild aus dem Brunnen und
bewahrte es in der Stube des Baders auf. Am nächsten Morgen jedoch war
das Marienbild verschwunden und wurde schließlich in der Ulrichskirche
entdeckt. Nachdem man es in das Baderhaus zurückgebracht hatte, wurde
es am nächsten Tag abermals in der Ulrichskirche aufgefunden. Der Abt
von Mondsee, dem dies berichtet worden war, ließ es schließlich in die
Abteikapelle des Klosters bringen, wo es bis zum Umbau der
Ulrichskapelle verblieb. Die Qualität des Gemäldes lässt darauf
schließen, dass es sich um eine Votivtafel handelt, wie es sicher viele
in der Mariahilfkirche gab. Noch heute findet sich im Museum Mondsee
ein Bildnis ganz ähnlicher Gestaltung.

Die Kirche Maria Hilf ist eine wunderschöne Wallfahrtskirche mit einer
sensationellen Aussicht über das MondSeeLand. Die Hilfbergkirche am
Hilfberg ist in wenigen Gehminuten vom Marktplatz Mondsee aus zu
erreichen und vermehrt wird sie auch für Hochzeiten und Taufen gerne
besucht.

Marktplatz in Mondsee

Kriegerdenkmal für gefallene Soldaten der beiden Weltkriege

Gründungssage: Herzog Odilo
befand sich mit Gemahlin und großem Gefolge in dieser Gegend auf der
Jagd. Dabei verirrte er sich und wurde von der Nacht überrascht. Hoch
auf felsigem Gelände über dem Mondsee geriet er in höchste Gefahr
abzustürzen. Da trat plötzlich der Vollmond aus den Wolken, und der
Herzog sah vor sich in der Tiefe die Wasserfläche des Sees glänzen. Zum
Dank für seine Rettung gelobte er, am Ufer dieses Sees ein Kloster zu
errichten.

Seekapelle HI. Nepomuk - Wallfahrerkapelle
Sammel- und Besinnungsort für Pilger auf dem Weg nach St. Wolfgang, die
anschließend mit Booten über den See nach Scharfling gerudert wurden.
Bilder im Inneren: Tod des Hl. Nepomuk, Quellwunder des Hl. Wolfgang, Ermordung des Abtes Konrad II.
Die Seekapelle Hl. Nepomuk war als Wegekapelle an der ehemaligen
Hauptstraße errichtet worden und diente als Sammel- und Besinnungsort
für jene Pilger auf dem Weg nach St. Wolfgang, die anschließend das
Schiff Richtung Scharfling besteigen wollten. Die heute bestehende
Kapelle wurde zur 1000 Jahr Feier 1748 neu errichtet.
Im Inneren der Kapelle befinden sich auf drei Wandgemälden jeweils die
Schicksale des Hl. Nepomuk sowie von St. Konrad und St. Wolfgang. Links
(westlich) die Ermordung des heiligen Konrad, rechts (östlich) der
heilige Wolfgang bei der Entdeckung der Quelle, in der Mitte ist das
Bild zweigeteilt: Links die Beichte der Gräfin, rechts der Sturz des
Nepomuk von der Brücke in die Moldau. Vor diesen zwei Bildhälften steht
eine Nepomukfigur, darüber schwebt die goldene Muschel. Die Kapelle
wurde mehrmals renoviert. Die letzten Renovieren waren 1986, hier wurde
der Innenraum vom oberösterreichischen Künstler Roland Alber
überarbeitet, 2005 erfolgte die Komplettsanierung unter Alois Ebner.

Der Mondsee ist der letzte See in Österreich, wo sich der Einbaum, das
aus einem Baumstamm gehackte Boot, bis in unsere Tage erhalten hat. Das
Herstellen eines Einbaumes war keine alltägliche Angelegenheit. Dass es
etwas Bedeutungsvolles an sich hatte und in einem größeren Umkreis
beachtet wurde, geht aus dem damit verbundenen Brauchtum hervor. Der
Grund hierfür ist in der Bedeutung des Einbaumes für das Leben der
Menschen am See, der ihnen immer eine wichtige Nahrungsquelle war, zu
suchen, dann in einer unbewussten Ehrfurcht vor dem Baumriesen und
schließlich in der Tatsache, dass die Arbeit eines besonderen Könnens
bedurfte, das sich aus früheren Zeiten vererbt hatte und das nur wenige
beherrschten. Dazu wurde der Segen des Herrgotts erbeten, und dazu
gehörte geselliger und fröhlicher Brauch. Wohl durchdacht und
vorbereitet war die ganze Arbeit angelegt und geplant auf weite Sicht.
Das Herstellen des Einbaumes („Schöff“) erfolgte nach uralten,
überlieferten Formen und Arbeitsweisen und mit speziellem Werkzeug.
Als
Schiffbäume („Schöffbam“) wurden in der Regel Tannen verwendet, weil
sie dem Wasser gegenüber widerstandsfähiger sind. Es handelte sich dabei
um Baumriesen mit einer Höhe von 45 bis 53 Metern und einem Alter von
200 bis 250 Jahren. Der Mondseer Einbaum hat eine Länge von 36 Schuh
(etwas über 11 m); der Stamm musste in dieser Länge mindestens 11
Festmeter haben. Es kam vor, dass aus einem besonders schönen Schiffbaum
zwei Einbäume gehackt werden konnten. Der aus dem wipfelnäheren Teil
(dem „Spill“) gehackte war etwas kleiner. Wenn ein Stamm kernfaul
(„dalig“) oder „eisklüftig“ war, verringerte man die Länge des Einbaumes
oder eine schadhafte Stelle wurde „geflickt“. Schlechte Bäume erkannte
man am Ton, den der Stamm beim Anschlagen gab. Wer Schiffbäume besaß und
wo sie standen, war allgemein bekannt und wurde unter den Fischern
besprochen.
In Fischerhaus ist überliefert, dass einst das Bloch
in der für den Einbaum erforderlichen Menge „einen Kronentaler“
(Maria-Theresien-Taler) kostete. Als man in Gulden rechnete, verlangte
der Steininger am Irrsee für ein Einbaumbloch von 9 m3 90 Gulden. In den
Dreißigerjahren kostete das Bloch zwischen 200 und 300 Schilling. Geschlägert
wurde der Schiffbaum meist im späteren Herbst (Allerheiligenmonat),
seltener bald im Frühjahr, wenn die Bäume noch nicht im Saft sind. „Der
Mond muss im Abnehmen sein, weil dann der Saft aus dem Baum hinaus geht
und das Holz leicht wird“, sagten erfahrene Schöffhacker. Was den
genauen Zeitpunkt betrifft, richtete man sich nach den Kalenderzeichen.
Nach alter Erfahrung hängt davon die Haltbarkeit des Holzes ab.
Besonders gut ist es, wenn „drei Tage im Fisch“ sind und wichtig, dass
zum Zeitpunkt des Fällens „der Wipfel trocken ist“, das heißt, dass es
vorher nicht geregnet hat. Als gute Kalenderzeichen galten auch Löwe
Stier und Steinbock.
Beim Einbaumhacken waren in der Regel 10 bis
12 Mann am Werk. Sie standen unter der Anleitung und Vorarbeit des
„Moasters“. Ungefähr ein Drittel waren erfahrene „Schöffhacka“, die
übrigen arbeiteten in unentgeltlicher Nachbarschaftshilfe („Robot“) mit
und erhielten nur das Essen. Die verhältnismäßig große Zahl an
Arbeitenden war notwendig, weil der „Prügl“ (Einbaum im roh behauenen
Zustand) in einem raschen Arbeitsgang hergestellt und zum See gebracht
werden musste, damit es ihn nicht „zerreißt“ (dass er durch den
Austocknungsvorgang keine Sprünge bekommt). Auch wurden bei einigen
Arbeitsvorgängen viele Hände gebraucht. In der Regel wurden zwei Tage
benötigt, um den „Prügl“ im Wald auszuarbeiten. Das Fällen und das
Bringen zum See eingerechnet, waren drei Tage erforderlich.
Früh
am Tag, mitunter noch in der Nacht, wurde aufgebrochen. Beim Schiffbaum
angelangt, wurde das Tagwerk mit drei Vaterunser begonnen. Ehe es ans
Fällen ging, schlug der „Moasta“ auf der Schattenseite des Baumes ein
Stück Rinde heraus, damit man beim liegenden Baum mit Sicherheit diese
Seite erkenne, weil sie wegen des dichteren Jahreswachstums den Boden
des Einbaums bilden sollte. Zum Umschneiden wurde die „Schöffbamsag“,
eine überlange Säge, benützt. Nach alter Überlieferung wurden drei
Kreuze in den Baumstock geschlagen, „dass die armen Seelen im wilden
Gjoad darauf ausrasten können.“ Dann wurde vom „Moasta“ der „Rab
aufgrissn“ (die grobe Form in die Rinde geritzt) und der „Abraum“ (das
obere Überholz) entfernt. Wenn es gut „kliabt“ werden daraus Schindeln
gemacht. Am zweiten Tag hackte man den Innenraum aus („Kesselhacken“).
Der „Moasta“ teilte dazu die „Tiefenmaße“ aus – Stäbchen von gewisser
Länge, die angaben, wie tief hineingearbeitet werden durfte. Gearbeitet
wurde nun viel mit dem „Schöfftexel“, einer Hacke mit quergestellter
Schneide, die an den Seiten etwas rechtwinkelig aufgebogen war. Man
sprach vom „Einitexln“ und „Austexln“. Am zweiten Tag entfernte man auch
das seitliche Überholz. Am dritten Tag erhielt der Boden seine Form.
Der „Moasta“ zeichnete die Linie der äußeren Bodenkrümmung an „Gransen“
(vorne) und „Stoia“ (hinten) an. Das war eine besondere Kunst und
entschied über die Fahrtüchtigkeit des Einbaumes. Der Boden wurde nicht
eben gearbeitet, sondern etwas gewölbt („bucklat“), „sonst kann man es
nicht dersteuern“.
Das Herausschleifen aus dem Wald zu einem
Fahrweg erfolgte durch Zugtiere(Ochsen oder Pferde) mit einem Halbwagen.
Dabei wurde die mit etwas Überholz (einem „Polster“)versehene
Steuerseite nachgezogen. Der Abschluss der Arbeit im Wald und das Fahren
zum See waren mit fröhlichem Brauch verbunden. An den „Gransen“ des
„Prügls“ wurde ein geschmücktes Fichtenbäumchen (der „Boaschn“) genagelt
und die Hüte der Beteiligten und die Zugtiere geschmückt. Die Tochter
des Schiffbaumbesitzers oder ein Mädchen aus der Nachbarschaft wurde zur
„Schöffbraut“ erkoren. Am Fahrweg angelangt, nahmen die „Schöffbraut“,
der Baumbesitzer, der „Moasta“ und einige „Schöffhacker“ im „Prügl“
Platz, die anderen begleiteten die Fahrt zu Fuß. Unterwegs stärkte man
sich durch einen Trunk. Die Stimmung stieg. Es konnte sein, dass der Zug
„aufghaltn“ wurde; dazu war über den Weg eine Stange gelegt oder eine
Schnur gespannt und man musste durch eine Spende die freie Fahrt
erwirken. Kam der Zug bei einem Wirt vorbei, so wurde dieser um einen
Trunk angegangen. Am Ziel angekommen verteilte die Frau des
Einbaumbesitzers Krapfen und dazu machte wieder ein Trunk die Runde.
Alle Mitwirkenden wurden schließlich ins Haus geladen und bewirtet. Bis
in die Nacht hinein feierte man das Ereignis, meist mit Gesang und
Musizieren, mitunter auch mit Tanz.
Am anderen Tag folgte das
Versenken („Einschwarn“) des „Prügls“. Das geschah, mit Steinen
beschwert, an einer ufernahen Stelle von ungefähr 2 m Tiefe. Das
Verhinderte ein Springen des Holzes und erhöhte nach überkommener
Ansicht die Dauerhaftigkeit, („das Wasser ziagt den Saft aussa“). Auch
wird durch das Lagern im Wasser das Holz nicht mehr „schieferig“, was
zur Folge hatte, dass die Netze nicht hängenblieben.
Benötigte man
einen neuen Einbaum, was im Allgemeinen auf weite Sicht abzusehen war,
so wurde der „Prügl“ „gehoben“. Das geschah im späten Herbst, wenn die
Sonne nicht mehr so stark war. Er wurde an Land gezogen und musste den
Winter über trocknen (die Feuchtigkeit musste „aussafriern“).
Im
Frühjahr erfolgte der letzte Arbeitsgang: das „Putzen“. Damit
bezeichnete man das Fertigstellen des Einbaumes. Der „Prügl“ verlor
dabei noch ungefähr die Hälfte seiner Wand- und Bodenstärke. Im Großen
ähnelten die Arbeitsweisen jenen beim Aushacken, nur musste jetzt feiner
und behutsamer gearbeitet werden, galt es doch, die endgültige Form zu
schaffen. Bei dieser Arbeit hatten 2 bis 4 Mann ungefähr eine Woche zu
tun. Schließlich folgte die Ausstattung. Es wurden die „Joche“,
rechteckige Buchenbretter für das Halten der Ruder, aufgesetzt und zwar
eines beim „Stoia“ auf der rechten und eines beim „Gransen“ auf der
linken Seitenwand. Durch die Löcher der „Joche“wurden die „Reidn“
gezogen, kleine geflochtene Kränze aus Weide oder „Elexn“
(Traubenkirsche). Durch die „Reidn“ wurden die Ruder gezogen.Gerudert
wurde im Stehen, was eine seit Jugend auf geübte Fertigkeit verlangte.
Das
Inswasserlassen des fertigen Einbaumes war ein erwartungsvolles
Ereignis. Nun stellte sich seine Fahrtüchtigkeit heraus. Es folgte eine
kurze Probefahrt, dann fand er in der „Schöffhittn“ seinen Platz. Eine
Bewirtung der Beteiligten beschloss das Tagwerk. Am Mondsee
nannte man den Einbaum „Schöff“; dieser Name ist heute auch noch im
Gebrauch. In den alten Fischordnungen sind für den Einbaum die
Bezeichnungen „Schöff“, „Schäff“ und „Scheff“ zu finden. Der Name
„Einbaum“ dürfte hier erst gebräuchlich geworden sein, als sich die
Wissenschaft mit der Einbaumfrage zu beschäftigen begann und diese
Bezeichnung in den Zeitungen auftauchte. Die Mundart hat hier den Namen
zu „Oabam“, „Oabäumö“ sowie „Oabäumler“ abgewandelt.
Neben dieser
Normalform des Einbaumes hab es am Mondsee auch eine etwas kürzere (im
Durchschnitt um 2 m), die meist aus dem folgenden zweiten Bloch des
Schiffbaumes gefertigt wurde und die man „Nachschöff“, „Lohnschöffö“
oder „Spillschöff“ nannte. Vereinzelt kam es auch vor, dass aus einem
Schiffbaum zwei Einbäume mit der normalen Länge von 36 Schuh gehackt
wurden. In der „Tages-Post“, Linz, vom 4. Dezember 1907, wurde gemeldet:
„Der Bauer Matthias Daxinger in Innerschwand bei Mondsee fällte in
seinem Wald einen Baum von seltener Größe. Diese Rarität von einem Baum
hatte eine Länge von 136 Fuß (43 m). Am Stock beträgt der Durchmesser 62
Zoll (1,633 m). Aus diesem Baum werden zwei Einbäume gehauen, von denen
jeder 36 Fuß misst. Außerdem gibt der Baum noch drei Bloche mit je 18
Fuß Länge.“ In Erzählungen hat sich erhalten, dass beim Weinberger in
Innerschwand einmal ein Schiffbaum stand, aus dem drei Einbäume gehackt
wurden. Diesen Schiffbaum hatte eine Tochter des Weinberger als
Heiratsgut erhalten. Auf die häufige Herkunft von Schiffbäumen weisen im
Mondseeland noch die Gehöftnamen „Scheffauer“ und „Scheffbamer“ hin.
Die
meisten Schiffbäume kamen aus den Wäldern des Mondseebergrückens, des
Kolomansberges und des Saurüssels, also aus der Sandsteinzone des
Mondseelandes. Nur vereinzelt kamen sie von der Seite der Kalkberge. Als
Waldbesitzer, die häufig Schiffbäume lieferten, werden der Moar
z’Stabau, der Scheffauer und der Steininger am Irrsee genannt. Der
letzte Einbaum für den Fischermeister des Schlosses (den Nachfahren der
klösterlichen Fischermeister) kam aus dem Waldbestand des Schlosses in
der Fuchsleiten auf dem Mondseeberg.
Wenn auch der Einbaum bei
normalen See- und Windverhältnissen besonders gut auf dem Wasser lag, so
hatte er doch auch seine Tücken. Bei höherem Wellengang schlug er, wenn
man die Wellen nicht richtig anfuhr, infolge der verhältnismäßig
geringen Wandhöhe rascher voll. Es kam dann auch vor, dass er kenterte.
Den Einbaum drehte es leichter auf, weil der Boden viel Holz und damit
viel Auftriebskraft hatte. „Umgglart hats an schnell.“ Wohl ging ein
Einbaum nicht unter, sofern er nicht schwer geladen hatte, aber an einem
aufgedrehten Einbaum konnte man sich wegen seiner Form schwer
festhalten. Die Tradition des Einbaumes hat sich nur noch im
Fischenhaus (Tiefgraben 63) bis heute erhalten. In der Schiffhütte der
Fischenhauser steht der letzte Einbaum am Mondsee.
Der Einbaum spielt
auch in einzelnen Sagen aus dem Mondseeland eine Rolle. Die Sage von
den Buchelmandln, armen Seelen, die eine Buchel (Fackel aus Buchenholz)
tragend, über den See geisterten, erzählt von Fischern, die mit dem
Einbaum in der Nacht auf dem See fuhren. Einer von ihnen neckte ein
solches Buchelmandl, indem er Feuer für seine Pfeife verlangte.
Daraufhin setzte sich dieses blitzschnell neben den Fischer an das
„Stoia“ und der Einbaum begann zu sinken. Nur mit äußerster Anstrengung
erreichten die Fischer noch ihre Schiffhütte. Die Sage vom
fremden Fischer erzählt vom Teufel, der in einer Vollmondnacht in
Gestalt eines kohlschwarz gekleideten Fischers auf einem Einbaum, der
nur eine Wand hatte, gegen die Mündung des Steinerbaches fuhr. Als ihn
ein mutiger Fischer durch Zuruf zur Rede stellte, fuhr er mit dem
sonderbaren Einbaum unter Tosen und Knirschen auf die Schotterbank der
Steinerbachmündung hinauf und war plötzlich spurlos verschwunden.

Der Almeida Park ist Teil der Seepromenade von Mondsee am gleichnamigen
Gewässer. Zu seinen Attraktionen zählt eine überdachte Schautafel, die
über die Mondseekultur und die Welterbestätte „Prähistorische
Pfahlbauten um die Alpen“ erzählt. Der Park liegt direkt am Mondsee.
Besucher können von hier die Aussicht auf die nahen Berge genießen oder
mit einem Schiff einen Ausflug über den See starten. Ein Denkmal
erinnert an Micheline Gräfin von Almeida.
Die Chefin der Castello-Bar, Micheline Gräfin von Almeida, war 1911 als
Tochter von Otto Graf von Almeida und Marie-Sophie Gräfin von und zu
Arco-Zinneberg geboren worden. 1981 heiratete sie den Amerikaner
Rudolph R. Percoco, der bei den Mondseern als „Graf Rudi“ bekannt war.
Es ist mehr als 30 Jahre her, dass die Castello-Bar in Mondsee
geschlossen wurde. Sie war einmal etwas Besonderes, das kann man so
sagen. Promi-Gäste, die sich an den Kochkünsten der Micheline „Misch“
Almeida erfreuten. Saucen, die Greta Garbo so sehr liebte, Schnecken
mit Champignons sollen eine Leibspeise von Herbert von Karajan gewesen
sein, und Curd Jürgens lobte ihren Tafelspitz mit Apfelkren über alle
Maßen. Es gab Zeiten, da gaben sich die Promis in der Mondseer
Castello-Bar die Klinke in die Hand.

Die Ziehrer Ruhe ist ein wunderschöner Ruheplatz, an welchem Carl Michael Ziehrer einige seiner Werke geschrieben hat.
Ziehrer Ruhe
1897 bis 1906 verbrachte Carl Michael Ziehrer einen Teil des Sommers in
Mondsee. Er wohnte in der Villa Remmelberger (ehem. Käserei Nussbaumer)
und am Hilfberg in der Villa Franz. Nach seiner jahrelangen
Dirigententätigkeiten, seinen anstrengenden Konzertreisen nach USA,
Deutschland und Ungarn genoss er die Ruhe und die Naturschönheit. Schon
bald war Zierer in Mondsee heimisch geworden, und täglich sah man ihn
zum See hinunterwandern, wo er glückliche Stunden im seligen Genießen
des märchenschönen Landschaftsbildes verträumte. Er liebte es,
bisweilen allein zu sein um zu komponieren. Doch die Bevölkerung von
Mondsee war so im Banne seiner liebenswürdigen und herzbezwingenden
Persönlichkeit, sodass ihm alle nahe sein wollten. Da wurde er eines
Tages der Fürstin Wrede, der Besitzerin der Herrschaft Mondsee,
vorgestellt, welche ihn kennen zu lernen wünschte. Auf ihre Frage, wie
ihm Mondsee gefalle, gab er seiner Begeisterung Ausdruck, aber auch
seinem Bedauern, kein Platzerl am See für sich alleine zu haben. So war
seine Freude groß, als er ein paar Tage später, dicht am Seeufer, unter
schattigen Ulmen, zwei Bänke und einen Tisch zu seiner alleinigen
Benützung vorfand, welche die Fürstin als Aufmerksamkeit für den
Künstler auf ihrem Territorium hatte aufstellen lassen, und nicht
lange, und eine schöne Tafel bezeichnete diese Stelle als
„Ziehrer-Ruhe“. An dieser Stelle nahmen Melodien aus „Die
Landstreicher“ und „Drei Wünsche“ ihren Ursprung.

Hl. Judas Thaddäus Kapelle - Sie ist eine der jüngeren Kapellen im Gebiet. Mit der Schenkung
von Grundstücken am See an die Marktgemeinde Mondsee im Juni 1987
verband Graf Rudolph Almeida die Bedingung, den Park „Graf Rudolph und
Gräfin Micheline Almeida-Park“ zu bezeichnen und das Recht, auf dem
Grund eine Kapelle zu errichten, die dem hl. Judas Thaddäus gewidmet
ist, diese für immerwährende Zeiten zu erhalten, sowie die laufende
Instandhaltung zu übernehmen und für elektrisches Licht in der Kapelle
zu sorgen. Die Kosten für die Errichtung der Kapelle sollte zur Hälfte
die Marktgemeinde Mondsee, zur Hälfte Graf Rudolph Almeida tragen.
Mit der Planung der Judas Thaddäus-Kapelle wurde Baumeister
Walter Schragner beauftragt. Er berichtete, dass Graf Rudolph den
Heiligen sehr verehrte. Sein Ausspruch war: „Wenn es dir schlecht geht,
wende dich an den heiligen Thaddäus. Er erhört dich und hilft dir ganz
bestimmt.“ Die Kapelle in Mondsee sollte der Hochzeitskapelle in
Hellbrunn nachgebildet sein. Aus den verschiedenen Vorschlägen für die
Gestaltung der Kapelle, die Baumeister Schragner vorlegte, wurde der
Entwurf vom 6. 6. 1988 angenommen. Mit dem Bau waren ausschließlich
Mondseer Firmen beauftragt. Am 11. 8.
1989 wurde zur feierlichen Einweihung geladen. Die Weihe nahm
Generalvikar Prälat Josef Ahamer gemeinsam mit Dechant Josef Edlinger
vor, Festansprachen hielten Bezirkshauptmann Landl, Bürgermeister Mörtl.
Die Bürgermusik Mondsee umrahmte die Feier.
Die Judas
Thaddäus-Kapelle soll für alle Zeiten das Andenken an die Grafenfamilie
Almeida wahren, die viele Jahre lang das „Schloss Mondsee“, große
Landflächen und weitere Höfe im Gebiet besaß. So erinnert die Inschrift
an:
Graf Otto Almeida, Gräfin Marie Sophie Almeida, Graf Paul Almeida
Graf Ludwig Almeida, Gräfin Micheline Almeida, Graf Rudolf Almeida.

Friedrich Ludwig Jahn-Denkmal
zum 150. Geburtstage, Turnverein Mondsee, 1920

Die Seepromenade Mondsee lädt zum Spazieren und Flanieren ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: