web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Murau
in der Obersteiermark, August 2024
Murau ist eine Stadt in der Obersteiermark im
Bundesland Steiermark in Österreich mit knapp 3400 Einwohnern. Sie ist
Verwaltungssitz des Bezirkes Murau. Das Gebiet wurde schon in der
Bronze- und Römerzeit besiedelt, erstmals urkundlich erwähnt wurde
Murau im Jahr 1250 als Murowe (Bedeutung ‚Aue an der Mur‘), das
Stadtrecht wurde im Jahre 1298 verliehen.

Mursteg Murau
Aus der Frühzeit der Holzstraßenidee stammt der Mursteg Murau. Nach
einer internationalen Ausschreibung 1993 kam der Plan der Schweizer
Architekten Meili und Peter zur Umsetzung. Die für den Fußverkehr
errichtete Brücke verbindet den Bahnhof mit dem östlichen Teil der
Stadt und wurde 1995 pünktlich zur Landesausstellung „Holzzeit"
fertiggestellt.

An mehreren Standorten in der Murauer Altstadt und an der Murpromenade
laden Skulpturen zu einem Spaziergang ein, bei dem Sie mehr über Murau
erfahren.
Xenia - die Katzengöttin
Katzen haben viele Gesichter, sind allen Dingen gegenüber aufmerksam und sehr erdverbunden.
Die Figur der XENIA stellt einen weiteren Bezug zum Katzensaal im
Schloss Murau her. Sie trägt zum Zeichen ihrer Würde und Natur eine
Katzenmaske mit zwei Köpfen. Der lange Haarzopf und die Körperhaltung
verdeutlichen ihre Erdverbundenheit und ihre Aufmerksamkeit. Der Name
bedeutet im Griechischen sowohl „die Gastfreundliche" als auch „die
Fremde", was wiederum „Gast" und „Gastgeber" eine gemeinsame Bedeutung
gibt.

Murpromenade Holzveranden, Murau
Ein Spaziergang auf der Murpromenade, die zwischen 1978 und 1985
angelegt wurde, zeigt die unterschiedlichen Facetten der Stadt. Von
hier sind die hölzernen Veranden der alten Bürgerhäuser zu sehen,
weiter östlich öffnet sich der Blick auf die Flussgöttin Murna und auf
moderne Konstruktionen wie das Open Space oder das Gebäude der BH
Murau. Hier wird der Weg, der vom Raffaltplatz zum Schillerplatz führt,
breiter und ist von Kunstwerken gesäumt.

Das Gebiet von Murau war vom 13. bis ins 15. Jahrhundert das Zentrum
des Herrschaftsgebietes der steirischen Adelsfamilie Liechtenstein.
Diese Familie war eine eigenständige Familie, die unabhängig von der
gleichnamigen Familie Liechtenstein aus Niederösterreich entstanden
war. Der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein, der auf der Frauenburg
bei Unzmarkt lebte, stammt aus der steirischen Familie. Der Name dieser
Familie wird von der Burg Liechtenstein östlich von Judenburg
abgeleitet.

Murna - die junge Flussgöttin
Flüsse werden als Lebensspender meistens weiblich dargestellt, als
Transport- und Reisemittel benutzt, womit Informationsaustausch
verbunden war und ist. Die Figur einer jungen MURNA (keltische Göttin)
soll genau an dieser Stelle die Kraft der Mur zähmen, die Fruchtbarkeit
der Stadt symbolisieren und in die Welt hinaustragen. Mit dem Zeichen
für Energie als Gabe (Blitz in der Hand) und dem wilden Hopfen (als das
zu Bewahrende), der sich um ihren Körper rankt, thront sie mitten in
der Mur. Eine ältere" Murna ist Bestandteil des Brunnens am Hauptplatz
in Graz.

Das steirische Landgericht der Familie Liechtenstein an der Mur wurde
1256 erstmals in Urkunden erwähnt. Es umfasste das Murtal von der
Salzburger Grenze zum Lungau bis nach Teufenbach im Osten. 1574 kaufe
Anna Neumann die Herrschaft Murau. 1617 heiratete die 81-jährige Anna
Neumann den 31-jährigen Reichsgrafen Georg Ludwig von Schwarzenberg.
Seit damals gehört das Schloss den Schwarzenbergs, die bis heute im
Schloss ansässig sind.

Das ehemalige Rathaus war ein Wehrturm der Stadtummauerung. Von
1574-1578 diente das Haus als Bürgerarsenalwehrturm, danach wurde es
durch Andre Durmsaller zum Rathaus umgebaut. Um 1740-1742 erfolgte ein
neuerlicher größerer Umbau. 1879 wurde das Rathaus an Josef
Mitteregger, Eisenwarenhändler, versteigert. In den folgenden Jahren
ging ein Teil des noch an Ort und Stelle verbliebenen Stadtarchivs
zugrunde. 1920 nimmt die Stadtgemeinde im Tauschwege wiederum diesen
Bau als Rathaus in Verwendung. In den Jahren 1925/26 wurde der Bau
neuerlich verändert. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Römersteine
eingemauert.
Besonderheiten: An der Südfassade befindet sich eine aufgemalte
Sonnenuhr mit Gottvater und Weltkugel, daneben Engel, die das
Pantherwappen (links) und das Murauer Stadtwappen (rechts) halten.
Darunter die Inschrift: Rathaus renov. 1925. Die Sonnenuhr ist eine
Malerei mit barocken Formen und wurde 1925 erneuert.

Innenstadt von Murau

St. Elisabeth-Spitalskirche
1457 Kirche erstmals genannt, Turm und Sakristei gotisch, ursprüngl.
Eingang mit Renaissanceportal im Hof, seit 1979 evangelische Kirche und
Diözesanmuseum
Die Evangelische Elisabethkirche in Murau ist das geistige Zentrum der
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Murau-Lungau, Evangelische
Superintendentur A. B. Steiermark. Die Pfarrgemeinde umfasst neben dem
politischen steirischen Bezirk Murau auch den salzburgischen Lungau.

Die Kirche, stadtseitig bei der Marktbrücke gelegen, wurde als
Spitalskirche der heiligen Elisabeth 1329 erstmals urkundlich erwähnt
und im 17. Jahrhundert umgestaltet. Vom Einsetzen der Reformation um
etwa 1528 bis zur Gegenreformation und zur Vertreibung der Protestanten
1599 war sie eine evangelische Kirche. Unter Kaiser Joseph II. wurde
sie 1789 profaniert und versteigert. 1923 wurde ein hölzerner Fußboden
eingezogen und das Bauwerk bis 1975 als Turnsaal und bis 1977 als
Tischtennishalle verwendet.
Der frühbarocke dreijochige Saalraum stammt aus der Zeit von 1628 bis
1644. Im Osten sind am Turm und in der Sakristei noch gotische Bauteile
der Vorgängerkirche erhalten, wie auch die hohen, schmalen
Spitzbogenfenster in der Südwand des Kirchenschiffs. Das Schiff hat ein
Tonnengewölbe auf Wandpfeilern mit Stichkappen und Stuckfeldern mit
Perl- und Eierstabrahmen aus der Zeit um 1640, Giuseppe Pazarino
zugeschrieben. Der an der Nordostecke eingestellte Turm hat gekuppelte
Rndbogenschallfenster und eine barocke Haube. Die Sakristei in der
Südostecke hat ein gotisches Südfenster und ein schweres
Kreuzrippengewölbe mit einer Blattrosette als Schlussstein. An
Ausstattung enthält die Kirche einen klassizistischen Kanzelaltar, ein
Kirchengestühl, eine kleine transportable Orgel und einige kleinere
Kunstwerke.

Murauer Schanzenkessel hinter dem Freibad Murau

Blick auf Murau

St. Elisabeth-Spitalskirche

Schloss Murau und Stadtpfarrkirche hl. Matthäus

Rosalia-Grotte


Filialkirche St. Leonhard
Spätgotisches Bauwerk aus der 1. Hälfte des 15.Jh., ehem. Wallfahrtskirche

Die Leonhardikirche ist Teil der Burganlage Grünfels in Murau und wurde
1439 erstmals erwähnt. Sie ist im sehr schlanken und hohen
spätgotischen Stil erbaut und besitzt kunstvolle Schlusssteine.
Westlich davon liegt die Heiligengrabkapelle mit der Kreuzigungsgruppe.
Der Burgberg Grünfels mit der Leonhardikirche ist ein kunstvoller
Kalvarienberg mit allen Kreuzwegstationen.

Leider war das Gotteshaus am Anreisetag versperrt und somit nicht betretbar.


Hl.Grabkapelle 1680 errichtet


dahinter: Kalvarienberg-Kapelle als Abschluß der Kreuzweganlage


St. Leonhardkirche, Murau
Die Wallfahrtskirche Sankt Leonhard, von den Einheimischen
„Leonhardikirche" genannt, thront auf einer Anhöhe nahe der Burgruine
Grünfels. Die spätgotische, schlanke und hochaufstrebende Kirche ist
nahezu im Original erhalten und wird von einer Wehranlage eingefasst.
Besonders bemerkenswert sind die drei Heiligenfiguren aus Lindenholz,
die vom ehemaligen gotischen Hochaltar erhalten geblieben sind: Georg,
der Drachentöter, Florian mit Wasserschaff und Eustachius mit Rüstung
und Lanze.

Schloss Murau und Stadtpfarrkirche hl. Matthäus

Holztüren, Murau
Genauso geschichtsträchtig wie die Häuser der historischen Altstadt
sind ihre Holztüren. Sie gehen teilweise bis in die Zeit von Anna
Neumann (1535-1623) zurück, die als „Herrin von Murau“ die Stadt
maßgeblich geprägt hat. Die Türen sind vor allem kunsthistorisch
interessant und noch immer voll in Funktion. Damit verbinden sie nicht
nur das Innen und das Außen, sondern auch Geschichte und Gegenwart.

Inmitten des Schillerplatzes steht heute die barocke Pestvotivgruppe.
In pyramidenartig ansteigender Komposition, die Vorderseite hin zur
Kirche gerichtet. Die Mariensäule steht auf einem mit niederem,
schmiedeeisernen Gitter umgrenzten Sechseckplatz auf hohem Sockel. Auf
einem einer Rundsäule ist die Statue der Hl. Maria Immaculata
errichtet. In den Ecken stehen die sechs Pestheiligen. Die Mariensäule
wurde anlässlich der Umbauarbeiten des Schillerplatzes nicht verändert.
Es wurden jedoch die Pestheiligen wieder aufgestellt und das
schmiedeeiserne Gitter saniert.

Schloss Murau via Fußweg erklommen

Schloss Murau - Baugeschichte (1628-1643)
Georg Ludwig Reichsgraf zu Schwarzenberg ließ nach dem Ableben seiner
Ehefrau Anna, geborene Neumanin von Wasserleonburg, die alte
Liechtensteinische Burg schleifen und an deren Stelle in den Jahren
1628 bis 1643 das heutige Schloss errichten. Dieses bildete mit der
Burg Grünfels am rechten Murufer eine Talsperre zur Kontrolle der
Handelswege.
Der Baumeister Valentin Kaut, der Steinmetzmeister Hans Dirolf aus
Markt Bibart und der Zimmerermeister Michael Pockh sowie der Tischler
Peter Rieberer kamen aus Mittelfranken, also aus jenem Gebiet, aus dem
auch der neue Schlossherr kam. Im ersten Obergeschoß sind
Kassettendecken und sogenannte Rimlingsböden eingebaut. Die vier
Stuckdecken im zweiten Obergeschoß und in der Schlosskapelle schuf der
Stuckateur Giuseppe Pazarino aus Mailand, Italien. Beim Murauer
Schlossbau wirkten somit deutsche und italienische Fachkräfte mit!
In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gab es in der Steiermark keine
Kriegsschauplätze, so dass ein Schlossbau möglich war. Das Schloss ist
ein Vierflügelbau mit Arkaden im Innenhof, verfügt über zwei
Mittelrisalite mit für Österreich unüblichen Verzierungen. An der
Außenseite sind im Westen ein Mittelrisalit und im Osten ein
halbkreisförmiger Vorbau für die Apsis der Achatius-Kapelle. Diese
Stile erinnern an italienische und deutsche Renaissance und an
frühbarocke Paläste. Es ist dies ein unüblicher Baustil in der
steirischen Kunstgeschichte, das mit der Julius-Architektur begründet
wird. Das Schloss Murau hat diesbezüglich eine einzigartige Stellung.
Dass in der Schlosskapelle gotische Fenster zu sehen sind, wird auch
mit dem Julius-Echter-Stil begründet.
Vater Georg und Bruder Michael des Baumeisters Valentin Kaut waren
Würzburgische Stiftsbaumeister. Julius Echter von Mespelbrunn war von
1573-1617 Fürstbischof in Würzburg und pflegte einen eigenwilligen
Bauherrnstil,
also auch eine Mischung aus Gotik, Renaissance und Frühbarock. Er ließ
in Würzburg das Juliusspital und die alte Universität erbauen sowie die
Festung Marienberg umbauen und erneuern. Der Fürstbischof Julius Echter
war 1616 bei der Weihe der Schlosskirche in Stammschloss
Schwarzenberg/Mittelfranken anwesend und war mit dem damaligen Grafen
Wolfgang Jakob zu Schwarzenberg befreundet. So kam dieser Julius-Stil
durch den Grafen Georg Ludwig auch in Murau zur Anwendung.

Schloss Obermurau ist eine auf dem Schlossberg von Murau errichtete Schlossanlage. Es liegt in der Obersteiermark in Österreich.

Ulrich von Liechtenstein, bekannt als Minnesänger, erbaute um 1232 die
erste Burg auf dem Murauer Schlossberg. Im Krieg zwischen dem Hause
Habsburg und dem böhmischen König Přemysl Ottokar II. 1276–1278 wurde
die Burg zerstört. Anschließend wurde sie durch Ulrichs Sohn Otto von
Liechtenstein wieder aufgebaut.

Christoph von Liechtenstein war mit der Kaufmannstochter Anna Neumann
von Wasserleonburg (25. November 1535 bis 18. Dezember 1623; ihre
zweite Ehe) verheiratet, die nach ihrer Heirat das Anwesen von den
Geschwistern ihres Mannes kaufte und als Herrin ein halbes Jahrhundert
im alten Schloß Liechtenstein zu Murau wohnte. Als er 1580 starb,
ging die Herrschaft Murau an die Witwe über. Sie ist eine der
bedeutenden Figuren der Murauer Stadtgeschichte. Als 81-Jährige
heiratete sie im Jahr 1617 in ihrer sechsten Ehe den damals 31-jährigen
Reichsgrafen Georg Ludwig von Schwarzenberg – wobei die Ehe wohl im
Sinne einer Adoption im Hinblick auf zukünftige Beerbung geschlossen
wurde (zwei Kinder der „Neumannin“ waren vor ihr und kinderlos
gestorben, sie selbst also ohne Nachkommen). Nach dem Tod seiner
Gemahlin im Jahr 1623 ließ Graf Georg Ludwig die alte Burg abtragen und
in den Jahren 1628 bis 1643 das vierkantige, um einen Arkadenhof
gelegene Renaissanceschloss erbauen.

Als diese Gewehre wurden angeblich Wilderern abgenommen - also Eigentumsentzug.

Das Schloss Obermurau verblieb bis in die heutige Zeit im Eigentum des
im Jahr 1670 vom Kaiser Leopold I. in den Reichsfürstenstand erhobenen
Hauses Schwarzenberg. Heute befindet sich im Schloss neben Privaträumen auch die
Forstverwaltung der Familie Schwarzenberg. Allein rund um Murau
gehören 18.000 ha Waldfläche zum Besitz der Schwarzenberger,
insgesamt sind es 19.000 ha.

Die fürstlichen Linien des Hauses Schwarzenberg seit
Johann I., 5. Fürst zu Schwarzenberg, 1742-1789
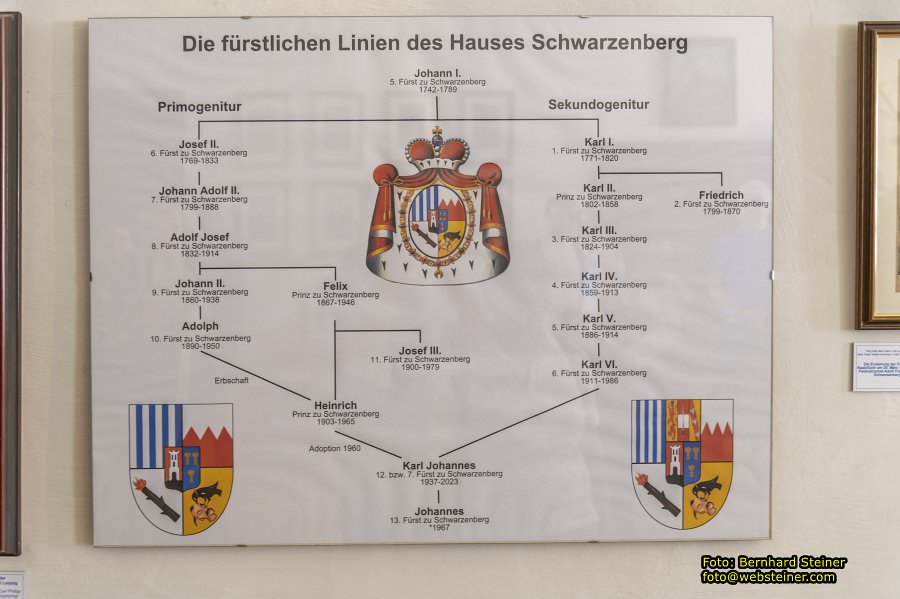

Protokollum über die im Lungau, Salzburger Land gelegenen Lehen-Stücke,
welche zur Hochfürstlich Schwarzenberg'schen Fideikommiss- Herrschaft
Murau gehörig sind vom Jahr 1742.
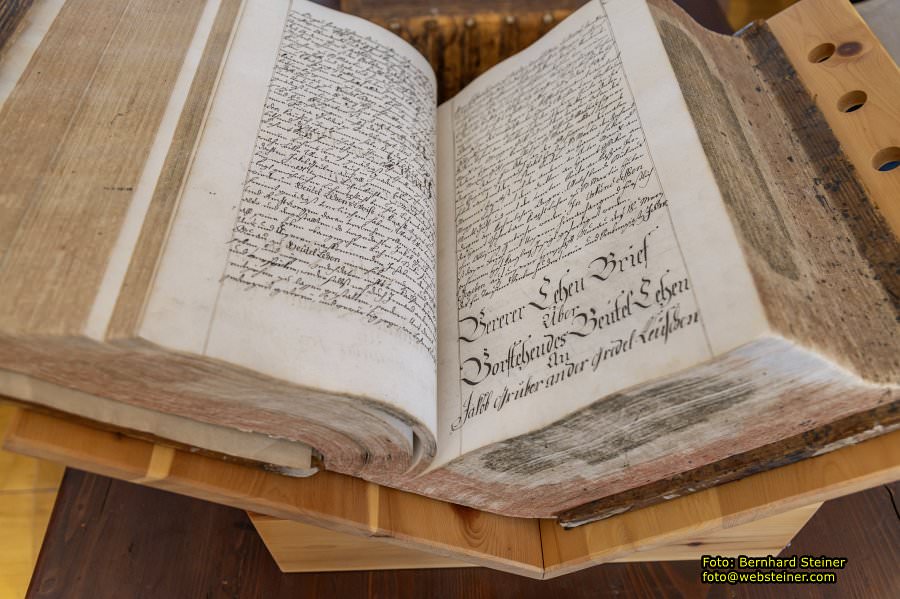


Die Prunkräume mit dem Katzensaal erstrecken sich im zweiten
Obergeschoß des Südtraktes sowie im südlichen Teil des Osttraktes. Sie
sind museal eingerichtet und weisen durchwegs Flachdecken mit
Stuckverzierungen auf, die großteils von Giuseppe Pazarino 1641
angefertigt wurden.

Fecht- und Kampfunterricht der Katzen, 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt
Austreibung und verschiedene Kuren an Hunden durch Katzen, 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt
Die aus vier Bildern bestehende Serie ist erstmals im Inventarverzeichnis des Schlosses Katsch vom Jahr 1694 angeführt.

Die Tapisserien der Serie„Decius Mus"
Sie stellen Episoden aus dem Latinischen Krieg im Jahr 340 v. Chr. dar,
wie sie der römische Geschichtsschreiber Livius (59 v. Chr. - 17 n.
Chr.) im Achten Buch seiner Römischen Geschichte beschreibt.
Rom wurde um 750 v. Chr. gegründet, bis 510 v. Chr. herrschen sieben
Könige. Nach dem Sturz des letzten Königs wurde das Königreich Rom zur
Römischen Republik. An Stelle des Königs treten in der Republik zwei
jährlich wechselnde Konsuln. Im Jahr 340 v. Chr. waren dies die Konsuln
Titus Manlius Torquatus und Publius Decius Mus.
Die Latiner befürchteten, dass die Rolle Roms im ursprünglich auf
Gleichberechtigung angelegten Latinischen Bund allzu dominierend werden
würde. So sprach eine Gesandtschaft der Latiner im Capitol vor und
forderte die Hälfte des Senats und dass zukünftig ein Konsul von den
Römern und ein Konsul von den Latinern gestellt werden soll. Rom wies
diese Gesandtschaft zurück, es kam zum Krieg.

Die Tapisserien der Fürstlich Schwarzenberg'schen Kunststiftung Vaduz
Laut einer Eintragung im Inventarbuch befinden sich die Tapisserien seit dem Jahr 1656 im Besitz der Familie Schwarzenberg.
Entstehung der Tapisserien
Tapisserien sind gewebte Bilder. Sie wurden meist aus Wolle und Seide,
nicht selten auch aus Gold- und Silberfäden gefertigt und waren
ausgesprochene Luxusgüter, die sich nur sehr Wohlhabende leisten
konnten.
Als Vorlagen für die Motive dienten nicht selten Ölgemälde. Im Falle
der hier ausgestellten Tapisserien stammen die Vorlagen - die
sogenannten Kartons - von dem berühmten Barockmaler Peter Paul Rubens,
gefertigt in den Jahren 1616/17. Die prächtigen Ölbilder sind
Bestandteil der Kunstsammlungen der Fürsten von und zu Liechtenstein.
Nach diesen Vorlagen sind mehrere Serien von Tapisserien in
verschiedenen Wirkereien angefertigt worden. Die hier aus- gestellten
Tapisserien wurden Mitte des 17. Jahrhunderts in zwei Brüsseler
Werkstätten hergestellt:
• Jan van Leefdael
• Geraet van der Strecken
Die Signaturen am unteren Rand der Tapisserien zeigen das Monogramm des
Herstellers und enthalten die Brüsseler Stadtmarke. Betrachtet man die
Gemälde bzw. die Kartons und die Tapisserien nebeneinander, so fällt
auf, dass die Darstellung seitenverkehrt ist. Diese Tatsache ergibt
sich, weil die Vorlage unter die Kettfäden gelegt bzw. beim
Hochwebstuhl hinter den Kettfäden angebracht wurde. Meist arbeiteten
mehrere Wirker gleichzeitig nebeneinander an einem Teppich. Das
Einflechten der Schußfäden erfolgte mit Hilfe von Spulen, wobei jede
Spule den Faden einer Farbe trägt. Wenn eine Farbfläche zu Ende war,
schnitt man den Faden ab und ließ das Ende herunterhängen. So ergibt es
sich, dass auf der dem Wirker zugewandten Seite die Enden der Fäden zu
sehen sind und dann die Rückseite zur Schauseite wird - demzufolge
spiegelverkehrt.

Noch im frühen Mittelalter brannte fast überall ein offenes Feuer
inmitten des Hauses auf einer niedrigen Erhöhung aus gestampftem Lehm
oder in einer mit Steinen eingefassten Vertiefung. Über der Feuerstelle
befand sich der Funkenfang, ein flaches Dach aus Holz oder einer großen
Tierhaut, das die Funken daran hindern sollte ins häufig strohgedeckte
Dach zu geraten und dort Unheil anzurichten. Der Funkenfang diente
gleichzeitig dazu, Würste aus Grütze, Fisch und Fleisch zu räuchern und
damit haltbar zu machen, und zum Trocknen von Kräutern, Pilzen und
Beeren.
Erst im Laufe des späten Mittelalters und auch da hauptsächlich in
Klöstern und Burgen, beim Adel und in großen Bürgerhäusern, entstanden
regelrechte Küchen, deren Mittelpunkt ein gemauerter Herd mit festem
Abzug war, über dem eiserne Ketten und Kochtöpfe unterschiedlichster
Formen und Größen hingen. Daneben befanden sich Bratspieße und -roste,
zuweilen auch ein Schild aus Holz, der die Köchin und ihre Helfer vor
der Hitze des Feuers schützte. Grapen, dreibeinige Töpfe aus Ton oder
Metall, standen bereit, um den Inhalt sanft über oder neben der Glut zu
köcheln. Auf großen Tafeln konnten die Speisen zum Servieren
vorbereitet werden, und zuweilen gab es fest gemauerte Becken zum
Waschen oder zum Aufbewahren lebender Fische. In der Kühle dunkler
Erdkeller und steinerner Gewölbe lagerten verderbliche Speisen wie
Wurzelgemüse und Obst, eingelegtes Kraut und Wein.


Der Schlosshof wird an der Nord-, West- und Südseite von
Erdgeschoßarkaden begrenzt. In seinem Nordteil befindet sich ein 48 m
tiefer Brunnen. Auf den Risaliten sind zweigeschossige Giebel
aufgesetzt. Das Portal mit der Schlosseinfahrt liegt im südlichen Teil
des Osttraktes. Anschließend befinden sich die Räume des
Schwarzenberg-Archives, die mit Tonnen und Stichkappen überwölbt sind.
Die Archivschränke des 17. Jh. sind noch vorhanden. Der ebenerdige Raum
in der Südwestecke mit seiner achteckigen Mittelsäule und den vier
Kreuzgratgewölben wurde später durch eine Zwischenmauer geteilt. Die
meisten Innenräume dienen heute als Büros und Wohnungen.

Die Mitte des Ostflügels wird von der dreigeschossigen frühbarocken
Schlosskapelle dominiert. Sie wurde 1366 erstmals urkundlich erwähnt
und 1628 in der heutigen Form erneuert. Ihre Apsis tritt als hoher
Zylinder an der Außenmauer halbkreisförmig vor. Auch an der Hofseite
springt sie risalitartig vor. Ihr Portal wurde 1643 von Christoph
Hollstainer geschaffen. Hinter ihrem Giebel ist ein kleines Türmchen
eingebaut, in dem sich die Schlossglocke befindet.

Der Innenraum ist mit Rahmenstuck, allerdings ohne die dafür geplanten
Gemälde, geschmückt. Die Stuckierung erfolgte durch Giuseppe Pazarino
um 1640. Der dreigeschossige frühbarocke Hauptaltar zeigt im Gemälde
den Hl. Achatius. Er entstammt der Judenburger Werkstatt aus der Zeit
um 1655. Bemerkenswert ist der Totenschild des Carl Freiherrn von
Teuffenbach (gest. 1610).

Blick vom Schloss Murau über den Schlossgarten auf die Stadtpfarrkirche hl. Matthäus und Wallfahrtskirche St. Leonhard

Schlossstiege, Murau
Über 214 Stufen gelangt man vom Schillerplatz zur Stadtpfarrkirche und
weiter zum Schloss Murau. Die Treppe ist die kürzeste Verbindung
zwischen Stadt und Schloss. Schon bevor das Renaissanceschloss in
seiner heutigen Form im 17. Jhd. errichtet wurde, bestand hier eine
Treppe. 1848 wurde sie neu errichtet und mit gusseisernen Schindeln aus
Turrach gedeckt. 1980 wurde sie erneuert, wobei die Eisenschindeln
durch solche aus Kupfer ersetzt wurden.

Pfarrkirche St.Matthäus, Frühgotische Kreuzbasilika mit steingemauertem Vierungsturm, 1296 eingeweiht
Gotische Lichtsäule aus der Mitte des 15.Jh. Der Kirchenbau steht auf halber Höhe des südlichen Schlosshanges und ist von einer alten Kirchhofmauer umgeben.

Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche Murau steht in der
Stadtgemeinde Murau im Bezirk Murau in der Steiermark. Die auf den
Evangelisten Matthäus gewidmete Pfarrkirche gehört zum Dekanat Murau in
der Diözese Graz-Seckau. Die Kirche wurde 1284 von Freiherr Otto I. von
Liechtenstein gestiftet und von dessen Sohn Otto II weitergeführt und
1296 vom Bischof von Lavant geweiht. 1333 wurde die Kirche zur
Pfarrkirche erhoben. 1640 wurden in den zwei Winkeln zwischen Ostjoch
der Seitenschiffe und den Querarmen Kapellen angebaut.

Bemerkenswert sind vor allem die barocke Kanzel, der Hochaltar sowie
Fresken aus dem 14. Jahrhundert und evangelische Wandmalereien der
Renaissancezeit, der hölzerne zwölfarmige Apostelleuchter, das wuchtige
Taufbecken, der Rosenkranzaltar und die Kreuzigungsgruppe.

Die bedeutende frühgotische Pfeilerbasilika mit einem Vierungsturm und
Querarmen wurde einheitlich aus gelbem Tuffstein in langsamer
Progression von Westen nach Osten erbaut. Das dreischiffige vierjochige
basilikale Langhaus hat ein hohes Mittelschiff mit Lichtgaden mit
Spitzbogenfenstern. Das Mittelschiff ist zu den Seitenschiffen mit
Spitzbogenarkaden auf gedrungenen Achteckpfeilern geöffnet und
verbunden. Das Langhaus hat Kreuzgratgewölbe, wobei die Joche mit
Gurtrippen auf unterschiedlich geformten Konsolen getrennt sind. Die
Kapellenanbauten an den beiden Ostjochen der Seitenschiffe zeigen sich
in reicher Stuckzier und Malereien.

Die um zwei Stufen höher gesetzte Vierung ist durch kräftige Gurtbögen
mit einer aufgelegten profilierten Rippe sowie durch Vierungspfeiler
mit vorgelegten Dreiviertelkreisdiensten betont. Das Querhaus hat je
Seite ein Joch. Vierung und Querhaus haben Kreuzrippengewölbe mit
runden Schlusssteinen, in der Vierung mit Segenshand, im Nordarm mit
dem Wappen der Liechtenstein, im Südarm mit einer Blütenrosette. Das
Querhaus hat nördlich und südlich ein besonders hohes und schmales
Lanzettfenster. Am nördlichen Querarm ist eine aus einem Achteck
entwickelte Spindeltreppe angebaut und mit 1469 datiert. Ebendort ist
ein gotisches Friesband. Unter dem nördlichen Querarm befindet sich die
Gruft der Liechtenstein.

Die Murauer Stadtpfarrkirche gehört zu den frühesten und
interessantesten gotischen Sakralbauten der Steiermark. Sie geht zurück
auf die Gründung Ottos II. von Liechtenstein, des damaligen Grundherrn
von Murau. Der Bau wurde 1284 oberhalb der Stadt, auf halber Höhe des
Schlossberg-Südhanges, begonnen. Im Jahre 1296 fand zwar die Weihe zu
Ehren des hl. Matthäus statt, die endgültige Vollendung des Baues zog
sich allerdings noch einige Jahre hin. 1311 berichtet das Testament des
Stifters, dass zu diesem Zeitpunkt der Kirchenbau, eine Kreuzbasilika
mit hochstrebendem Chor und schwerem, steinernem Vierungsturm, noch
nicht ganz vollendet war. Zubauten der Spätgotik und Anbauten aus der
ersten Hälfte des 17. Jhs. - als nach dem Aussterben des Hauses
Liechtenstein-Murau die Herrschaft an das Haus der späteren Fürsten
Schwarzenberg überging - sind Zeugen von Bauveränderungen und
Ergänzungen, die jedoch den Grundcharakter des frühgotischen Baues
keineswegs änderten.
Von 1939 bis 1947 erfolgte die Innenrestaurierung der Kirche mit der
Freilegung zahlreicher Fresken. Eine Außenrenovierung wurde 1971
vorgenommen, und im Jahre 1985 konnte die Restaurierung des
Kircheninneren abgeschlossen werden, wobei die alte Liechtenstein-Gruft
unter dem nördlichen Querschiff freigelegt wurde. Außerdem kam damals
ein neuer steinerner Volksaltar zur Aufstellung.

Die historische Orgel ist besonders umfangreich und wertvoll. Das
Instrument wurde 1698 von dem Orgelbauer Meyenburg erbaut und ist
weitgehend erhalten. Es hat 17 Register auf zwei Manualen und Pedal.

Fußgängerbrücke über den Rantenbach

Friedhofskirche St. Anna - Hochgotischer Bau um 1400 mit beachtenswerten Fresken, mittelalterl. Glasfenstern und spätgotischem Flügelaltar.
Leider war dieses Gotteshaus am Anreisetag versperrt und somit nicht betretbar.
St. Annakirche, Murau
Ein Diebstahl gab den Anlass zum Bau der Kirche, genauer gesagt ein
Hostiendiebstahl. An der Stelle, an der man die liturgische Speise
wiederfand, wurde sie um 1400 errichtet. Besonders bemerkenswert ist
die gotische Annaselbdritt-Darstellung aus Lindenholz aus dem 15. Jhd.
Die Kanzel und die Kirchenbänke mit den geschnitzten Wangen stammen aus
dem 17. Jhd. Da die Kirche vom Friedhof umgeben ist, trägt sie den
Beinamen „Friedhofskirche“.

Handwerksmuseum
Seit 1975 im ehemaligen Kapuzinerkloster unter- gebracht, zeigt das
Museum eine reichhaltige Sammlung an regionalgeschichtlich
interessanten Objekten und es fungiert als Wissensspeicher der
Stadtgeschichte.
Leider konnte der geplante Besuch nicht stattfinden, da das Museum am Anreisetag wegen Schädlingsbefall geschlossen war.
Anna Neumann
Anna Neumann verbindet die Zeit der Liechtensteiner mit den Fürsten von
Schwarzenberg, deren erster Vertreter das Schloß Murau erbauen ließ.
Anna Neumann bewältigte schwierige Zeiten (Reformation,
Gegenreformation, Tod zweier Kinder und von fünf Ehemännern etc.),
bewies soziales Engagement und wirtschaftliches Geschick. Sie ist
Vorbild aus der Geschichte für die Zukunft.
Die Katze
Im Schloss Murau befindet sich der Katzensaal mit einem berühmten Bild,
auf dem Katzen durch Murau spazieren. Die Katze ist aussagekräftiges,
Symbol, war in alten Kulturen ein heiliges Tier und wird von vielen
Menschen geliebt.

Kapuzinerkirche, Murau
Im Zuge der Gegenreformation wurden das Kapuzinerkloster und die
Klosterkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit von Georg Ludwig zu
Schwarzenberg gestiftet. Die Kirche und ihre Seitenkapellen sind mit
zahlreichen Kunstwerken aus Holz ausgestattet. Herausragend ist die
vermutlich aus Lindenholz gefertigte schwarze Madonna in der
Loretokapelle.

Die Klosterkirche ist in der einst östlichen Vorstadt, am Rande eines
kleinen Plateaus, gelegen. Die Kirche ist mit dem Chor nach Norden in
die Südwestecke der Klosteranlage gestellt. Im Jahre 1607 kaufte Anna
Neumann das Eisenfeld, auf dem ihr Gatte Georg Ludwig Schwarzenberg
später das Kloster errichtete. Im Jahre 1645 wird am 4. Juli der
Grundstein zu der Kapuzinerkirche (Klosterkirche) gelegt. Am 26. April
1648 erfolgt die feierliche Einweihung der Kirche mit drei Altären. Die
Klosterkirche ist seit 25. Oktober 1873 auch letzte Ruhestätte von Anna
Neumann. Neben Anna-Neumann sind auch Gräfin Maria Elisabeth zu
Schwarzenberg, zweite Gemahlin des Grafen Georg Ludwig, Johann Leopold
Philipp - Sohn des Grafen Johann Adolf I. zu Schwarzenberg in der
Klosterkirche beerdigt.

Seit 2004 ertönen die Klänge einer neuen vom Triebendorfer Orgelbauer
Walter Vonbank errichteten Orgel, die auch von der Musikschule als
Übungsinstrument für Orgelschüler mitverwendet wird.

Im Jahre 1974 ist die Kirche aus dem Schwarzenbergischen Eigentum zur
Pfarre Murau als Filialkirche gelangt. Im Jahre 1991 erhielt die Kirche
eine gründliche Innenrenovierung, wobei der Hochaltar um 3,5m nach
Norden versetzt und ein neuer Volksaltar aufgestellt wurde.




Die Armensündersäule (um 1400)
Nahe der Auffahrt zum Schloss steht eine der ältesten steinernen
Bildsäulen der Steiermark. Sie stammt aus der Zeit um 1400 und diente
einst als Andachtsstätte für die zum Tode Verurteilten auf ihrem Weg
zur Richtstätte. Bei der Säule konnten sie noch ein letztes Gebet
verrichten.

Gießübeltor mit Resten des alten Wehrganges, eines der ehem. 9 Stadttore aus dem 14. Jh.

Brauerei Murau

Die Mur fließt durch Murau im Murtal

Kriegerdenkmal seit 1955 am St. Leonhardplatz

Friesacher Tor - Eines der ehem. 9 Stadttore der Befestigungsmauer aus dem 14. Jh. Heute Quartier der Murauer Bürgergarde

Die Murtalbahn gehört so selbstverständlich zu Murau wie das Murauer
Bier oder die sagenumwobene Figur der Anna Neumann. Sie ist nicht nur
das öffentliche Verkehrsmittel vor Ort. Wiedererkennungswert hat vor
allem der historische Dampfzug der Murtalbahn, der das Bild einer
längst vergangenen Eisenbahnepoche in Murau zeichnet. Auf einer Strecke
von 65 km direkt entlang der Mur bietet sich zwischen Unzmarkt, Murau
und Tamsweg ein Dampfzug-Erlebnis, wie es im Buche steht.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: