web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Oktoneum
Bundesamtsgebäude in Wien, September 2025
Das Bundesamtsgebäude in der Radetzkystraße, 1985/86 von Architekt Peter Czernin fertiggestellt, besteht aus drei imposanten achteckigen Bürotürmen, die Verwaltungsbedienstete zahlreicher Ministerien und Behörden beherbergen. An der Einmündung des Wienflusses in den Donaukanal gelegen, wurde der Bau im Herbst 2024 unter Denkmalschutz gestellt und gilt als Ikone der Postmoderne.

Für die künstlerische Gestaltung inner- und außerhalb des
Bundesamtsgebäudes Radetzkystraße wurden Abgüsse der Werke Anton Hanaks
aufgestellt. Zu den beeindruckensten gehört sicherlich der so genannte
Gigant oder Goliath in der Eingangshalle.
Im Zentrum der Eingangshalle des
Bundesamtsgebäudes an der Radetzkystraße steht ein „Gigant“. Die
Bezeichnung einer Skulptur von Anton Hanak kann buchstäblich das ganze
Gebäude meinen. Drei riesenhafte achteckige Bürotürme beherbergen an
der Einmündung des Wienflusses in den Donaukanal die
Verwaltungsbediensteten zahlreicher Ministerien und Behörden der
Republik Österreich. Der von Architekt Peter Czernin entworfene und
1985/86 fertiggestellte Bau wurde im Herbst 2024 unter Denkmalschutz
gestellt. Das Gebäude ist eines von über 3300 Baudenkmalen in Wien und
damit Teil einer ausgewählten Gruppe von Bauwerken, deren zukünftige
Erhaltung von der Republik Österreich im Sinn des Denkmalschutzgesetzes
garantiert wird.
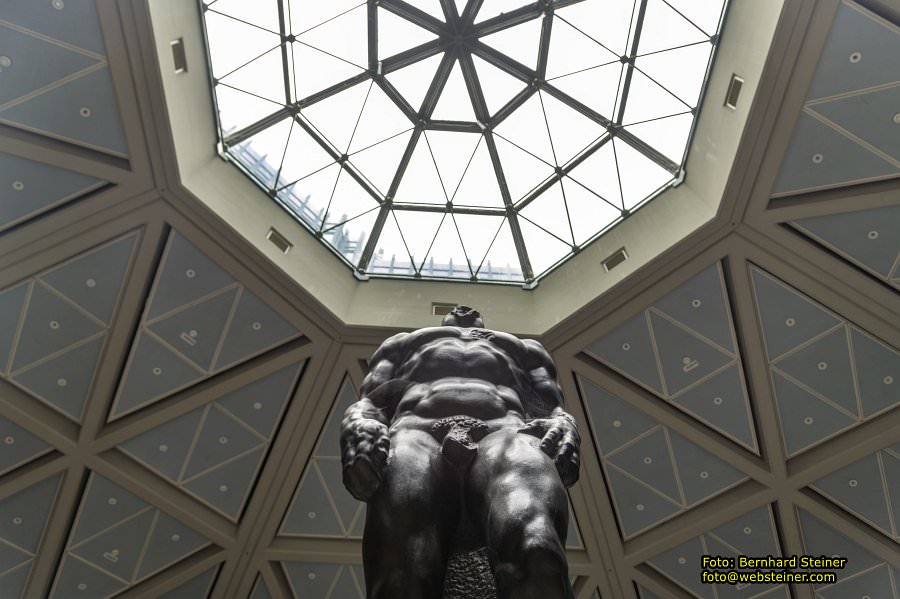
Seitens der Gebäudeeigentümerin wird am Tag des Denkmals das Objekt mit
seiner Entstehungsgeschichte vorgestellt, anschließend werden die
allgemein zugänglichen Bereiche im Gebäude besichtigt.

Als Symbol der neun Bundesländer Österreichs stehen die "Flammenden Fahnen" von Gero Schwanberg an der Vorderen Zollamtsstraße.

Durch seine achteckige Form wird das Gebäude auch "Oktoneum" genannt,
die drei ringförmigen Achtecke (Oktogone) und Höfe der Obergeschoße
entsprechen den drei öffentlichen Zonen des Erdgeschoßes. Die Achtecke
symbolisieren die Begriffe Tradition, Ästhetik, Funktion, Engagement,
Monumentalität, Technologie, Innovation und Ökonomie.
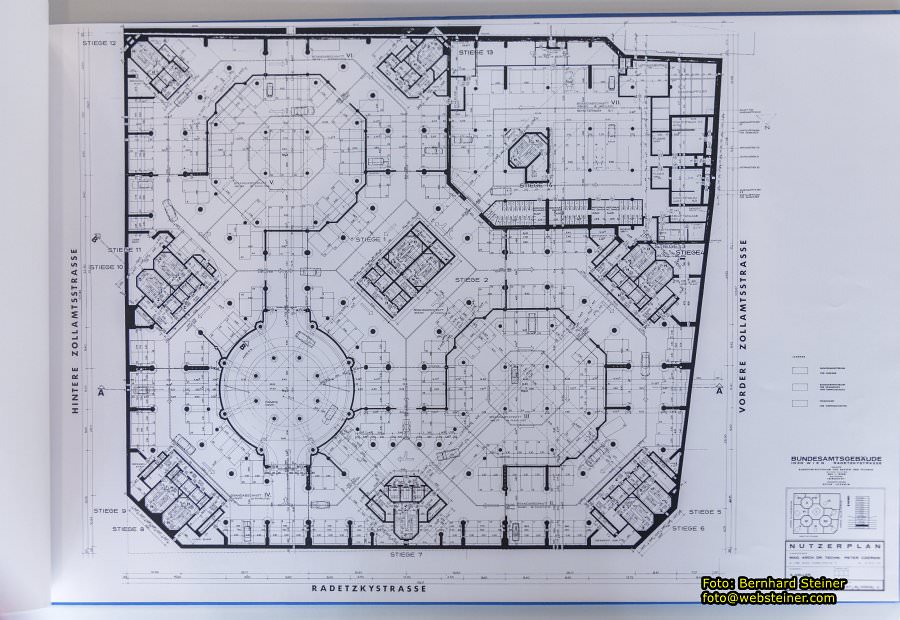
Das auch Oktoneum genannte um drei achteckige Höfe angeordnete
Amtsgebäude ist eines der markantesten Objekte postmoderner Architektur
in Wien. Es wurde zwischen 1980 und 1986 von Peter Czernin erbaut. Die
Fassade ist mit gefärbtem Glas ausgeführt, an den burgartigen
Stiegenhaustürmen sind Wappen der Bundesländer angebracht.

Von der Beauftragung des Bauträgers bis zur
Fertig stellung des Bundesamtsgebäudes dauerte es sieben - Jahre: 1979
bis 1985. Sieben Jahre, die zugleich den Anfang vom Ende der
Nachkriegsordnung markierten. 1979 wurde Margaret Thatcher zur
britischen Premierministerin ernannt. 1981 gelangte Ronald Reagan an
die Spitze der Vereinigten Staaten. 1985 wurde Michail Gorbatschow zum
Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in der
Sowjetunion gewählt. In Österreich gewannen die Sozialdemokraten im
Jahr 1979 die absolute Mehrheit im österreichischen Parlament. 1985
entschied sich Kurt Waldheim bei der Wahl zum Bundespräsidenten
anzutreten. Machtpolitisch begann die hegemoniale Aufteilung der Welt
zu erodieren. Wirtschaftspolitisch markierten die frühen 1980er Jahre
den Beginn des Siegeszuges der neoliberalen Ideen rund um den
staatlichen Rückzug aus wirtschaftlichen Tätigkeiten, die
Privatisierung öffentlicher Aufgaben und die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs.
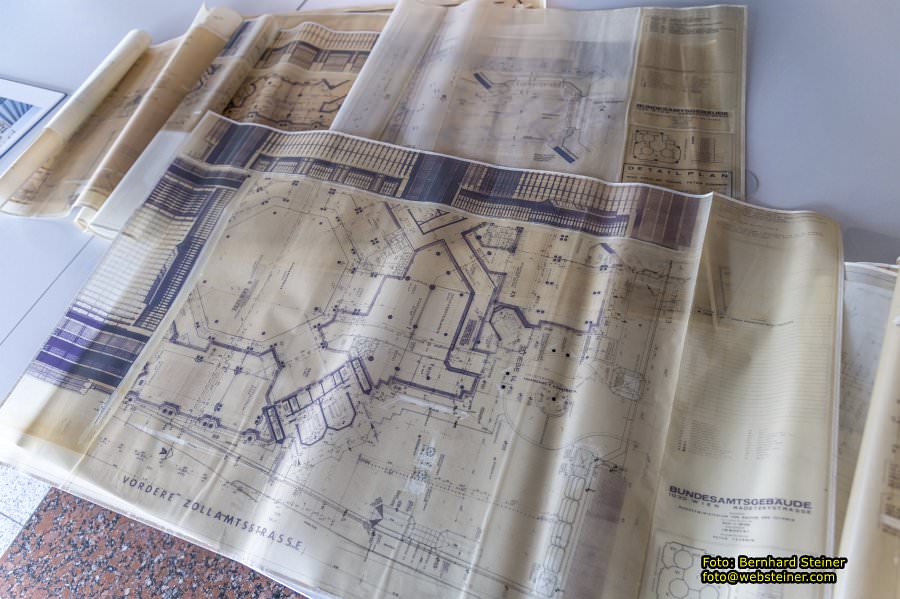
Während niemand an der Denkmalbedeutung der
Hofburg oder von Schloss Schönbrunn zweifelt, ist das im Fall des
Bundesamtsgebäudes an der Radetzkystraße anders. Die Auseinandersetzung
mit der Architektur der Postmoderne ist bis heute schwierig. Das
öffentliche Urteil hinsichtlich der architektonischen Qualität des
Bundesamtsgebäudes war in der Vergangenheit oft unbarmherzig, die
Vermittlung seiner Bedeutung für die Wiener Architekturlandschaft eine
Herausforderung. Während der „Gigant“ am Wienfluss den Diskurs gelassen
nehmen und sich über die Auszeichnung als Denkmal freuen kann, ist
seine Unterschutzstellung für die architekturinteressierte
Öffentlichkeit ein guter Anlass, einen zweiten Blick auf das Gebäude zu
riskieren und die Frage zu stellen, was das Denkmal zum Denkmal macht.

Peter Czernin (1932—2016) wurde in Graz
geboren. Er studierte Architektur an der Universität für angewandte
Kunst Wien. In einer Arbeitsgemeinschaft mit Lukas Matthias Lang
(1927—2022) realisierte er die Pfarrkirche Neukagran und gemeinsam mit
Anton Schweighofer (1930—2019) eine gemeindeeigene Wohnhausanlage in
der Sandleitengasse. Mit Harry Glück (1925—2016) arbeitete er an der
Planung der Großfeldsiedlung. Ende der 1960er Jahre eröffnete er ein
eigenes Architekturbüro und realisierte in den 1970er bis 1990er Jahren
zahlreiche Projekte, wie die Studiobühne des MaxReinhardt-Seminars, die
beiden Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße und am
Josef-Holaubek-Platz oder das mit Harry Glück geplante Hotel Marriott
am Parkring.
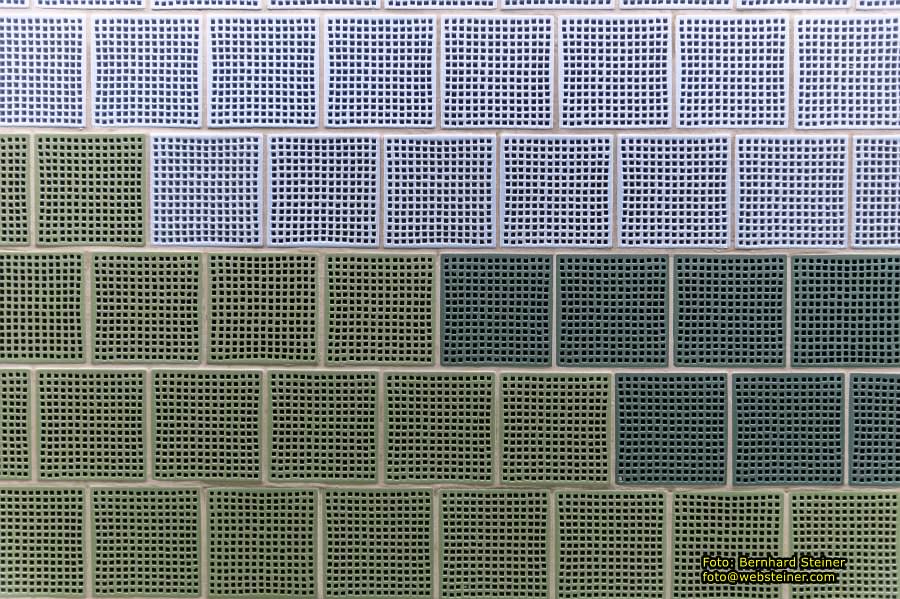
Peter Czernin war mit seinem Architekturbüro
drei Jahrzehnte lang außerordentlich erfolgreich, was ihm in der
Architekturkritik keine Pluspunkte einbrachte. Bemängelt wurde die
Verbindung seines pragmatischen Funktionalismus mit einer postmodernen
Architektursprache. Seine Architektur ließe Witz und Virtuosität
vermissen. Trotz dieser Kritik können die Arbeiten von Peter Czernin
und ganz besonders das Hotel Marriott und das Bundesamtsgebäude an der
Radetzkystraße wegen ihrer prominenten Standorte und ihrer Dimensionen
als stadtbildprägend gelten, und es ist besonders interessant, seine
frühe Rezeption einer postmodernen Architektursprache zu betrachten und
einzuordnen.

Mit Erlass vom 17. Oktober 1979 wurde die
Immorent als privater Bauträger mit der Finanzierung und der Errichtung
des Bundesamtsgebäudes beauftragt. Die Realisierung öffentlicher
Bauaufträge durch privatwirtschaftlich agierende Bauträger war ein
Paradigmenwechsel. Kosteneffizienz und Geschwindigkeit wurden als
Vorteile genannt. Diesem Anspruch stand im Fall des Bundesamtsgebäudes
ein Planwechsel entgegen, der zwar nicht die Struktur, sehr wohl aber
die Erscheinung des Gebäudes betraf. Seine Fassaden sollten sich nach
der 1981 erfolgten Umplanung auf „die wesentlichen Merkmale der
historischen Bausubstanz“ der Umgebung beziehen. Peter Czernin stellte
dazu fest: „In einer Zeit nach der ‚Moderne‘ sollen Stadtstrukturen
wieder hierarchische Ordnungen erhalten, Raumgrenzen gestaltete Formen
haben und Gebäude, besonders öffentliche, in enger Wechselbeziehung zur
bildenden Kunst stehen.“

Das Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße 2
wurde am rechten Ufer des Wienflusses nahe seiner Einmündung in den
Donaukanal errichtet. Die ältere Bebauung wurde im Zweiten Weltkrieg
zerstört. Peter Czernin konzipierte auf dem annähernd quadratischen
Grundstück ein Gebäude, das oberirdisch drei achteckige,
unterschiedlich hoch aufragende Bürotürme mit ihren großen, offenen
Innenhöfen miteinander verschränkt und anstelle eines vierten Büroturms
im Südwesten eine gestaltete Freifläche auf dem Baufeld unterbringt.
Die drei Untergeschoße des Gebäudes nehmen eine Tiefgarage und einen
Schutzraum auf. Im Stadtraum erscheint das Bundesamtsgebäude als
monumentaler Baukörper, dessen geschlossene Außenerscheinung durch die
in den Ecken des Grundstücks und in den Fugen zwischen den Türmen
platzierten Erschließungstürme (Treppen und Liftanlagen) gegliedert
wird.

Das Gebäude wurde als Stahlbeton-Skelettbau
über einer massiven Fundamentplatte errichtet. Stahlbeton-Plattendecken
verteilen die Lasten, die über ein Stahlbeton-Stützenraster und
einzelne StahlbetonWandscheiben nach unten abgetragen werden. Die
Dachflächen wurden als Stahlbeton-Plattendecken ausgeführt. Das
„Oktoneum“ wird im nordwestlich gelegenen Turm A durch einen einzigen
Hauptzugang erschlossen. Die Verteilung der Personen in den Türmen A, B
und C erfolgt im Inneren des Gebäudes durch drei ringförmig in den
Bürotürmen verlaufende Gangsysteme, die mit den Lift- und
Treppenhaustürmen des Gebäudes verbunden sind. Die Zellenbüros der
Angestellten liegen zu beiden Seiten dieses Gangsystems. Die
überkuppelten Innenhöfe der drei Türme nehmen im Turm A die
Eingangshalle, im Turm B den Festsaal und im Turm C einen gemeinsam
nutzbaren Turnsaal auf.

Die äußere Erscheinung des Gebäudes garantiert
seine Wiedererkennbarkeit im Stadtraum. Die mit Klinkersteinen
verkleideten Erschließungstürme erscheinen mit ihren überdimensionalen
Kapitellen aus Stahlbeton-Fertigteilen als Monumentalstützen, zwischen
denen die gerasterten Fassaden der oktogonalen Türme eingespannt sind.
Im Fall der Bürotürme differenziert Czernin zwischen einem
Sockelgeschoß, den leicht vorspringenden Bürogeschoßen und einer
auskragenden Attikazone. Interessant ist die Wirkung der verglasten
Parapetzone der Bürogeschoße. Bunte – in Grün, Blau und Gelb –
bedruckte Scheiben verkleiden die Stahlbeton-Parapete. Monoton
gleichförmig ordnet sich die Gestaltung dem Fassadenraster unter und
lockert es gestalterisch doch ein wenig auf. Peter Czernin möchte mit
seinem Entwurf „der in der Zeit des Wiederaufbaus entwickelten, rein
technizistischen Tendenz“ entgegentreten.

Im Inneren des Gebäudes bestimmt die
oktogonale Struktur der drei Bürotürme ihre räumliche Organisation.
Peter Czernin selbst spricht von einer „geometrisch und
verwaltungstechnisch optimalen Kreiserschließung“, die im Erdgeschoß
die drei zentralen Säle der Innenhöfe der Türme miteinander verbindet.
Spektakulär ist das Raster des Betonfachwerks der Kuppelkonstruktion,
die in der Eingangshalle über der Skulptur des „Giganten“ von Anton
Hanak schwebt. Im Festsaal erlauben verschiebbare Trennwände eine
optimale Ausnutzung der Raumgröße durch die Aufteilung in ein bis drei
größere und kleinere Säle. Die Gestaltung der Architekturglieder,
Wandoberflächen oder der Möblierung der Säle und Gänge spielt mit
historisierenden Architekturzitaten. Zu nennen wäre die Ausstattung der
oktogonalen Stahlbeton-Stützen mit Edelstahlkapitellen oder die
Absturzsicherungen im Bereich der Dachflächen, die sich auf die
„Sonnenblumengitter“ der Stadtbahnstationen von Otto Wagner beziehen.

Das ironische Spiel mit der Geschichte der
Architektur wiederholt sich im Fall der Ausstattung der Bürogeschoße,
wo man die einzelnen Zugangstüren zu den Büros mit Darstellungen einer
kannelierten Säule versah, die sich vom Türdrücker her zu öffnen
scheint und die Drehbewegung bzw. Aufgehrichtung der Türe inszeniert.
Interessant sind die Überlegungen des Architekten zur Möblierung der
Büroräume. Er setzte sich mit der Verwandlung der Arbeitsplätze im Zug
der beginnenden Digitalisierung der Verwaltung auseinander und schlug
eine EDV-gerechte Möblierung vor, die trotzdem auf die „derzeit
konventionelle Arbeitsweise Rücksicht“ nehmen sollte. Peter Czernin
betonte, dass seine Gestaltungsabsichten alle Teile des Gebäudes
betreffen. Die architektonische und die künstlerische Ausstattung
sollten das Gebäude aufwerten und die Gesellschaft sowie ihre Werte
dokumentieren und repräsentieren. Ohne falsche Scham stellte er fest:
„All das entspricht dem architektonischen Konzept eines
Gesamtkunstwerkes.“

Im Herbst des Jahres 2024 hat das
Bundesdenkmalamt das Neun-Länder-Haus als Vertreter der postmodernen
Selbstdarstellung der österreichischen Bundesverwaltung unter
Denkmalschutz gestellt. Die Unterschutzstellung schließt an eine lange
Beschäftigung des Bundesdenkmalamtes mit der Postmoderne an. Seit den
frühen 2000er Jahren wurden unter anderem die ORF-Landesstudios von
Gustav Peichl (1928—2019), eine Wohnhausanlage von Rob Krier
(1938—2023) in Liesing oder das HaasHaus von Hans Hollein am Wiener
Stephansplatz unter Denkmalschutz gestellt. Mit der Unterschutzstellung
des „Oktoneums“ beginnt eine neue Phase der Beschäftigung des
Bundesdenkmalamtes mit der Postmoderne. Die Postmoderne soll als Epoche
der jüngeren Architekturgeschichte systematisch in der österreichischen
Denkmallandschaft verankert werden, beispielgebende Bauwerke als
Vertreter der Epoche unter Denkmalschutz gestellt werden.

Im Rahmen des Verfahrens zur
Unterschutzstellung des Bundesamtsgebäudes arbeitete das
Bundesdenkmalamt die geschichtliche, künstlerische und kulturelle
Bedeutung des „Oktoneums“ heraus und bewertete das öffentliche
Interesse an seiner Erhaltung. Das Bundesamtsgebäude an der
Radetzkystraße wäre sowohl „ein authentisches Zeugnis der jüngeren
politischen Geschichte Österreichs als auch Abbild des
Selbstverständnisses und des gesellschaftlichen Anspruchs der
öffentlichen Verwaltung“. Als Staatsbürgerhaus wolle es eine moderne
Staatsverwaltung repräsentieren. Im künstlerischen Sinn würde gerade
der „in einem fortgeschrittenen Planungsstadium vollzogene Wechsel der
Fassaden- und Innenraumplanung“ einen „Paradigmenwechsel“ markieren.
Als großmaßstäblicher Verwaltungsbau würde sich das „Oktoneum“ bereits
in den frühen 1980er Jahren einer postmodernen Formensprache bedienen,
die sich erst in wenigen Beispielen etabliert hatte.

Kulturell könne man den postmodernen Versuch
der Einfügung der riesenhaften Kubatur in das historische Stadtgefüge
im zeittypischen „Diskurs zur Altstadterneuerung und -erhaltung
verankern“. Auch wenn die Bestimmung der künstlerischen Bedeutung des
„Oktoneums“ in der Öffentlichkeit umstritten bleibt, wird man den
Willen des Architekten anerkennen müssen, den riesigen Maßstab des
Gebäudes gestalterisch zu bewältigen. Es ist keine Frage persönlicher
Vorlieben, ob man dem „Oktoneum“ eine Bedeutung als Denkmal zuschreiben
kann, sondern eine gutachterliche Abwägung, inwieweit das Gebäude eine
wesentliche Epoche der Geschichte der österreichischen Architektur
repräsentiert. Als Denkmal der Postmoderne unterscheidet es seine Größe
von den meisten anderen deutlich kleineren Beispielen. Das
Bundesamtsgebäude ist als Denkmal eines der prägnantesten
Ausrufezeichen der Postmoderne in Österreich.

Es bleibt die Frage, warum das
Bundesamtsgebäude an der Radetzkystraße bis heute so kontroverse
Reaktionen provoziert. Auch wenn es um ein Bauwerk geht, das wegen
seiner Lage und Größe eine dezidierte Meinung herausfordert, überrascht
die Vehemenz so mancher Stellungnahme. Will man seine
Unterschutzstellung einordnen und seine gesellschaftliche Relevanz
besser verstehen, gilt es, einen Schritt zurückzutreten und sich
nochmal die Voraussetzungen der Planung und Errichtung des
Neun-Länder-Hauses zu vergegenwärtigen. Seine postmoderne
Architektursprache ist nicht zuletzt Ausdruck einer Krise der Moderne.
Der Ölpreisschock und die galoppierende Inflation der 1970er Jahre
erschütterten den Fortschrittsglauben der Nachkriegszeit und das
Vertrauen in grenzenloses Wachstum und eine grundsätzliche Erneuerung
der Gesellschaft. Es war der Moment eines Blickes in den Rückspiegel
und der Evaluierung der alles überragenden Erzählung der vergangenen
Jahrzehnte.

Die allgemeine Krise der Moderne war auch eine
im Feld der Architektur, und man begann, über eine Moderne nach der
Moderne nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit der langen Geschichte
der Architektur lag nahe, und es ist sicherlich kein Zufall, dass das
neu erwachende Interesse an der gebauten Geschichte mit
denkmalpflegerisch inspirierten Initiativen wie dem Europäischen
Denkmalschutzjahr 1975 korrelierte. Man wollte die Moderne hinter sich
lassen und hoffte auf die Geschichte der Architektur als
Inspirationsquelle. Im Sinn einer Abgrenzung von der Moderne war die
Postmoderne ein Bruch mit der formalen Strenge, ihrem Minimalismus und
dem problematischen Anspruch der Ausschließlichkeit. Gestalterisch ging
es der Postmoderne um die Vielfalt der Ausdrucksformen und das
Experiment. Man interessierte sich für die historischen und die
örtlichen Bezüge der Architektur, blieb gegenüber
Alleinvertretungsansprüchen ironisch distanziert und freute sich über
die unendlichen Möglichkeiten der Dekoration.

In der Rückschau könnte man Peter Czernins
Konzept einer postmodernen Architektur als Versuch der Versöhnung der
Moderne mit ihren inneren Widersprüchen verstehen. Man denkt an den
Menschen im Angesicht des Gigantischen, an die funktionalistische
Büromaschine und ihren Platz in einer demokratisch verfassten
Gesellschaft, an das StahlbetonSkelett und seine Verkleidung. Die
Gestalt des Bundesamtsgebäudes will das „Oktoneum“ städtebaulich,
architekturgeschichtlich und gesellschaftspolitisch im Zentrum der
Diskussion rund um die Moderne verankern. Der „Gigant“ von Peter
Czernin macht es uns nicht leicht. Auch wenn seine postmoderne
Erscheinung aktuell noch umstritten ist, möchte man die Kämpfe des
vergangenen Jahrhunderts hinter sich lassen und das „Oktoneum“ gerne
als selbstverständlichen Teil der Wiener Stadtlandschaft annehmen und
sich über seine Auszeichnung als Denkmal freuen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: