web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Salzburger Dom
Dom zu Salzburg, November 2024
Der Salzburger Dom ist die Kathedrale der römisch-katholischen Erzdiözese Salzburg und damit Metropolitankirche der Kirchenprovinz Salzburg; sie ist den hll. Rupert und Virgil geweiht, das Patrozinium wird am Rupertitag, dem 24. September, begangen. Der während des Dreißigjährigen Krieges vollendete Barockbau steht unter Denkmalschutz und gehört zum UNESCO-Welterbe „Historisches Zentrum der Stadt Salzburg".

Im 32 m hohen Langhaus befinden sich Deckengemälde von Donato Mascagni
und Ignazio Solari (Sohn des Santino) aus Ramponio Verna, die Szenen
aus dem Leben und der Passion Christi zeigen. In 15 großflächigen
Bildern wird das Leiden Christi bis zur Kreuzigung dargestellt. Zehn
kleinere Querbilder zeigen Ausschnitte aus dem Leben Christi, von der
Hochzeit zu Kana bis zu Jesus auf der Tempelzinne. Die Stuckaturen in
diesem Bereich – wie im gesamten Dom – stammen aus der Werkstatt von
Giuseppe Bassarino. Diese Arbeiten dürften um das Jahr 1628 entstanden
sein. Der weiße, in Vertiefungen und Unterschneidungen schwarz gefasste
Stuck schmückt in Ranken-, Putten- und Akanthusblattform den Dom.

Der Dom zu Salzburg hat ein Langhaus mit vier Jochen und einem
zusätzlichen Emporenjoch über der Vorhalle. Beiderseits des Langhauses
befindet sich eine Kapellenreihe. Die je vier Kapellen sind
untereinander verbunden und öffnen sich gegen das Hauptschiff mit einem
Rundbogen. In jeder dieser Kapellen befindet sich ein Seitenaltar. Die
Aufstellung und die Ausgestaltung der acht Langhauskapellen wurde von
Paris Lodron verfasst und ist mit 16. März 1652 datiert.

Der Grundstein des barocken Doms wurde 1614 von Erzbischof Marcus
Sitticus von Hohenems (1612–1619) gelegt. 1628 wurde der Dom durch
Erzbischof Paris Lodron (1619–1653) geweiht, doch erst rund vierzig
Jahre später waren die Türme und auch die umgebenden Plätze vollendet.
Der barocke Bau beeindruckt durch seine klaren Formen, seinen
einheitlichen Dekor und die leuchtende Fassade aus heimischem Marmor.
Sein Architekt, Santino Solari, stammte aus Italien. Er schuf den
bedeutendsten Kirchenbau jener Zeit nördlich der Alpen, der die
Architektur in ganz Österreich und Süddeutschland beeinflussen sollte.

Das Taufbecken steht heute an der Nordseite in der ersten
Seitenkapelle, welche der Taufe Jesu geweiht ist. Taufbecken und Altar
mit einem Altarblatt von Joachim Sandrart befanden sich bis zum Beginn
des 19. Jahrhunderts auf der gegenüberliegenden Südseite, wo sich auch
der Weihwasserabfluss befindet. Die Taufkapelle ist die erste der acht
Seitenkapellen, die nach dem Tod von Paris Lodron in Angriff genommen
wurde. Der Altaraufbau aus der damals an der Südseite befindlichen
Taufkapelle stammt noch aus der Zeit von Guidobald von Thun, dessen
Wappen am Säulensockel zu sehen ist. Alle anderen Marmoraltäre in den
Seitenkapellen wurden erst unter Max Gandolph von Kuenburg errichtet.
1674 wurde das Altarblatt von Sandrart mit dem jetzigen Gemälde von
Schönfeld ausgetauscht. Warum das Taufbecken mit dem zugehörigen
Altarblatt die Seiten wechselte und das Rochus&Sebastian-Altarblatt
an die Südseite kam, ist nicht bekannt.
Das Taufbecken ist ein Zinnguss. Laut Inschrift wurde es 1321 von
Meister Heinrich geschaffen. Die romanischen Bronzelöwen, auf denen das
Taufbecken ruht, stammen schon aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts.
Die Inschrift am oberen Beckenrand lautet: „SVM . VAS . EX . (A)ERE .
FACIAM . PECCATA . DELERE + PER . ME . FIT . SACRI . PVRGACIO . VERA .
LAVACRI . + PVRGATVR . TOTVM . QVOT . FIT . BAPTISMATE . LOTVM +
M(agister) . HEI(n)RIC’(us) . ME . FECIT .:. + ANNO . D(omi)NI .
M.C.C.C.X.X.I. +“ („Ich bin ein Gefäß aus Erz. Ich tilge die Sünden.
Durch mich geschieht im heiligen Bade wahre Reinigung. Völlig gereinigt
wird, was in der Taufe gewaschen wird. Meister Heinrich hat mich
geschaffen im Jah des Herrn 1321“). Es handelt sich hier um einen
gereimten Spruch (aere/delere, sacri/lavacri, totum/lotum), wie es in
ähnlicher Weise auch an anderen Taufbecken dieser Epoche zu finden ist.
Die Inschrift am unteren Rand lautet: „GRACIA . DIVINA . PECCATORVM .
MEDICINA .+. ME. DEDIT. VT. MVNDA. MENS . FIAT. FONTIS . IN . VNDA.
(Eichenzweig-Relief) LEX. VETVS . ERRAVIT . NOVA . LEX. ME .
SANCTIFICAVIT .+.“ („Die göttliche Gnade gibt mir das Mittel zur
Heilung der Sünden, dass rein werde der Geist im Wasser der Quelle. Das
alte Gesetz hat geirrt, das neue Gesetz hat mich geheiligt“). Auch
dieser Spruch weist Reimpaare auf (divina/medicina, munda/unda,
erravit/sanctificavit). Die untere Inschrift verbindet die Taufe mit
Augustinischer Theologie und gibt somit Zeugnis für die Tradition des
Domkapitels, welches von 1122 bis 1514 als Augustiner-Chorherrenstift
reguliert, war.
An der Beckenwand sind in Rundbogenarkaden 16 Reliefdarstellungen von
Heiligen, Bischöfen und Äbten von Salzburg zu finden, nämlich S.
Rupertus, S. Virgilius, S. Martinus, S. Eberhardus, S. Hartwigus, S.
Ditmarus, S. Vitalis, S. Augustinus (zwei Namen unleserlich), S.
Valentinus, S. Ditmarus Martyr, S. Eberhardus, S. Johannes, S.
Maximilianus und S. Amandus. Der Deckel des Taufbeckens stammt aus dem
Jahr 1959 von Toni Schneider-Manzell und zeigt zwölf alt- und
neutestamentliche Motive zur Taufsymbolik.

Reliquien im Dom zu Salzburg
KREUZKAPELLE - Hl. Chunilad und Hl. Gislar
Sie waren Gefährten des Hl. Rupertus und sind gut bezeugt. Bei einer
Umbettung im Jahr 1315 wurden nur mehr Reliquien des Hl. Gislar
vorgefunden. Seit 1914 befinden sie sich nun am gegenwärtigen Platz.
VERKLÄRUNG-CHRISTI-KAPELLE - Hl. Vinzenz
Der Märtyrer-Diakon Vinzenz von Saragossa ist der Patron von Portugal.
Seine Reliquien kamen unter Erzbischof Dietmar von Salzburg um 900 nach
Salzburg. Sein Fest wird am 22. Jänner gefeiert.
ANNAKAPELLE - Hl. Chrysanthus und Hl. Daria
Das Märtyrerehepaar lebte im 4. Jahrhundert. Erzbischof Adalwin von
Salzburg erhielt ihre Reliquien von Papst Nikolaus I. anlässlich der
Palliumsverleihung in Rom im Jahr 860. Ihr Fest wird am 25. Oktober
gefeiert.
TAUFKAPELLE - Hl. Gereon und Hl. Ursula-Gefährtin
Der Hl. Gereon erlitt 304 als Kommandant einer Kohorte mit seinen
Soldaten in Köln das Martyrium. 1226 schenkt Erzbischof Heinrich von
Köln Erzbischof Eberhard II. von Salzburg das Haupt des Heiligen.
Ebenfalls aus Köln stammen die Reliquien einer Gefährtin der Hl.
Ursula. Sie war eine namenlose Märtyrer-Jungfrau aus der Schar der
Begleiterinnen der Hl. Ursula. Ihr Fest wird am 11. Oktober gefeiert.
SEBASTIANSKAPELLE - Hl. Basilius der Große und Hl. Märtyrer Demetrius
Diese Reliquien wurden erstmals bei einer Bestandsaufnahme 1828
erwähnt, ihre Echtheit ist nicht gesichert. Ihr Fest wird am 2. Jänner
begangen.
KARL-BORROMÄUS-KAPELLE - Hl. Hermes
Er war ein Märtyrer des 2. Jahrhunderts. Erzbischof Liupram brachte die
Reliquien am 1. Juli 851 aus der Hermes-Katakombe in Rom nach Salzburg.
Sein Fest wird am 28. August gefeiert.
MARTINSKAPELLE - Hl. Martin von Tours
Der Schrein stammt aus dem Jahr 1675; die Reliquien selbst wurden schon
1020 im Salzburger Dom bezeugt. Vielleicht kamen sie sogar schon unter
Erzbischof Arno durch Vermittlung seines Freundes Alkuin um 800 aus dem
Frankenreich hierher. Das Fest des Hl. Martin wird am 11. November
gefeiert.
PFINGSTKAPELLE - Hl. Apostel Matthias und Hl. Apostel Barnabas
Diese Reliquien befinden sich seit 1914 an diesem Platz, ihre Echtheit
ist nicht nachgewiesen. Das Fest des Hl. Matthias fällt auf den 24.
Februar, das des Hl. Barnabas auf den 11. Juni.
Volksaltar - Hl. Rupert und Hl. Virgil
Sie sind die Diözesanpatrone von Salzburg. 774 bettet Abt-Bischof
Virgil die Reliquien von Rupert in den ersten Dom ein, ihre Echtheit
ist gesichert. Das Fest der Diözesanpatrone fällt auf den 24. September.

Stuckdetail in einer Seitenkapelle

Die nördliche Kapellenreihe ist die sogenannte Evangelienseite, bzw.
auch die Frauenseite. Die Kapellenreihe beginnt mit der
Tauf-Kapelle. Dort befindet sich auch das bronzene Taufbecken. Diese
Kapelle befand sich ursprünglich an der Südseite und wurde erst im 19.
Jahrhundert mit der hll.-Sebastian-und-Rochus-Kapelle ausgetauscht. Es
folgen die Kapelle hl. Anna (Joachim von Sandrart), die Kapelle mit der
Verklärung Christi (Altarblatt von Johann Joseph Fackler). Bis 1828 war
hier eine hl.-Vinzenz-Kapelle mit einem Altarblatt von J.H. Schönfeld.
Vor dem Querschiff ist die Kreuz-Kapelle (Karel Škréta). In jeder
Kapelle befinden sich Deckenbilder von Ludwig Glötzle.

Hauptschiff Länge: 101,94 Meter
Gesamtbreite: 68,05 Meter
Hauptschiff Breite: 45 Meter
Querschiff Länge: 68 Meter
Höhe Hauptschiff: 32 Meter
Höhe Vierungskuppel: 77,14 Meter
Höhe Türme: 78,26 Meter (mit Kreuz)
Höhe Fassade bis zum Giebel: 43,11 Meter
11 Altäre
800 Sitzplätze
Stehplätze für 7.000 Menschen
Bebaute Fläche: 4.965 Quadratmeter




Der Hochaltar von 1628 wird im Entwurf dem Baumeister des Doms, Santino
Solari, zugeschrieben. Er hat einen freistehenden Marmoraufbau. Auf dem
Giebel des Hauptaltares finden sich drei Engel. Jener auf der
Giebelspitze trägt ein vergoldetes Kreuz. Das Altarbild zeigt die
Auferstehung Christi, gemalt von Arsenio Mascagni. Über dem Altarbild
befinden sich Statuen der Kirchenpatrone – Rupert und Virgil – sowie
Allegorien auf Religio und Caritas. Diese Figuren werden den Meistern
Pernegger d. J. und Hans Waldburger zugeschrieben. Zwischen den Figuren
befindet sich die lateinische Inschrift NOTAS MIHI FECISTI VIAS VITÆ –
(Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt) aus Psalm 16,11. An Wänden
und Decke befinden sich im Chor und über dem Altar des Doms Bilder der
Auferstehung und Himmelfahrt Christi.

Die Orgel-Landschaft im Salzburger Dom
Nach Fertigstellung der beiden westlichen, den sogenannten
„italienischen“ Pfeilerorgeln verfügt der Salzburger Dom heute über
insgesamt fünf selbständige Orgelinstrumente – einmalig nördlich der
Alpen!
Instrumentalmusik kann nun wieder, wie zu Mozarts Zeiten, auf den
Kuppelemporen ausgeführt werden – Mozart selbst spielte meist an der
südöstlichen Pfeilerorgel, der „Hoforgel“. Durch die Wiederherstellung
der barocken Orgelsituation sind auch wieder mehrchörige Werke alter
Meister in originaler Weise aufführbar.

Das Altarblatt im südlichen Querschiff (Epistelseite) zeigt das
Maria-Schnee-Wunder und wird Ignazio Solari zugeschrieben. Das
Altarbild stellt Papst Liberius dar, der mit seiner rechten Hand auf
den Grundrissplan von St. Maria Maggiore zeigt, die er am Esquilin in
Rom errichten ließ. Da die Kuppel des Salzburger Doms mit der Kuppel
der Sixtus-Kapelle ident ist, steht man im Salzburger Dom symbolisch
auch in St. Maria Maggiore. Liberius ist mit dem Konterfei von Markus
Sittikus dargestellt, der seinerseits den Salzburger Dom in Auftrag
gegeben hat. Das Porträt des verstorbenen Erzbischofs wurde aus Arsenio
Mascagnis Gemälde mit Hellbrunn und dem im Bau befindlichen Dom von
1618 übernommen. Auch hier zeigt Markus Sittikus mit derselben
Handgeste auf den Dom. Der Tabernakel zeigt eine Kopie der Altöttinger
Madonna. In den Nischen und auf den Giebelschenkeln des Altars finden
sich Statuen weiterer Heiliger. Zwischen den Figuren befindet sich die
lateinische Inschrift "IN ME GRATIA OMNIS VIÆ ET VERITATIS, ECCL.
XXIV." ("In mir ist alle Lieblichkeit des Weges und der Wahrheit, Eccl.
24") aus dem Buch Ecclesiasticus (Jesus Sirach, Ben Sirach), Kapitel
24, 25.Seit dem Frühen Mittelalter bezog man die Weisheit Gottes nicht
mehr allein auf Jesus Christus, sondern auch auf die Gottesmutter
Maria. Die Marienfeste (Mariä Aufnahme in den Himmel und Unbefleckte
Empfängnis) erhielten dazu Lesungen aus dem am Altar zitierten Buch
Jesus Sirach Kapitel 24. Auf Maria als Allegorie der "Weisheit" und
"Mater pulchrae dilectionis" („Mutter der schönen Liebe“) bezieht sich
auch das Programm der Mariensäule am Domplatz, wie sie in der
Lauretanischen Litanei vielfach vertont wurde. Das in Wessobrunn
befindliche Gnadenbild Maria, Mutter der Schönen Liebe wurde zum
Vorbild für das Antlitz der Marienstatue am Domplatz. Eine Kopie dieses
Gemäldes aus dem frühen 18. Jahrhundert befindet sich am St. Ivo-Altar
der Universitätskirche. Neben dem Altar befinden sich Marmorepitaphien
der Fürsterzbischöfe 9. Andreas Jakob von Dietrichstein († 1753), 5.
Johann Ernst von Thun († 1709), 6. Franz Anton von Harrach († 1727) und
10. Sigismundus Christoph von Schrattenbach († 1771), das Porträt wurde
von Rosa Barducci-Hagenauer gemalt. An den Wänden und der Decke sind
Stationen aus dem Leben und der Himmelfahrt Mariens zu sehen.


Die Krypta in der heutigen Form besteht erst seit der Wiedereröffnung
des Doms im Jahr 1959. Davor gab es im Bereich der heutigen Unterkirche
nur vom Boden des Doms aus zu öffnende Grüfte (ähnlich wie in den
Seitenkapellen zu sehen), die zur Bestattung der Salzburger Erzbischöfe
dienten.


Die Krypta ist in verschiedene Räume unterteilt. Einer wurde als
Kapelle eingerichtet, in der Gottesdienste gefeiert werden können. In
den 1990er-Jahren wurde der Stiegenabgang in die Unterkirche an den
jetzigen Ort verlegt. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, eine
sogenannte „Anbetungskapelle“ zu schaffen, in der das Allerheiligste
Altarsakrament angebetet werden kann.

Die Krypta des Doms ist Begräbsnisort für insgesamt 22 Erzbischöfe und
Ort des Gebetes. Ein Nebenraum birgt das Kunstwerk Vanitas von
Christian Boltanski.
In der Chorkrypta des spätromanischen Salzburger Doms hat der
französische Künstler Christian Boltanski unter dem Titel „Vanitas“ ein
Schattenspiel inszeniert, das sich präzise auf den Ort einlässt.
Boltanski schuf ein Bild der Vergänglichkeit, das dem Raum entspricht:
Die Chorkrypta war einst geweihter Kirchenraum, der auch als Grablege
diente, geriet aber über die Jahrhunderte in Vergessenheit. Durch die
behutsame Intervention des Künstlers entstand der geschichtsträchtige
Raum als mystischer Ort neu und vereint nun die Spiritualität seines
Schöpfers mit der kirchlichen Aura.

Zusammen mit der „Großen Domorgel“ auf der Westempore des Doms, die im
Rahmen des gesamten Orgelensembles ihre unverzichtbare und qualitativ
hervorragende Spielmöglichkeit einbringt, bietet der Salzburger Dom
eine für die Vielfalt des Musizierens – wenigstens in Europa –
einmalige Situation. Sowohl für die Organistinnen und Organisten als
auch für die Zuhörenden ist das „Wandern in der Orgellandschaft im
Salzburger Dom“ ein wunderbares Erlebnis. Diese instrumentale Vielfalt
wird nicht nur zur musikalischen Umrahmung gottesdienstlicher Feiern,
sondern auch zum konzertanten Spiel genützt.


In den Querarmen befinden sich entsprechend den Patrozinien der
Nebenaltäre an der Nordseite ein Franziskus- und an der Südseite ein
Marienzyklus. Im nördlichen Querschiff (Evangelienseite) befindet sich
ein Altar (um 1628) mit dem Altarbild der Verklärung des heiligen Franz
von Assisi, gemalt von Arsenio Mascagni. Der Tabernakel an diesem Altar
ist dem Tabernakel des Domenico Fontana für die Sixtus-Kapelle in St.
Maria Maggiore nachempfunden. Er ist aus vergoldetem Messing, flankiert
von Silberstatuen der vier Evangelisten. In der Mitte des Tabernakels
findet sich ein getriebenes Relief des letzten Abendmahls sowie das
Wappen von Erzbischof Paris Lodron. Links und rechts neben dem Altar
befinden sich Marmorepitaphien der Fürsterzbischöfe (7.) Leopold Anton
von Firmian († 1744), (3.) Guidobald von Thun († 1668), (4.) Max
Gandolf von Kuenburg († 1687), das Porträt wurde von Frans de Neve d.
J. gemalt und (8.) Jakob Ernst von Liechtenstein-Kastelkorn († 1747).
An den Wänden und der Decke befinden sich Szenen des Lebens und Todes
des heiligen Franziskus.

Die Funktion der Vierungsorgeln
„Bereits 1628, zum Zeitpunkt der Weihe des Domes, waren an den
östlichen Kuppelpfeilern ‚zwei wohlgezierte Orgeln‘ angebracht. Im Zuge
der Ausstattung des Domes erhielten nach 1640 auch die westlichen
Emporen jeweils eine Orgel – kleine einmanualige Werke, die für
Continuopraxis und Pianospiel disponiert waren“, schreibt Prof. Gerhard
Walterskirchen, Musikwissenschafter, über die Vierungsorgeln.
Warum aber überhaupt mehrere Orgeln im barocken Dom angebracht wurden,
erklärt die Spielpraxis der Zeit. Entsprechend der mehrchörigen Praxis
wurde in Oberitalien das Spiel an zwei Orgeln gepflegt: So wirkten in
San Marco in Venedig, wo seit dem Ende des 15. Jahrhunderts zwei Orgeln
im Einsatz waren, mit Girolamo Diruta, Claudio Merulo und Andrea
Gabrieli die bedeutendsten Organisten der Zeit. Neben Venedig gewann
die Musik für zwei Orgeln am Dom zu Mailand und auch nördlich der Alpen
besonderes Format.

Epitaphien: Die Epitaphien sind dem jeweiligen Todesjahr entsprechend
chronologisch angeordnet. Sie beginnen im Presbyterium (1.,2.). Diesen
folgen die Epitaphien im Querschiff. Die Reihe beginnt mit den
Epitaphien auf der Evangelienseite innen (3.,4.), anschließend auf der
Epistelseite innen (5.,6.). Danach kommen stilistisch in etwas anderer
Form die beiden Epitaphien auf der Evangelienseite außen (7.,8.),
gefolgt von denen auf der Epistelseite außen (9.,10.). Alle
Marmorepitaphien der Fürsterzbischöfe im Dom sind zweigeschoßig,
umrahmt von trauernden Putten und von Todessymbolen. Im Mittelteil
befindet sich ein Medaillon, mit einem auf Kupfer gemalten Porträt des
Erzbischofs. Im Giebel des Epitaphs ist eine Wappenkartusche angebracht.

Der Kuppelbereich ist als Drei-Konchen-Chor gestaltet. Er knüpft somit
an romanische Traditionen an, hat aber möglicherweise auch den
Petersdom in Rom zum Vorbild. Bereits der 1598 abgebrannte Dom hatte
drei Konchen. Diese hat Vincenzo Scamozzi in seinen fünfschiffigen
Domplan in stark ausgeprägter Form übernommen. Santino Solari war mit
dem Plan des bereits in Bau befindlichen Doms von Vincenzo Scamozzi
vertraut und hat seinerseits den Dom verkleinert, aber die
Dreikonchenform übernommen. Die Kuppel des Salzburger Doms hat die
Kuppel der 1585 von Domenico Fontana gestalteten Sixtus-Kapelle der
Papstbasilika St. Maria Maggiore am Esquilin in Rom zum Vorbild. Dessen
1590 in Rom erschienenes Architekturtraktat "Della trasportatione
dell’obelisco vaticano et delle fabriche di nostro Papa Sisto V"
beeinflusste maßgeblich die unter Markus Sittikus erstellten Bauten in
Salzburg.

Über der Vierung befindet sich die 71 Meter hohe Tambourkuppel des
Doms. In der Kuppel finden sich in zwei Reihen jeweils acht Fresken mit
Szenen aus dem Alten Testament, die wie die Malereien im Hauptschiff
Fra Arsenio (Donato) Mascagni (1579–1636) und Ignazio Solari zugeordnet
werden. Die alttestamentlichen Szenen stehen in Bezug zu den Szenen der
Passion Christi im Hauptschiff.
An den Segmentflächen der Kuppel finden sich Darstellungen der vier
Evangelisten, darüber sind die Wappen von Erzbischof Paris Lodron und
Erzbischof Andreas Rohracher zu sehen, jener beiden Erzbischöfe, die
den Dom geweiht beziehungsweise nach dem Wiederaufbau zweitgeweiht
haben.


Die drei Bronzetore des Domes haben die drei Kardinaltugenden Glaube,
Liebe und Hoffnung zum Thema. Sie wurden zwischen 1955 und 1958 von
Toni Schneider-Manzell (Tor des Glaubens), Giacomo Manzù (Tor der
Liebe) und Ewald Mataré (Tor der Hoffnung) gestaltet.

Die südliche Kapellenreihe ist die sogenannte Epistelseite, bzw. auch
die Männerseite. Hier befinden sich die Kapelle der Hll. Sebastian
& Rochus (Altarblatt von Johann Heinrich Schönfeld). Sie befand
sich ursprünglich an der Nordseite und wurde erst im 19. Jahrhundert
mit der Taufkapelle ausgetauscht. Das Taufbecken von 1321 befand sich
ebenfalls nächst dem Eingang an der Südseite. Es folgen die Kapelle des
Hl. Karl Borromäus (J. H. Schönfeld), die Kapelle des Hl. Martin und
Hieronymus (J.H. Schönfeld) sowie die Kapelle mit der Aussendung des
Hl. Geistes (Karel Škréta). In jeder Kapelle befinden sich Deckenbilder
von Ludwig Glötzle.








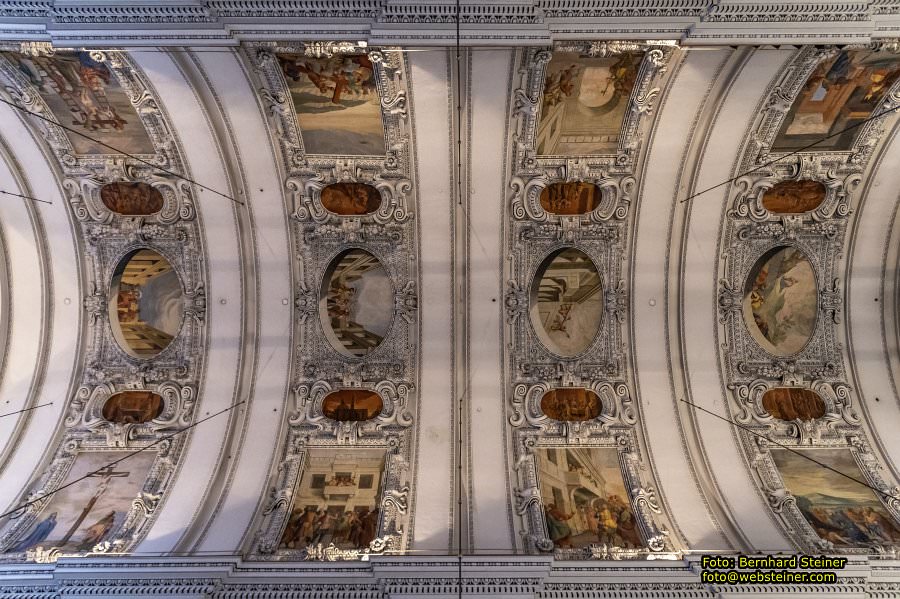
Der Dom von Salzburg beherrscht mit seiner markanten, zweitürmigen
Fassade und dem mächtigen Baukörper das Bild der Altstadt. Die barocken
Plätze, die ihn umgeben, formen eine einzigartige Bühne, die von den
Festspielen genutzt und von der UNESCO als Weltkulturerbe gewürdigt
wird.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: