web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schell Collection in Graz
Schlüsselmuseum, August 2024
Die Schell Collection beherbergt mit rund 13.000 Exponaten auf drei Stockwerken eine einzigartige Sammlung.
Außergewöhnliche Schlüssel, kostbare Kästchen und prunkvolle Schlösser
aus Europa, Asien und Afrika kann man im Museum bestaunen. Neben
versperrbaren Objekten kann man auch die interessante Welt des
Eisenkunstgusses und des Schmiedeeisens entdecken.

Schlüssel und Schlösser aus Afrıka
Die afrikanischen Schlüssel und Schlösser der Schell Collection stammen
überwiegend aus Nord- bzw. Westafrika. Dabei handelt es sich um Objekte
von drei verschiedenen Ethnien: den Tuareg, den Dogon und den Bamana.
Tuareg
Das Volk der Tuareg lebt nördlich der Sahara und pflegt eine nomadische
Lebensweise. Sowohl Männer als auch Frauen verfügen über Besitz. Bei
den Frauen ist es vor allem das Zelt mit samt den Gegenständen darin.
Bei den Tuareg tragen die Männer Gesichtsschleier und nicht die Frauen.
Die Metallverarbeitung und damit auch das Schmieden von Schlüssel ist
eine männliche Domäne. Dies bringt die Schmiede allerdings in Konflikt
mit den Erdgeistern, da sie das Eisen aus dem Boden abbauen. Bei den
Schlössern der Tuareg handelt es sich um Vorhangschlösser mit
Spreizfedern mit bis zu 3 verschiedenen Schlüsseln. Die großen
Schlüssel der Tuareg werden auch dazu verwendet, um die Gewänder der
Frauen zu beschweren. So kann der starke Wind diese nicht hochwehen.
Dogon
Das sesshafte Volk der Dogon lebt südlich der Sahara auf dem Gebiet von
Mali. Die Ethnie zählt ca. 400.000 Menschen. Zum Versperren werden
Fallriegelschlösser aus Holz verwendet, bei denen sich das
Schlüsselloch auf der Seite des Riegels befindet. Der Schlüssel ist ein
einfacher Stab, der an seinem Ende eine oder zwei Reihen von Zähnen aus
Holz oder Eisen besitzt. Tiere wie Krokodile (Symbol für Kreislauf des
Lebens) oder Landschildkröten sind ein häufiges Dekorationselement auf
den Schlössern. Zweitere werden von vielen Dogon Familien als Haustiere
gehalten. Auf einigen Schlössern sind zwei menschliche Figuren zu
sehen. Dabei handelt es sich um Zwillinge, die bei den Dogon die
Fruchtbarkeit symbolisieren.
Bamana
Bei den Bamana handelt es sich um das zweite sesshafte Volk (ca. 3
Mio.) aus Mali, von denen Schlüssel und Schlösser in der Schell
Collection ausgestellt sind. Auch sie benutzen Fallriegelschlösser aus
Holz, allerdings ist das Schlüsselloch an der Oberseite des Riegels
angebracht. Bei den Formen der Schlösser gibt es zahlreiche Varianten -
meistens handelt es sich um stilisierte menschliche Figuren. Die
dargestellten Masken werden bei Zeremonien von Geheimgesellschaften der
Bamana benutzt. In der heutigen Zeit sind zusätzlich zu den
Fallriegelschlössern noch industrielle Vorhangschlösser aus
Sicherheitsgründen in Gebrauch.

Schlösser mit Signaturen
Die Schmiede verwenden gelegentlich die Zeichen der traditionellen
Schrift der Imajeghen um ihre Werkstücke auf der Rückseite zu
signieren. Da der Schreiber bei der Verwendung der Schrift die
Bedeutung der einzelnen Zeichen und die Schreibrichtung selbst
festlegen kann, bleibt die Aussagekraft solcher Signaturen beschränkt.
3 Vorhangschlösser aus derselben Werkstatt: 2 sind fast identisch, das
dritte, größere, weist auf der Rückseite dieselbe Markierung auf
Schriftzeichen erfüllen hier eine dekorative Funktion: Die Schlösser sind mit einer Reihe von „L"s markiert.
Eigenname „Abdallah Hamaduni" in arabischer Schrift, auf der Rückseite das Datum „1963". Niger (?)

SCHLÖSSER UND SYMBOLE
Das Schloss selbst ist ein Symbol für das Festhalten. Bei der ersten
Waschung eines Neugeborenen und zur Feier des „Vollen Monats" wurden
silberne Vorhangschlösser, die mit Segenswünschen oder Glückssymbolen
verziert waren, verschenkt. Das Kind wurde mit dem Schloss berührt und
sollte so an die Erde und das Leben gebunden werden. Schwächlichen
Kindern hängte man ein kleines, silbernes Schloss an einem roten Band
um den Hals, um es zusätzlich zu schützen. Aus demselben Grund gab man
Kindern auch sog. Milchnamen mit der Bedeutung „Eisenschloss" oder
„Doppelschloss".
Schlösser mit Schriftzeichen
Das gesamte Schloss kann die Form eines Schriftzeichens haben. Die
„Drei Wünsche" - Glück, Langes Leben und Reichtum wurden häufig
gewählt, das „Doppelte Glück" findet sich im Zusammenhang mit Heirat
und Eheglück. Diese Zeichen wurden ebenso auf die Schlösser
geschrieben. Säuglingen schenkte man oft ein „Schloss des Langen
Lebens" - auf diesem waren die entsprechenden 4 Zeichen eingraviert.
Häufig überreichte man Schlösser mit Aufschriften wie „Mögest du den 3.
Grad der Beamtenprüfung erreichen" oder „Der Examensbeste besteht die
kaiserliche Prüfung". Ein öffentliches Amt zu bekleiden bedeutete
Erfolg und Wohlstand.
Schlösser in Tierform
Das häufigste Tier auf Schlössern ist der Fisch. Er steht für Reichtum,
was durch den Gleichklang der chinesischen Worte für Fisch und Reichtum
abgeleitet wird. Außerdem ist der Fisch eines der 8 Glückssymbole des
Buddhismus. Die Fledermaus ist anders als in Europa ein Glück
verheißendes Tier. Auch hier ergibt sich diese Bedeutung aus dem
Gleichklang der Worte. Die Schildkröte tritt seit der Urzeit immer
wieder als Begleiterin der chinesischen Kulturheroen auf. Auch die 12
Tierkreiszeichen finden sich auf Schlössern, hier allen voran der Affe,
der in Südchina besonders verehrt wurde. Der Schmetterling ist
lautgleich mit einem „70jährigen Mann" und soll ein langes Leben
verheißen. Saiteninstrumente stehen für Reinheit und Treue. Neben den
traditionellen chinesischen Saiteninstrumenten und Trommeln wurden ab
dem 19. Jh. auch europäische Gitarren und Violinen in Schlossform
nachgebildet. Runde Münzen mit 4-eckigem Loch und traditionelle
Silberbarren sollen Reichtum bringen.
Der Lotos ist in einer seiner vielen Bedeutungen ein Sinnbild der
Reinheit, die Chrysantheme eines für Dauer und langes Leben. Kaum ein
Baum ist so symbolgeladen wie der Pfirsichbaum. Die Frucht ist das
häufigste Symbol der Langlebigkeit. Manche Formen, wie etwa Schlösser
in der Form von zwei Weltkugeln weisen klar auf europäische Einflüsse
hin.

GEHEIMGESELLSCHAFTEN
Obwohl die Bamana vorwiegend Muslime sind, existieren sogenannte
Initiationsgesellschaften. Die Aufnahme in diese Geheimgesellschaften
erfolgt im Rahmen von aufwändigen Initiationsriten, in deren Verlauf
die zukünftigen Mitglieder in die Geheimnisse rund um das Funktionieren
der Welt eingeführt werden.
Im N'tomo-Bund werden die unbeschnittenen Knaben aufgenommen. Die
Korè-Gesellschaft hat die Aufgabe, die jungen Männer auf das
Erwachsenenleben vorzubereiten und in ihrer männlichen Identität zu
festigen. Komo und Kono hingegen sind Bünde, die der Erhaltung des
Gleichgewichts sowohl unter den Menschen als auch zwischen ihnen und
der übersinnlichen Welt, zu der auch die Ahnen gehören, dienen sollen.
Diese Geheimgesellschaften kommen nicht unter allen Bamana vor, in
manchen Gegenden gibt es auch weitere Gruppen und Initiationsbünde für
Mädchen und Frauen.
Die Masken, die bei den öffentlich aufgeführten Tänzen getragen werden,
und geschnitzte Figuren, die bei rituellen Handlungen eingesetzt
werden, sind beliebte Sammelobjekte für Kenner der afrikanischen Kunst.
Bei den Schlössern greifen die Handwerker der Bamana auf die Formen
dieser Objekte zurück.
Acht hölzerne Fallriegelschlösser, in der Form von Masken des Korè - Geheimbundes.
Fallriegelschloss in der Form einer Maske des N'tomo - Geheimbundes.

SENUFO
Die Wohngebiete der Senufo liegen im Norden von Côte d'Ivoire, in
Burkina Faso und in Mali. Insgesamt gibt es etwa 4 Millionen Senufo.
Reich beschnitzte Türen waren Prestigeobjekte für die Häuser von
mächtigen Persönlichkeiten. Die ausgestellte Tür folgt zwar dem Aufbau
der traditionellen Arbeiten, sie dürfte aber erst im späten 20.
Jahrhundert geschnitzt worden sein. Im Mittelpunkt der in 3 Teile
gegliederten Schnitzerei steht ein Kreis, der eine Kalebasse oder das
Zentrum der Welt repräsentiert. In diese eingeschrieben ist eine
Schildkröte, die neben der Python, dem Krokodil, dem Chamäleon und dem
Vogel Calao zu jenen Tieren zählt, die in den Schöpfungsgeschichten der
Senufo eine Rolle spielen. Die Gesichter im oberen Teil sind
Abbildungen von Masken des Poro Bundes, Darstellungen von Europäern und
modernen Waffen beziehen sich zumeist auf Ereignisse der jüngsten
Vergangenheit. Das Krokodil, das ein Schlange verschlingt ist ein
Motiv, welches sich auch bei den benachbarten Baule findet und auf die
Rangordnung im Universum hinweist.

Tür aus Nordindien 20. Jh.

Prunkkassette „Palden Lhamo", Silber vergoldet und getrieben. Tibet/Nepal, 18./19. Jahrhundert
Um das Bildprogramm der Truhe zu verstehen, müssen einige Worte
vorausgeschickt werden. Palden Lhamo ist die bedeutendste
Schutzgottheit des tibetischen Buddhismus und die einzige weibliche
Gottheit in der mächtigen Gruppe der acht Dharma- Beschützter. Die
Göttin Palden Lhamo die als Hauptmotiv am Deckel platziert ist, gilt
als Beschützerin der Dalai Lamas und der Regierung Tibets. Sie reitet
auf einem Esel durch ein Meer von Blut und Fett und hält eine Schale
aus dem Schädel eines Kindes in der einen Hand. Darin liegen die
Sinnesorgane, das Herz und die Augen. In der anderen Hand hält die
Göttin eine Keule, bekrönt mit einem Vajra. Um ihren Körper ist eine
Schnur aus 15 abgetrennten Köpfen geschlungen, ein Schwert steckt im
Gürtel, eine Menschenhaut ist über ihren Rücken gebunden. Der Sattel
auf dem sie reitet, ist ebenfalls eine abgezogene Menschenhaut, deren
Hände und Füße zusammengebunden sind und deren Kopf nach daran hängt.
Die Mondsichel in ihrem Haar und die Sonnenscheibe an ihrem Nabel sind
Gaben des Gottes Vishnu. Eine Krone aus Schädeln mit flammenden
Edelsteinen sitzt auf ihrem Kopf.
Das Zaumzeug des Esels besteht aus Schlangen. Das Würfelpaar, das an
der Flanke des Esels hängt wird von Palden Lhamo benutzt, um das gute
oder schlechte kharmische Geschick der Lebewesen zu bestimmen. Ihre
Tasche ist gefüllt mit Gebrechen der Menschheit, da sie aus Mitgefühl
so viele Gebrechen wie möglich schluckt. Diejenigen, die sie nicht
schlucken kann, stopft sie in diese Tasche. Die Göttin hat zwei
Begleiter, die ihr zur Seite stehen, Makarsya und Simhasya. An den
Seitenwänden ist die gefesselte, rabenköpfige Frau mit Hängebrüsten
„linga" dargestellt. Skorpione fressen an ihr, die Inschriften und
Mantras in Sanskrit auf der Seite, sind Beschwörungsformeln. Auf der
anderen Seitenwand ist ein affengesichtiger, männlicher Geist zu sehen,
der anstatt der Fesselung mit verschiedenen Waffen durchbohrt ist.
Sanskrit-Inschriften an der Seite.
Die Vorderseite der Truhe zeigt den Esel der Palden Lhamo inmitten
eines Getümmels zwischen aasfressenden Vögeln, abgetrennten Gliedmaßen,
Schädelschalen, abgezogenen Häuten und Tieren. Daran schließen die acht
Glückssymbole an. Auf der Rückseite, auf einer Elefantenhaut, zwei
Schädelschalen mit senkrecht stehendem Donnerkeil, kreisförmig umgeben
von Gliedmaßen, Waffen und anderen Attributen. Daran schließt sich ein
Ring mit Tieren, der von den acht Glücksymbolen umgeben ist. Alle
Außenränder mit einer Leiste grinsender Totenköpfe, bekrönt von
Donnerkeilen, die mit Bänder, die ihnen aus dem Mund hängen, verbunden
sind. Zwischen ihnen züngeln Flammen. An der Unterseite schließlich ist
ein vierfacher Vajra mit umlaufender Inschrift und zwei tanzenden
Skeletten eingraviert.

Chitipati-Kabinett (tib. Torgam)
Holz mit getriebenem Silber beschlagen. Je ein tanzendes Skelett
(Chitipati) auf den Türflügeln umgeben von einer umlaufenden Leiste aus
Schädeln. Die tanzenden Skelette gehören zum Gefolge der zornvollen
Gottheit Mahakala.
Sie halten einen tantrischen Stab, eine gefüllte Schädelschale und sind umgeben von Körperteilen, Vögeln und Schakalen.

Kassette, Silber getrieben, vergoldet
Mit Halbedelsteinen besetzt und Sanskrit-Inschriften.
Darstellung der Palden Lhamo und tanzenden Skeletten an den Wandungen
Deckel mit fünfacher Darstellung der Vajravarahi. Nepal, Tibet, 19./20.
Jh.

Chitipati-Kabinett (Torgam)
Silbernes Kabinett mit zwei Türen und Sockellade. Die tanzenden
Skelette gehören zum Gefolge der zornvollen Gottheit Mahakala. Sie
halten einen tantrischen Stab, eine gefüllte Schädelschale und sind
umgeben von Körperteilen, Vögeln und Schakalen. Eine umlaufende Leiste
aus Schädeln sowie die Deckelblende mit Organen, menschlichen Häuten
und Vögeln ergänzen die Ornamente.
Gebetsmühle, Nepal 20.Jh.
Silberne Gebetsmühle mit getriebenen Symbolen der acht Gottheiten, die Opfer darbringen. Acht Glückssymbole.
Der Deckel der Trommel mit dem Chakrenrad und einem Lotus. Im Inneren
dicht eingedrehtes Papier mit Gebeten. Durch das Gewicht gerät die
Gebetsmühle in Bewegung. Bei jeder Umdrehung werden die Mantras im
Inneren genutzt um gutes Karma anzuhäufen.

Schlüssel, Schlösser und Kästchen aus Asien
Im asiatischen Raum findet man eine Vielzahl an Schlüsseln, Schlössern,
Kästchen und Kabinetten. Einige weisen interessante Besonderheiten oder
zusätzliche Funktionen auf.
Amulettschlösser
In China war es üblich Neugeborenen ein kleines Vorhangschloss aus
Silber oder Alpaka (Neusilber) als Anhänger um den Hals zu hängen.
Diese Tradition ist mit den Schutzengelketten in Österreich
vergleichbar. Die Vorhangschlösser hatten häufig die Form von Wolken.
Diese geht zurück auf den Lin Zhu Pilz, der für ein langes Leben steht.
Die Schlösser waren mit guten Wünschen und Glückssymbolen versehen.
Oftmals wurde das Geld von den Nachbarn und Freunden der jeweiligen
Familie gesammelt, was durch Inschriften auf dem Schloss belegt ist.
Wurfschlüssel
In Tibet kannte man für die großen Schlüssel der Vorhangschlösser noch
eine weitere Verwendung außer sie zum Sperren zu benutzen. Tibetische
Kriegermönche, die so genannten „Dob Dob“, verwendeten die Schlüssel
als Wurfwaffe. Der Schlüssel wurde an einem Lederband befestigt, im
Kampf dem Gegner entgegengeschleudert und am Band wieder zurückgezogen.
Türklopfer
In einigen Teilen der islamischen Kultur war es Frauen nicht gestattet,
einem Mann die Tür zu öffnen. Um das zu verhindern, wurden die Türen
mit zwei Türklopfern mit unterschiedlichem Klang ausgestattet. Wenn
eine Frau anklopfte, musste sie den kleinen Türklopfer mit hellerem
Klang betätigen. So wusste die Bewohnerin, dass sie die Tür ohne
Probleme öffnen konnte. Ertönte der tiefere Klang des größeren
Türklopfers, so stand ein Mann vor der Tür. Dann öffnete entweder der
Hausherr oder ein Diener dem Gast die Tür.
Chitipati-Kabinette
Ihre Bezeichnung haben diese silbernen Kabinette aufgrund der darauf
dargestellten. tanzenden Skelette, den „Chitipati“. Der Name bedeutet
"Herr der Leichenhalle". Diese Wesen gehören zum Gefolge der Göttin
Palden Lhamo, der einzigen zornvollen, weiblichen Gottheit im
Buddhismus. Um die Chitipati herum sind häufig Vögel, Schakale und
abgetrennte, menschliche Gliedmaßen zu sehen. Weiters halten sie
tantrische Gegenstände. Die Kabinette dienten zur Aufbewahrung von
Opfergaben an die Gottheit, die auf tibetisch „torma“ genannt werden.
Weiße, runde Tormas waren für die friedvollen Gottheiten, rote, spitze,
für die zornvollen Gottheiten.
Sadeli-Mosaik
Eine spezielle Technik der Einlegearbeiten (Intarsien) stellen die
Sadeli-Mosaike aus Indien dar. Verschiedene Materialien wie Ebenholz,
Bein oder Zinn werden stabweise miteinander verbunden und dann in dünne
Scheiben geschnitten. Diese werden dann einzeln auf das Objekt geklebt.
Diese Technik kam über Persien nach Indien und erfreute sich im England
der Kolonialzeit großer Beliebtheit. Vor allem Näh- und
Schreibkassetten sowie Kabinette wurden mit Sadeli-Mosaiken verziert.
* * *
Nepalesische Vorhangschlösser
Spreizfedernschloss in der typischen nepalesischen Form mit Stupa,
Flügeln und Kette. Schlosskörper und Flügel mit durchbrochener, in
florale Muster geschnittener Eisenplatte. Bügel und Flügel mit
durchbrochenem Messing verkleidet. Schlüsselgriff ziseliert. 19. Jh.
Nepalesische Form mit Elefanten und Schneelöwen als geschnittenes Motiv. 19. Jh.

Nähkassette, Elfenbein geschnitzt
Rechteckige, reich geschnitzte Kassette mit Messing- beschlägen. Als
Einsatz zahlreiche Spulen, Dosen und Zubehörteile aus Elfenbein. Die
feine Schnitzerei zeigt Figuren in einer Stadtlandschaft oder in einem
Garten mit Brücke, Weiden und Pavillons. China, Kanton, Mitte 19. Jh.
Kassette Elfenbein
Deckel zum Aufschieben, im Inneren verschieden Unterteilungen.
Wandungen mit bewaffneten Kriegern in mehrfach gewölbten Arkaden.
Mogul-Zeit (1500-1850)

Indische Vorhangschlösser, 19./20. Jh.
Messing-Pfau, ehemals Sammlung Peter Phillips
Fünf Messing-Tiger, Provinz Gujarat
Vier Skorpione aus Eisen, Region Rajasthan
Stehender Mann, Messing mit Gewindeschlüssel.
Segnende Göttin mit erhobener Hand, Messing
Zwei goldtauschierte Schlösser in Form des Affengottes „Hanuman" mit Krone und Keule

Im Zusammenhang mit den napoleonischen Kriegen stand die große
Verbreitung des Eisengusses sowohl im Öffentlichen Bereich wie für
Brücken, Denkmäler oder Brüstungen, als auch im privaten Bereich. Hier
hat der Mangel an Edelmetall die aufkommende patriotische Gesinnung
symbolisiert unter dem Motto „Gold gab ich für Eisen" und im Tragen von
eisernem Schmuck. Im Schmuck aus Gusseisen vereinigte sich der
dekorative mit dem nationalen Charakter. Eisen war billig und im
eigenen Land abzubauen, es hatte Symbolcharakter und forderte zum Kampf
auf. Zur Aufwertung des Eisenschmuckes trug auch der höchste Orden der
Befreiungskriege bei, das „Eiserne Kreuz“, welches 1813 erstmals
verliehen wurde.

Das eiserne Gold - Das 19. Jahrhundert war die Hochblüte des Eisens.
In den stürmischen Zeiten der Napoleonischen Kriege waren die Menschen
auf ein Material angewiesen, das es überall ausreichend zu finden gab
und mit dessen Hilfe die Gegenstände des Alltags hergestellt werden
konnten. So begann man mit dem Abbau des Eisens und dessen Verarbeitung
in den Hütten und Gießereien der Länder Zentraleuropas. Durch diverse
Erfindungen wurde das Gießen immer weiter erleichtert und schon bald
hatten sich viele Gießereien in den Städten angesiedelt, die ihre Öfen
zuerst mit Holz und danach mit Koks beheizten.
Neben Alltagsgegenständen wie Kerzenleuchtern, Aufsatzschalen,
Waffeleisen und Christbaumständern wurden auch Taschenuhrenhalter,
Spiegelrahmen, Zettelhalter und Tintenfässer, kleine Kästchen, aber
auch Schachfiguren, Spielmarken, Medaillen und Büsten berühmter
Persönlichkeiten gegossen. Herausragend sind die sogenannten
Neujahrskarten, die von einigen Gießereien zu Jahresbeginn verschickt
wurden.
Erwähnenswert ist auch der gusseiserne Schmuck, der nicht nur
ausnehmend filigran war, sondern auch eine patriotische Komponente
bekam, als Königin Louise von Preußen verstarb und sich die feinen
Stücke zu einer Art Trauerschmuck entwickelten. Interessant sind auch
die Lithophanienständer, jene gusseisernen Rahmen, die fein gepresste
Porzellanplatten hielten, hinter denen eine angezündete Kerze ein
feines Bild erscheinen ließ. Beliebt waren auch Nachgüsse von
historischen Funden, wie etwa jener der,,Warwick-Vase" oder
des,,Hildesheimer Silberschatzes". Doch nicht nur die Räume der Häuser
waren gefüllt und dekoriert mit dem schwarzen Eisen. Auch
Balkongeländer und Treppenhäuser, Gartenzäune, Bänke und Laternenpfähle
wurden aus Gusseisen hergestellt. So ergibt sich ein recht deutliches
Bild, wie wichtig das Eisen im 19. Jahrhundert gewesen war. Übrigens
verdankt das Eisen seine Schwärze dem Graphit, welches das Rosten bis
zu einem gewissen Grad zu verhindern weiß. Bevor der Bronzeguss jedoch
den Eisenguss verdrängte, wurde das schwarze Eisen noch verzinnt,
vernickelt, bemalt oder emailliert, um etwas mehr Farbe in die Häuser
zu bringen.

Büste eines unbekannten Mannes Ev. Solon, Athenischen Staatsmann Königl. Preuß. Gießerei, 19. Jh.
Statuette Graf von Reden, Nachbildung eines Denkmals, Gießerei Gleiwitz 1887
Heinrich IV. v. Frankreich, 1553-1610, Gießerei Sayn 1824/26
Kaiser Franz Joseph I., 1830-1916, Gießerei unbekannt, 20. Jahrhundert

Amazonen- und Germanensäule - Eisen gegossen und Silber tauschiert.
Nach einem Modell von August Fischer, gegossen von Ferdinand Daniel
Otto Grüttner und ziseliert von Ludwig Wilhelm Vollgold. Königlich
Preußische Eisengießerei Berlin. Datiert 1837 und 1860

Bei der Amazonensäule verteidigt eine auf dem Pferd sitzende Amazone
ihre Mitstreiterin. Diese Säule ist auf der Neujahrskarte von 1837
abgebildet und wurde 1838 auf der Akademie-Ausstellung gezeigt. König
Friedrich Wilhelm erhielt diese als Geschenk und die Säulen standen bis
1856 in seinem Vorzimmer. Er verehrte ein Exemplar dem König Ludwig
Philipp von Frankreich, der sie 1848 in den Louvre abgab, wo sie heute
noch stehen. Beide Säulen lassen sich in viele Einzelteile zerlegen.

Büste der Kaiserin Elisabeth (1837-98)
Abguss der Marmorbüste von Victor Tilgner (1844-96)
Bildhauer und Vertreter des neobarocken Historismus. Die Kaiserin ist
in der Robe dargestellt, die sie zur ungarischen Krönung 1867 trug.
Gießerei Meindl-Breit, Wien


Komplettes Schachspiel „Die Hermannsschlacht"
Könige: Germanenführer Arminius und röm. Feldherr Varus, Gießerei Zimmermann, Hanau, Um 1850

Mechanische Sparkasse, Ein Jäger schießt auf Baum, Gießerei unbekannt, 20. Jh.

Münzschlucker in Form eines Skeletts. Gießerei unbekannt. 20. Jh.


Rechteckige Kassette. Auf dem Deckel sitzt Putto mit Perlenkette. Gießerei unbekannt,s 19. Jh.


Kamin- und Ofenzubehör
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gelang durch die Verbesserung der
Heizsysteme (z. B. „Hinterlader-Ofen", der vom Flur aus den Salon
beheizte), eine Kultur um Ofen und Kamin. Dazu gehörten neben einem
repräsentativen Ofen auch ein offener Kamin mit den dazu passenden
Accessoires wie Kaminbesteck zum Schüren des Feuers, Feuerböcken zum
Auflegen der Holzscheite und ein Kohlekasten.


Der Aufstieg der Zünfte
Die mittelalterliche Struktur der Zunft, als wirtschaftlicher und
sozialer Verband, der ähnliche Grundbedingungen für alle
Gewerbetreibenden schaffen sollte, um so Rechtsstreitigkeiten
vorzubeugen, blieb bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Neben
Schriftquellen setzten sie auf Symbole und Zeremonien, die vom Leiter
der Zunft, dem Zunftmeister, bei geselligen und geschäftlichen
Zusammenkünften ausgeführt wurden. Zünfte regulierten das private und
soziale Leben der Handwerker, sie verbanden soziale Sicherheit mit
sozialer Enge. Die strenge Befolgung aller Regeln wurde akribisch
überwacht, um die Qualität des Handwerkers hoch und um unliebsame
Konkurrenz nieder zu halten. Durch die vorgeschriebenen Zunftordnungen
nahmen Zünfte unmittelbar auf die Qualität der Erzeugnisse und deren
Verarbeitung Einfluss. Durch ein sichtbares Zeichen wie dem
Meisterstempel, kam es zur Qualitätskontrolle aller Stücke und bewahrte
Kunden vor Mängel und Manipulation.

Zunfttruhe, datiert „1628"
Große Truhe mit Deckelfach, Geheimfach im Inneren und Geheimfach im
Boden. Gebläutes und geätztes Schloss Initialen und Jahreszahl im
Deckel.

Zunftzeichen der Leinenweber mit Darstellung des Hl. Severin und von Maria mit Kind. 1833

Lehrzeit
Nur wer selbst mit seinen Angehörigen eine christlich-redliche
Lebensweise nachweisen konnte, also ehrlich war, durfte ein Handwerk
erlernen und dazu gehörte u.a. eine eheliche Geburt. Zwischen 12 und 18
Jahren lag das Alter beim Antritt, dem „Aufdingen" vor der offenen
Zunftlade und die Lehre dauerte zwischen drei und fünf Jahren. Der
Lehrling wohnte im Haushalt des Meisters und musste, neben dem Handwerk
auch Rechnen und Schreiben erlernen. Jeder Lehrling hatte einen Bürgen,
der seine Redlichkeit bezeugte und für die Bezahlung des Lehrgeldes
haftete. Am Ende der Lehrzeit wurde der Lehrling los- oder
freigesprochen, eine Prüfung gab es nicht.
Gesellenzeit
Nach der Lossprechung (der heutigen Lehrabschlussprüfung) wurde der
Geselle zum wichtigsten Werkstattmitarbeiter - alleine durfte er noch
keine eigene Werkstatt führen. Diese konnte er erst nach dem Ablegen
der Meisterprüfung leiten. Die Wanderschaft der Gesellen konnte ein bis
vier Jahre dauem. Wandernde Gesellen kehrten in Zunftherbergen ein,
erhielten für einige Tage Unterkunft und ein „Geschenk" in Form von
Geld. Einschreibbücher dienten der Kontrolle und Koordinierung der
wandernden Gesellen, sogar die Reihenfolge der besuchten Meister, wurde
während der „Umschau" in Meisterlisten eingetragen. Nach Beendigung der
Arbeit erhielt der Geselle ein Zeugnis, „Kundschaft" genannt. Vor der
Einführung dieser schriftlichen Bestätigung dienten Redewendungen
(„...Stück davon...") oder das Abfragen von Sehenswürdigkeiten als
Nachweis zur Identifizierung eines ehrlichen Gesellen. Gesellen „auf
der Walz" waren bis ins 19. Jahrhundert die größte Gruppe der Reisenden
im deutschsprachigen Raum, wobei die meisten auch im deutschsprachigen
Gebiet blieben. Nach der Wanderzeit ließ sich der Geselle fix für
mehrere Jahre bei einem Meister nieder und begann die „Muthzeit". Mit
der Muthung, d.h. der Anmeldung zur Meisterschaft und dem Ablegen des
Meisterstückes, endete die Gesellenzeit. Söhnen von Meistern oder
Gesellen, die eine Meisterswitwe geheiratet hatten, konnte diese Frist
verkürzt oder gat erlassen werden. Mancherorts verbot man die Wanderung
der Gesellen und sorgte für ein „gesperrtes Handwerk" um
Produktionsgeheimnisse zu wahren. Das Zunftwesen geriet im 18.
Jahrhundert zunehmend unter Druck die Zahl der Gesellen vergrößerte
sich ohne dass sie Meister werden konnten. Ursache dafür waren
Bevölkerungswachstum, Absatzkrisen und Konkurrenzdruck. Spontan und
gezielt setzten sich die Gesellen dagegen zur Wehr, was wiederum für
spezielle Verordnungen und die Auflösung der „Gesellenschaften"
innerhalb der Zunft sorgte. Neben dem Streik nutzten Gesellen das
Mittel des Verrufs oder der „Schimpfung", das ein besonders starkes
Druckmittel war. Das „geschimpfte Handwerk" einer Stadt erhielt so
lange keine Gesellen mehr, bis der Streit beigelegt werden konnte.
Meisterprüfung
Nach der Wanderzeit und der Muthjahre konnte der Geselle ein
Meisterstück abgeben, das als Befähigungsnachweis diente. Es musste
alle gängigen Be- und Verarbeitungstechniken des jeweiligen Gewerbes
umfassen und bestand aus mehreren Teilen, die bei der Prufung eingehend
untersucht wurden. Danach war er als Meister berechtigt Lehrlinge
auszubilden und eine eigene Werkstatt zu betreiben. Um die Anzahl der
Meister eines Handwerkes nieder zu halten, führte eine Auslese in Form
von üppigen Meistermahlen, hohem Meistergeld, der Beschaffung von
Werkzeugen und der Anschaffung von teuren Materialien für das
Meisterstück zu Hürden, deren Bewältigung viele Gesellen nicht
bewerkstelligen konnten. So blieb ihnen nichts anderes über, als
lebenslang ein Geselle zu bleiben. Aus dem Kreis der Meister wurde ein
Zunftvorsteher gewählt. Er wurde vereidigt, hatte häufig ein eigenes
Siegel und verwahrte die Zunftlade. Daneben hatte der Vorsteher ein
Entscheidungsrecht über die Annahme des Meisterstückes oder die
Bewertung von Qualitäten.

Mit diesem neu gestalteten „Themenzimmer" können Sie in die Welt des
Eisenkunstgusses eintauchen. Diese hatte ihren Höhepunkt im 19.
Jahrhundert. Sie sehen symbolisch eine kleine Wohnung mit Küche und
Schlafzimmer, dazu einen Arbeitsraum und einen kleinen Garten.

Sowohl das Interieur als auch die Gerätschaften wie Ofen, Herd, Bett
oder Töpfe dazu Uhren, Thermometer, Sessel, Brunnen und Stehlampe sind
aus Eisen gegossen. Diese Zeugen einer längst vergangenen Zeit sollen
Sie auf eine Erinnerungsreise mitnehmen, in der Ihnen möglicherweise
das eine oder andere Stück aus Ihrer eigenen Kinder- und Jugendzeit ins
Gedächtnis kommt.

Beschläge, Türklopfer und Türzieher
Beschläge wie Langbänder, Zierbänder, Schlüsselschilder, Türklopfer,
Türzieher und Drücker dienen primär der Stabilität und der Sicherheit,
sekundär der Dekoration von Türen, Truhen, Kästchen oder Kästen. Bänder
entfernen sich ab der Epoche der Gotik weg von der zusammenhaltenden,
hin zur schützenden und dekorativen Funktion.
Die Halterung der einzelnen Bretter wird durch die Rahmung
gewährleistet, schwere Eisenbeschläge an Truhen und Türen sind
zunehmend durchbrochen, verästelt und enden in Lilien. Reich
durchbrochene Bänder, wie sie vor allem in der Renaissance beliebt
werden, sind feinste Eisenschnitt-Meisterleistungen. Bei Schnitzereien
an Toren oder Wänden von Kassetten störten die Bänder. Sie wurden immer
kleiner oder an die Innenseite verlegt. Das heißt aber nicht, dass sie
nicht weniger aufwändig als die sichtbaren Bänder gearbeitet wurden.
Vom Konstruktions- zum Zierelement geworden sind die Zierbänder und
Zierbeschläge, die ihren Höhepunkt im Rokoko erreichten. Das
Beschlagwerk ist zum reinen Schmuck und eigenständigen Kunstwerk
geworden. Schlüsselschilder sind dann auf Türen oder Möbeln zu finden,
wenn das Schloss an der Türinnenseite angebracht ist. Das
Schlüsselschild umspielt das Schlüsselloch und spiegelt in der
Ornamentauswahl den Geschmack der Epoche. Unter allen Beschlagarten
haben sie im Laufe der Zeit jeden Stilwandel mitgemacht und sind auch
heute Bestandteil jedes Tür- oder Möbelschlosses. Türklopfer dienen der
akustischen Kundgabe, wenn an der Haustür kein Wärter stand oder keine
Glocke angebracht war. Der Türzieher hat keine Meldefunktion, sondern
wird benutzt, um die Tür aufzuziehen oder zuzumachen.
Die elementare Funktion der Türklopfer spiegelt sich im Klopfring mit
schwerem Hammer wieder, der allen Klopfern eigen ist und der
dazugehörigen Anschlagplatte, die meist reich durchbrochen und
getrieben hergestellt ist. Neben ovalen oder herzförmigen Objekten
sowie Türklopfern in Leierform, ist die bekannteste Gestalt die des
Ringes oder des länglichen Türklopfers. Groteske Figuren und Gebilde
aus Fauna und Flora sind am häufigsten in der Gotik und der Renaissance
zu finden. Seit der Römerzeit erscheint das Motiv des Löwenkopfes mit
Klopfring im Maul. Vorerst bei Kirchentüren, später dann im profanen
Bereich begegnen uns die Löwenköpfe mit aufgerissenem Maul und
ausdrucksstarker Mähne bis ins 19. Jahrhundert. Der Kopf ist umgeben
von einzelnen Strähnen, die teils symmetrisch angeordnet sind und in
kleinen Locken enden. Aufwändige bronzene Türklopfer verschönern die
Portale großer Paläste des 16. Jahrhunderts. Die Bronzeklopfer haben
die Gestalten mythologischer Figuren.
Ein anderes, weit verbreitetes Motiv, ist der Klopfer in Form einer
Hand, die einen Stein hält, um damit an die Tür zu schlagen. Vielfach
schmücken die Hände sehr realistische Details wie Ringe, Manschetten
oder Armreifen. Diese besondere Form des Klopfers hat sich
wahrscheinlich vom Kaukasus aus verbreitet: Man nimmt an, dass sie in
der Bildsprache des Orients vor dem bösen Blick und vor Unheil im Haus
schützt. Beschläge helfen, den Gegenstand auf dem sie angebracht sind,
zu datieren. Anhand ihrer Ausformung und Ausführung bekommt man ein
klareres Bild bei der Einordnungin die jeweilige Epoche. Klar ist aber
auch, dass es gerade die Beschläge sind, die wegen ihres ästhetischen
Aspektes in großer Zahl auf Türen, Kassetten und Truhen angebracht sind
und sich zum eigenständigen Sammelgebiet entwickelt haben.

Das Letzte Abendmahl (Leonardo da Vinci)
Seit seiner Vollendung im Jahre 1498 war das Fresko im Refektorium des
Klostes Santa Maria delle Grazie in Mailand das meist kopierte Werk
dieses Themas. 1800 vollendete Raffael Morghen den Kupferstich, der als
eine der besten Wiedergaben diese Freskos galt. Nach diesem Kupferstich
fertigte Leonhard Posch sein Modell des „Abendmahles", 1822, an. Das
Relief wurde 1823 in Berlin, später auch in Gleiwitz gegossen.
Zahlreiche Nachgüsse erfolgten durch die Hütten Lauchhammer, Buderus,
Carlshütte, Mariazell und andere. In verschiedenen Größen gegossen,
erscheint uns heute Da Vincis „Abendmahl" allgegenwärtig.
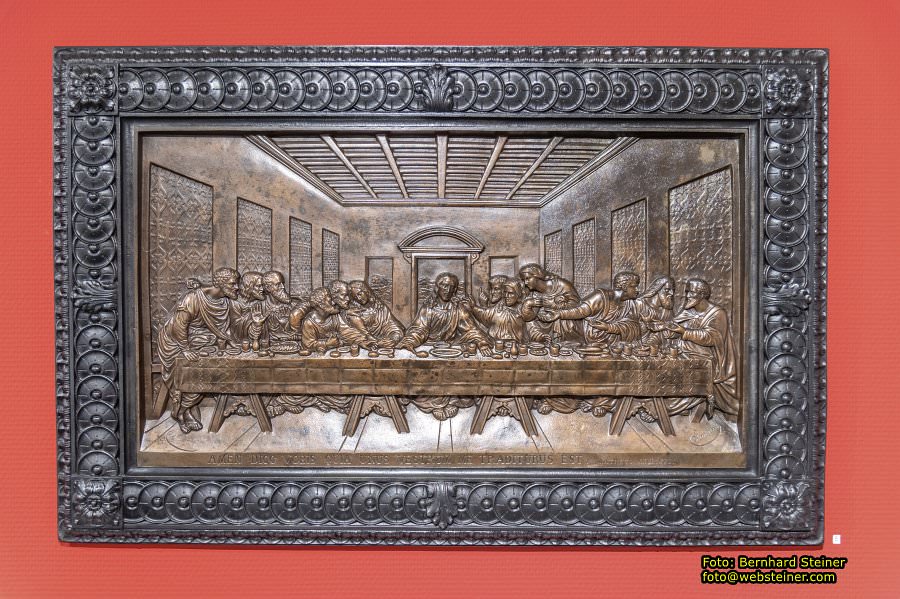
Opferstöcke
Wurden in den ersten Anfängen aus einem ausgehöhlten Baumstamm
(althochdeutsch „stock"- Baumstumpf) gefertigt. Später stelle man sie
nicht nur aus Holz, sondern auch aus Eisen oder Stein her. Bei größeren
Opferstöcken sieht man häufig mehrere Verriegelungen. So war nicht nur
ein rasches Aufbrechen erschwert, durch Verteilen der Schlüssel auf
mehrere Personen konnte diese niemand alleine leeren und in Versuchung
geraten. Im kirchlichen Almosenwesen gab es, ergänzend zum fest
verankerten Opferstock der vor dem Gotteshaus, in der Kirche am Boden
oder an der Wand befestigt war, auch Sammelbüchsen die herumgereicht
wurden.

WITWERSCHLÜSSEL
Witwerschlüssel waren vor allem in Österreich und in Süddeutschen Gebieten gebräuchlich.
Es sind kleine, silberne Schlüssel mit Voluten in der Reide (Griff) und
im Bart - man kann sofort erkennen, dass es sich um keinen sperrenden
Schlüssel handelt, sondern um sog. "symbolischen Schlüssel", die an der
Uhrkette der Taschenuhr getragen wurde.
Wenn Mann und Frau geheiratet haben, hat die Frau am Tag der Hochzeit
die Schlüsselgewalt übernommen, d.h. sie konnte im Namen ihres Mannes
Rechtsgeschäfte abschließen und trug einen großen Schlüsselbund an
einem Gürtel um die Taille, an dem die Schlüssel für alle Schränke,
Türen und Truhen des Hauses hingen. Verstarb die Frau früher, so wurde
der Mann Witwer und trug als Zeichen der Trauer aber auch als Zeichen
und Aufforderung an andere Damen, fortan einen kleinen, silbernen
Schlüssel an der Uhrkette der Taschenuhr, den sogenannten
Witwerschlüssel. Die Frauen wussten so, dass dieser Mann seine
"Schlüsselgewalt" wieder abgeben will.

ZUCKERDOSE UND TANTALUS-FLASCHE
Sowohl die Zuckerdose, meist aus Silber, als auch die Glasflaschen mit alkoholischem Inhalt waren verschlossen.
Damit die Dienerschaft weder Zucker naschen noch einen Schluck aus der
Alkoholflasche nehmen konnte, bewahrte die Hausfrau den Schlüssel zu
diesen beiden Gegenständen am Schlüsselbund auf. Die fest versperrten
Flaschen werden nach dem reichen König Tantalos benannt. Er wurde nach
Gräueltaten, in den Tartaros und zu lebenslangem Hunger und Durst
verbannt.


Kästchen, Messing gegossen und feuervergoldet.
Innen mit grünem Samt ausgelegt Fa. Erhard und Söhne, Schwäbisch Gmünd, um 1900
Giebelkassette aus Messing, gegossen. Szenen aus der Legende des Hl.
Sebaldus nach den Reliefen von Peter Vischer aus dem Sebaldusgrab in
Nürnberg. Fa. Erhard und Söhne, Schwäbisch-Gmünd, 1885-86

Kabinettschränkchen mit Email-Einlegearbeit.
Künstler: Ratzersdorfer oder Stork. Wien, 19. Jh.
Kleines Kabinett mit drei Laden und Bemalung.
An den Ecken vier Putti, Deckelbekrönung durch Löwen der eine Inschriftentafel hält „PAX CIVI“. 19.Jh.

Zuckerdose aus Silber
Von einem Elefanten getragen, mehrfach punziert. Vermutlich aus dem Besitz Kaiser Franz Joseph I., Wien 1855

BIEDERMEIER 1815-1848
Bürger sehnten sich nach Frieden (Napoleonische Kriege) - zogen sich
aus Politik zurück - erstrebten einfaches besinnliches Leben. Name
stammt aus den "Fliegenden Blättern" (politisch satirische Zeitung) -
beschrieb Zeitgeist.
Kennzeichen: Kunst beschränkte sich auf vertraute Umwelt - vornehmlich
auf angenehme Seiten, wobei soziale Mißstände geflissentlich übersehen
werden
Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865), Peter Fendi, Friedrich Gauermann
Kunsthandwerk: Möbel, Porzellan, Gläser, Kleinkunst, Gemälde

Turmkästchen aus Walrossbein, tlw. grün gefärbt und geschnitzt. Provinz Archangelsk, Russland, 19. Jh.
Kassette mit Walmdeckel, Walrossbeinplatten auf Nadelholz, im Wechsel,
teils graviert, teils geschnitzt. Russland, Dorf Cholmogory, Provinz
Archangelsk, 19. Jh.
Russisches Kleinmöbel in Form eines Sekretärs, aufklappbar und mit
Lade. Walrosszahn. Russland, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19.
Jh.
Holzkästchen mit geschnitzter Beinauflage und Folien unterlegt. Russland, 19. Jh.
Holzkästchen mit geschnitzter Beinauflage und Folien unterlegt. Russland, 19. Jh.
Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19. Jh.
Spielkassette, Walrossbein geschnitzt. Im Inneren vier Dosen für
Spielmarken und zwei kleine Besen zum Reinigen des Tisches. Am Deckel
zu sehen ist Michael Kutusov, Prinz von Smolensk mit Soldaten und
Türken. Provinz Archangelsk, 19. Jh.
Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, 19. Jh.
Russ. Beinkästchen mit reich geschnitzten Einlagen, Dorf Cholmogory, Provinz Archangelsk, dat. 1811.

Werkstatt der Familie Embriachi
Mit Beginn des 15. Jh. übernahm Italien von Frankreich die führende
Rolle in der Elfenbeinkunst. Der aus Florenz stammende Baldassare degli
Embriachi gründete Anfang des 15. Jh. in Venedig eine Werkstatt und
erlangt mit seinen Kästchen und Truhen großes Ansehen und Wohlstand.
Embriachis Kästchen sind vier-, sechs- oder achteckig und zumeist nicht
aus Elfenbein sondern aus Bein hergestellt. Die figuralen Darstellungen
zeigen in der Regel abgeschlossene Szenen und im Hintergrund
Landschafts- oder Architekturornamente. Ein weiteres Merkmal ist das
sogenannte „Certosina-Muster" am Rahmen. Gemeint sind damit
Mäanderbänder, welche mittels Einlegetechnik aus kleinen Bein-, Horn-,
Zinn- oder Ebenholzplättchen zusammengesetzt werden und ein
geometrisches Muster ergeben.
Embriachi Kästen, Holzkorpus und Bein. Im Relief Engel und paarige
Figuren. Einige Ergänzungen aus dem 19. Jh., Italien Anfang 16. Jh.
Embriachi Kästen, Holzkorpus und Bein. Im Relief Paare und Wappenschilde. Italien Anfang 16. Jh.

BAROCK 1600-1780
vom Portugiesischen "barucca" schiefrund, verschnörkelt findet im
Rokoko (zweite Hälfte 18. Jahrhundert) seinen Ausklang. Ende der
Glaubenskämpfe und der Türkengefahr - Kampf der Herrschergeschlechter
in Europa (Ludwig XIV, Leopold I, Prinz Eugen, Karl VI und seine
Tochter Maria Theresia)
Kennzeichen: Bewegung in der Architektur, Übermaß an Formen, Farben und
Kraft. Macht der Fürsten, Kirche und Bürgertum spiegelt sich in der
Architektur wider
Architektur: Palais Attems (Graz) von Andres Strengg
Malerei: Anton Franz Maulpertsch (1724-1796), Paul Troger (1698-1762),
Peter Paul Rubens (1577-1640), Johann Martin Schmidt (1718-1801)
Kunsthandwerk: Möbel, Porzellan, Gläser, Schmiedeeisen, Gemälde

Türschlösser mit Eisen getriebener Schlossdecke, Barock
Möbelschlösser mit Eisen getriebener Schlossdecke, Barock
Möbel- und Türschlösser Schlossdecke graviert mit Stadtansichten, 18. Jh.

Höfische Prunkkassette aus Salzburg
Diese prunkvolle Schreibschatulle wurde um 1740 von Hof-Silberschmied
Georg Martin Gizl für den Salzburger Fürsterzbischof Leopold Anton von
Firmian (1679-1744) gefertigt. Hergestellt aus vergoldetem Kupfer mit
durchbrochenen, blattvergoldeten Ornamenten auf der gesamten
Außenfläche, ist diese ungewöhnliche Schatulle ein ganz besonderes
Exemplar. Auf dem Deckel ist eine Jagdszene eingraviert, die auf beiden
Seiten mit freistehenden Eckbalustern flankiert wird. Im Inneren ist
der Deckel mit einer durchbrochenen Ornamentik versehen, in der sich
das Auge Gottes mit einem eingearbeiteten Granat inmitten eines
Strahlenkranzes befindet. Die Rückseite der Kassette zeigt uns eine
thematisch ähnliche Reiterszene. Auf der Vorderseite ist das Wappen des
Fürsterzbischofs von Firmian im Zentrum, welches das Schlüsselloch
verdeckt. Über dem Wappen befinden sich zwei Adler, die eine Vase
halten. Zusätzlich befindet sich auf der Vorderseite eine gravierte
Inschrift, die dem Auftraggeber Leopold Anton von Firmian gewidmet ist.
Leopold Anton von Firmian entstammte einem Tiroler Adelsgeschlecht und
wurde in München geboren. Von 1724 bis 1727 war er Bischof von Seckau.
Von 1727 bis zu seinem Ableben 1744 Fürsterzbischof von Salzburg.
Die lateinische Inschrift
CELSISSIMUS AC REVERENDISSIMUS DOMINUS LEOPOLDUS, ARCHIEPISCOPUS ET
SACRI ROMANI IMPERI EXCELSUS PRNCEPS SALISBURGENSIS SACRAE SEDIS
APOSTOLICAE LEGATUS NATUS GERMANIAE PRIMAS EX ILLUSTRISSIMA ET
ANTIQUISSIMA PROSAPIA LEBERORUM BARONUM DE FIRMIAN
bedeutet übersetzt
DER AUSGEZEICHNETSTE UND EHRWÜRDIGSTE GEBIETER LEOPOLDUS, ERZBISCHOF
UND HOHER FÜRST DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHES, HERRSCHER VON SALZBURG,
VERMÄCHTNIS DES HEILIGEN APOSTOLISCHEN STUHLS, IN DEUTSCHLAND GEBOREN,
DER ERSTE DER AM MEISTEN DARGESTELLTEN UND ÄLTESTEN LINIE DERER VON
FIRMIAN.
Rechts davon befindet sich die Signatur des Hof-Silberschmieds Georg Martin Gizl.

RENAISSANCE 1500-1620
vom Italienischen "rinascimento" Wiedergeburt, Erneuerung der Antike. Ausgangsland ist Italien (Geist der Antike).
Aufschwung der Wissenschaften, Erfindung des Buchdrucks, Kompaß und Feuerwaffen (Schießpulver)
Entdeckungen: Amerika, Seeweg nach Indien, erste Weltumsegelung
Maler und Bildhauer: Michelangelo Buonarotti (1475-1564), Raffaelo
Santi (1483-1520), Tiziano Vecell (1476-1576), Leonardo da Vinci
(1452-1519), Pieter Bruegel der Ältere (1525-1569)
Kunsthandwerk: Möbel, Kästchen, Kassetten, Kabinette, Gemälde, Kleinkunst

Französische Möbel- und Türschlösser 18. Jahrhundert
Französische Truhenschlösser, Meisterstücke 17./18. Jahrhundert
Französische Riegel, 16.-18. Jahrhundert


Bergkristall-Kassette, Venedig um 1600
Vergoldeter Holzrahmen mit floralem Muster umgibt den geschliffenen Bergkristall in geometrischen Feldern.
Vermutlich Geschenk eines Papstes an den männlichen Thronfolger eines europäischen Herrscherhauses.

Päpstliche Schlüssel
Das Papstemblem der gekreuzten Schlüssel mit der Tiara ist das Symbol
der zeitlichen und geistlichen Ordnung des Papstamtes. Der silberne
Schlüssel der linken Seite versinnbildlicht die Gewalt zu schließen
(potestas ligendi), der goldene Schlüssel der rechten Seite, die Gewalt
zu lösen und zu öffnen (potestas solvendi). Die Päpste begannen im
Mittelalter kleine Goldschlüssel mit Feilspänen von den Ketten des
Petrus an Bischöfe, Herrscher und Fürsten zu senden. In der Folgezeit
erhielten auch Städte, Institutionen und Körperschaften unter dem
Schutz des Papstes, das Schlüsselzeichen. Die hier gezeigten Schlüssel
müssen in diesem Zusammenhang gesehen werden.

Der Camerlengo (Kardinalkämmerer) ist ein hohes Amt in der Hierarchie
der römisch-katholischen Kirchen. Dem Camerlengo unterliegt die Führung
der Apostolischen Kammer, der päpstlichen Finanzbehörde. Er stammt aus
den Reihen des Kardinalskollegiums und wird seit dem 15. Jahrhundert
vom Papst ernannt. Als Vorstand der Apostolischen Kammer verwaltet der
Camerlengo die Güter und Rechte des Heiligen Stuhl in der Zeit der
Sedisvakanz (das ist die Zeit vom Tod des Papstes bis zur Neuwahl eines
neuen Papstes). Der Camerlengo stellt den Tod des Papstes fest und
übernimmt während der Sedisvakanz als Vorsitzender der
Sonderkongregation die Verwaltung der Kirchen. Er nimmt dem
Verstorbenen den Fischerring ab, das Symbol der päpstlichen Macht.
Anschließend versiegelt er die Privatgemächer des verstorbenen Papstes.
Bis zur Wahl eines Nachfolgers für den Papst, wird das Wappen des
Heiligen Stuhls durch das Wappen der Apostolischen Kammer ersetzt, das
sich aus dem persönlichen Wappen des Camerlengo zusammensetzt, der von
einem Baldachin (ombrellone) und den gekreuzten Petrusschlüsseln
überragt wird.

Würzburgischer Kammerherrenschlüssel - Ferdinand, Erzherzog von Österreich (1.2.-15.9.1806)
Würzburgischer Kammerherrenschlüssel - Ferdinand, Erzherzog von Österreich (1.2.-15.9.1806)
Königlich Bayrischer Schlüssel - Maximilian III. (1745-1777)
Regensburger Schlüssel - Fürstbischof Johann Theodor (1719-1763)
Bamberger Schlüssel - Friedrich Carl Graf von Schönborn (1729-1746)
Königlich Bayrischer Schlüssel - Maximilian III. (1745-1777)
Würzburger Kämmererschüssel - Adam Friedrich Graf von Seinsheim
(1755-1779), Fürstbischof von Würzburg und Bamberg - Entwurf von
Hofschlossermeister Johann Georg Oegg

Vorhangschlösser mit Vexier, Biedermeier Österreich

Vorhangschlösser, Mit Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 18.-20. Jahrhundert
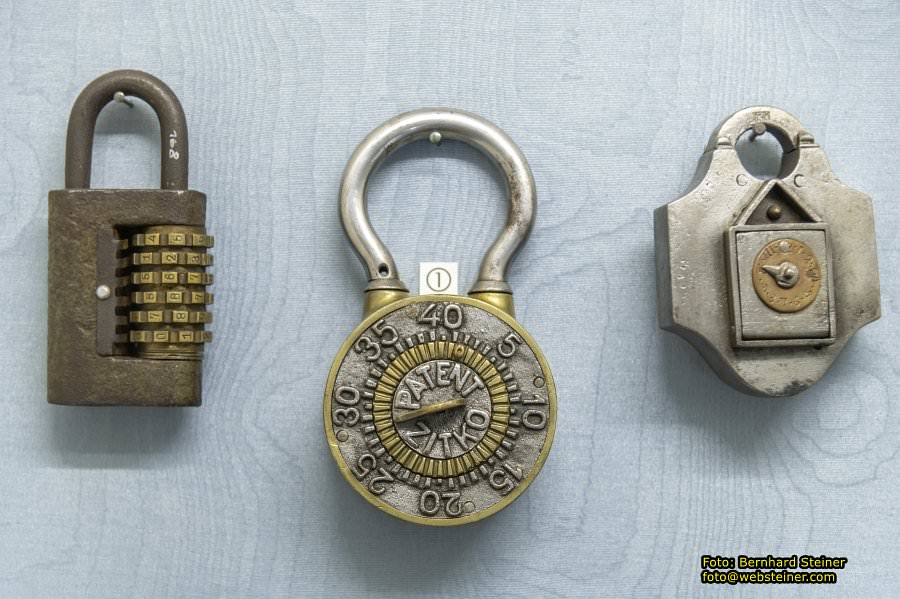
Kuriositäten: Schlüsselpistolen, Schlüsselpfeifen, Kellermeisterschlüssel, Siegel und mehr 18./19. Jahrhundert
Pistolenschlüssel, vermutlich Gesellen- oder Meisterstücke. 17.-19. Jh.
Stilett-Schlüssel mit verborgenem Dolch, 18. Jh.
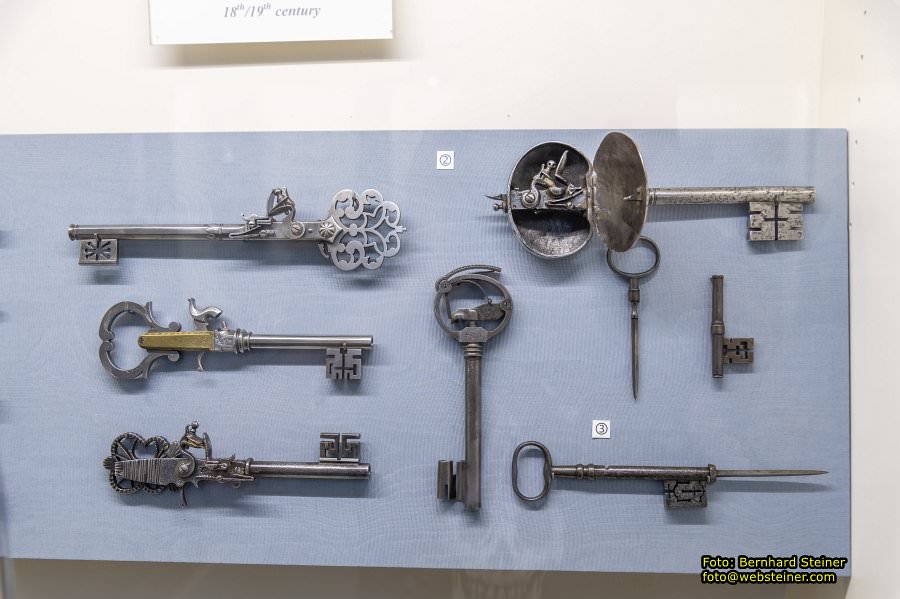
Schlösser mit ausgefallenen Sicherungen
Türschloss aus Messing mit eingebautem Zählwerk und Vexier. Das linke
Bein des Mannes verbirgt das Schlüsselloch die Schuhspitze zeigt auf
die Nummer an am Rad. Jedes Mal, wenn mit dem Schlüssel gesperrt wird,
bewegt sich das Zahlenrad. 18. Jh.

Die Verbreitung und Anwendung von Keuschheitsgürteln ist unter
Historikern äußerst umstritten. Während einige Quellen die Verwendung
bis ins alte Ägypten zurückzuverfolgen glauben, gibt es inzwischen auch
Behauptungen, dass Keuschheitsgürtel eine Erfindung des viktorianischen
Zeitalters seien und die angeblich aus dem Mittelalter stammenden
Exemplare allesamt Fälschungen sind. Es ist also keineswegs
wissenschaftlich gesichert, dass die Ritter - während sie sich auf
Kreuzzug befanden - die Gattinnen und eventuelle Mätressen in Eisen
legten, um deren Treue und Keuschheit während ihrer Abwesenheit
sicherzustellen. Jedem realistisch denkenden Menschen drängen sich auch
massive Zweifel an diesen Geschichten auf. Sicherlich hätte das blanke
Eisen, eng anliegend auf der bloßen Haut getragen, diese binnen weniger
Tage wundgescheuert und unter Bedachtnahme auf die damaligen
hygienischen Verhältnisse wäre wohl jede Trägerin in kurzer Zeit einem
Wundstarrkrampf erlegen. Unumstritten ist dagegen die Tatsache, dass es
seit mehreren Jahrhunderten Vorrichtungen gibt (eines der letzten
Patente dafür stammt aus dem Jahr 1903), die die Geschlechtsorgane der
Frauen abdecken sollen, ohne die Verrichtung der Notdurft unmöglich zu
machen.
Modelle mit etwas mehr Tragekomfort waren mit Leder oder sogar mit Samt
gepolstert, wobei das Grundproblem der Hygiene dadurch sicherlich
verschärft wurde. Naheliegend ist jedoch die Vermutung, dass sich
manche Frauen der vergangenen Jahrhunderte diesen Keuschheitsgürtel bei
Bedarf selbst anlegten, um bei Raubzügen oder Überfällen durch
irgendwelche Feinde oder bei weiten Reisen gegen drohende
Vergewaltigung geschützt zu sein. Auch die Vermutung, dass die
Schlossermeister früherer Jahrhunderte an der Anfertigung von
Nachschlüsseln ein kleines Vermögen verdient hätten, dürfte eines der
vielen Märchen über dieses Martergerät sein. Nichtsdestoweniger hat
kaum ein Gebrauchsgegenstand über lange Zeit die Phantasie der Menschen
derart angeregt, dass niemand müde wird, sich Gedanken über eventuelle
Anwendungsmöglichkeiten zu machen

Eger Kabinett, Reiche Intarsien mit den 10 Geboten und der Erschaffung der Welt. 17. Jh.
Dieses Kabinett aus der Stadt Eger (heute Cheb, Tschechien) wurde mit
großer Wahrscheinlichkeit in der Werkstatt von Adam Eck zwischen 1633
und 1664 angefertigt. Der protestantische Intarsienschnitzer war mit
seiner Familie im Zuge der Gegenreformation aus der Stadt vertrieben
worden und kehrte 1633 wieder zurück um seine Werkstatt aufzubauen.
Adam Eck gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Egerer
Reliefintarsienkunst.
Ecks Arbeiten zeichnen sich durch eine Vielzahl an Allegorien aus. Er
ist auch der einzige Kunstschnitzer der Süßwasserperlen für seine
Intarsien verwendet. Kabinettmöbel zeichnen sich dadurch aus, dass ihre
Einzelbildchen stets zusammen gehören und ein großes Ganzes ergeben.
Das gezeigte Kabinett ist stark christlich geprägt - ersichtlich anhand
der Zehn Gebote - mit einer protestantischen Botschaft. Diese ist zu
sehen an der Schublade, die einen Kirchenraum zeigt, in dem gepredigt
wird. Im Zentrum steht das Taufbecken.

GOTIK 1250-1500
Zeitraum vom Aussterben der Babenberger (1246) bis zum Tode des Habsburgerkaisers Maximilian (1519).
Wesen der gotischen Kunst ist aus der geistigen und religiösen Haltung der Menschen zu verstehen.
Verfall des Rittertums, Hauptträger der Kultur: Kirche, Adel und Bürgertum.
Kennzeichen: Gotische Gewölbeformen (Kreuz - Netz - u. Sternrippen,
Fächergewölbe), Spitzbogenfenster, Maßwerk (ornamentale Schmuckform),
hochaufragende Bauten im sakralen Bereich zeugen von inniger
Religiosität.
Baukunst: Dom zu St. Stephan in Wien, Notre Dame (Paris), Kölner u. -
Regensburger Dom, Dogenpalast (Venedig), Kathedrale in Canterbury
(England), Grazer Bürgerhäuser
Malerei: Hieronymus Bosch (1450-1516), Sandro Botticelli (1444-1510),
Giotto di Bondone (um 1266-1337), Rogier van der Weyden (1399-1464)
Bildhauer: Michael Pacher (1440-1498) Österreich
Kunsthandwerk: Möbel, Truhen, Kassetten, Flügelaltäre, (Tafelbilder), Gemälde

RÖMER 150 v. Chr. - 500 n. Chr.
Um Christi Geburt besetzten die Römer einen Großteil unserer heutigen
Heimat die von Kelten besiedelt war - sie nannten diese neue Provinz
"NORICUM". Römer errichteten entlang der Donau KASTELLE
(Befestigungsanlagen) zum Schutze gegen die Germanen - sie errichteten
darüber hinaus Straßen, Städte und Siedlungen, Tempel, Theater, und
Sportanlagen. Durch die unaufhaltsam fortschreitende Auflösung des
römischen Imperiums sank die Kultur in Noricum noch im 4. Jahrhundert
rasch ab, die Grenzgebiete verarmten, die Orte wurden verlassen oder
verfielen. Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts waren die Gebiete an der
Donau dem Einfall fremder Völker ausgesetzt. Diese machten die hohe
Kultur schnell zunichte.
Kennzeichen: Kunst der Römer stark von den Griechen und Etruskern
beeinflußt, römische Wölbungsarchitektur für Tempelbauten von den
Griechen übernommen, illusionistische Auflösung der Wände durch
Scheinarchitektur
Berühmte Bauten: Colosseum - Amphitheater (70 80 n. Chr. - Rom),
Triumphbogen des Konstantin (116 n. Chr. von Trajan errichtet - 320 n.
Chr. von Konstantin umgestaltet)
Fundorte: Carnuntum Vindobona (Wien), Lauriacum (Lorch bei Enns / OÖ),
Virunum (Zollfeld), Magdalensberg (Kärnten), Flavia Solva (Steiermark)

Steirische Holzschlösser, 19./20. Jh.

Prunkkassette, Stahlschnitt, datiert 1733
Provenienz: Marie-Helénè de Rothschild vormals Alphonse Rothschild Collection
Mit Beschauzeichen der Stadt Strassburg, Elsass

Kästchen von Michel Man(n), Conradt Man(n); Kästchen nach Art Michel Man(n) und Conradt Man(n)
Kleine feuervergoldete Messingkästchen, meist graviert oder geätzt, die
in ihrem Aufbau und ihrer Form die großen eisernen Truhen nachahmen.
Diese stammen aus der Werkstatt der beiden Brüder Michel und Conradt
Man(n). Sie signierten ihre kleinen Kästchen öfter an der Deckelleiste,
wobei der Name manchmal mit einem, ein anderes Mal mit zwei „M"
geschrieben wurde. Häufig finden sich die Initialen MM oder CM am
Boden, oder am Rand des Deckels auf der Innenseite. Allen kleinen
Kästchen ist das Deckelschloss, welches vier bis sechs Fallen aufweisen
kann, gemeinsam. Zudem weisen sie noch eine verschiebbare Deckelleiste,
die das Schlüsselloch verbirgt, weiters Kupferbeschläge an den Ecken
und den Seiten sowie meist gequetschte Kugelfüßchen auf.
Als Themen für die Ätzung, oder die Gravur wurden häufig Vorlagen von
Jost Amman, oder Virgil Solis, die frei variiert wurden, gewählt. Diese
zeigen die Freien Künste, Tugenden oder Laster, häufig paarweise
angeordnete Liebespaare oder religiöse Motive. Bei sehr feinen Kästchen
aus der Werkstätte Man(n) ist auch die Unterseite, sowohl innen als
auch außen geätzt. Die Gravuren und Ätzungen selbst wurden aber nicht
in der hauseigenen Werkstätte gefertigt sondern von Graveuren oder
Ätzmalern gestaltet.
Gesicherte Nachweise aus dem Leben der beiden Meister sind spärlich.
Der Vater, ein Messerschmied mit dem Namen Sebastian Mann, stammte aus
Schwabach in der Nähe von Nürnberg. Er verstarb 1582 und hinterließ
seiner Frau und seine zwei Söhne Michel und Conradt. Sein Sohn Michel
ehelichte als Büchsenmeister und Kunstschlosser im Jahr 1589 die
Tochter eines Schmiedes und erhielt dadurch sowohl das Bürgerrecht der
Stadt Augsburg als auch die Schmiedegerechtigkeit. Michel Mann starb um
1630 in Wöhrd bei Nürnberg, seine Gattin Ursula scheint in Augsburg
geblieben zu sein. Über seinen Bruder Conradt ist nichts bekannt.
Unter den vielen gleichartigen Kästchen, die in Museen und Sammlungen
als Michel Man(n) Kästchen ausgewiesen werden, dürften sich auch
Nachahmungen des Barocks von Mitbewerbern, aber auch des Historismus
darunter befinden. Im 19. Jahrhundert wurden diese überaus beliebten
Kästchen reproduziert, diese sind aber durch die Unterschiede in ihrer
Größe und der Gravuren erkennbar.

Schlosserei: Alle Gegenstände stammen aus einer ehemaligen Grazer Schlosserei

Ritualdolch (kila) mit Klinge aus Bergkristall.
Ein 'kila' oder tib. 'phurbu' ist ein Ritualobjekt, mit dem symbolisch
Dämonen vernichtet werden. Am Griff ist der dreigesichtige Gott
Vajrakila (tib. Dorje Phurbaj zu sehen. Darjeeling, Indien, 20. Jh.
Ritualmesser (karttrka) mit einem Makara.
Ein Makara ist ein Fabelwesen aus dem Hinduismus und besteht aus
verschiedenen Tieren, z.B. Elefant oder Delfin. Es steht in Verbindung
mit dem Wasser und gilt als Reittier des Meeresgottes Varuna.
Darjeeling, Indien, 20. Jh.

Krone eines Orakelmediums, Silber vergoldet.
Ein Orakelmedium (Kuten) trägt eine Krone oder ein Band während der
Trance. Dies ist ein notwendig für das Gelingen des Rituals. Das
Staatsorakel von Tibet lebte seit dem 17. Jh. bis 1959 im Kloster
Nechung. Tibet, 19. Jh.

Holzkassette mit Perlmutt-Intarsien. Holz und Perlmutt, Belgien, 17./18. Jh.

Vergoldetes Salonschloss mit einer Darstellung aus der griechischen
Mythologie. Gezeigt wird Orpheus mit seiner Lyra in der Hand, stehend
am Fluss Styx, neben ihm der Fährmann Charon. Messing und Gold,
Frankreich, 19. Jh.

Holzkassette mit Strohintarsien.
Wurde für die Jüdin Ida Loewe gefertigt und zeigt diverse Gebäude samt Beschriftungen. Wien, 1886
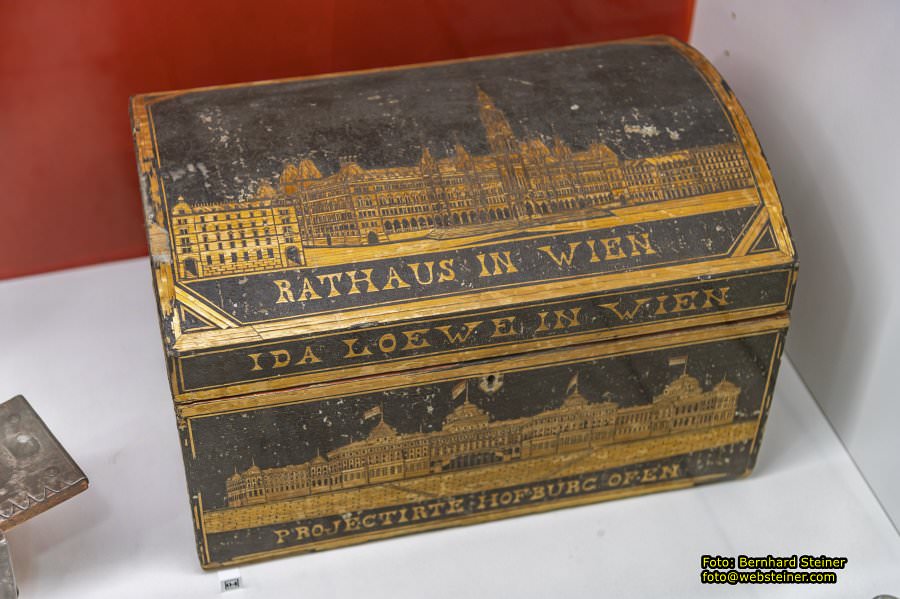
Gegossenes und koloriertes Wandrelief von Schloss Heidelberg der Gießerei Mägdesprung.
Gebaut im 12. Jahrhundert, war die Schlossruine zur Zeit der Romantik
ein beliebtes Motiv. Gusseisen, koloriert, Deutschland, 19. Jh.

Zwei Statuetten einer reitenden Dame mit Falken am Arm. Eine aus
Zinkguss, farbig gefasst und die andere aus Eisenkunstguss. Da es zu
dieser Zeit keinen Muster- od. Patentschutz gab, wurden dieselben
Modelle oft von vielen Gießereien in unterschiedlichen Materialien und
Fassungen nachgegossen. Europa, 19. Jh.

Tür, Messing gegossen
Der Priester Melchisedech spendet Brot und Wein. Er segnet Abraham,
darauf hin spendet Abraham an Melchisedech den Zehnten (freiwillige
Abgabe an den Tempel). Historismus
Tabernakeltür, Holz vergoldet
Geschnitzte und vergoldete Tür die mittig den Kelch mit der Hostie
zeigt. Darunter zwei kniende Engel. Deutschland oder Östereich. Barock

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: