web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Rosenau
Österreichisches Freimaurermuseum, September 2023
Das Österreichische Freimaurermuseum Schloss Rosenau
bietet in neu renovierten barocken Räumen Einblicke in Geschichte und
Gegenwart des diskreten Bundes. Neben Kunstwerken und
Ritualgegenständen zeigt es viele bekannte Gesichter der Freimaurerei.
Die Atmosphäre einer Original-Loge aus dem 18. Jahrhundert wird hier erlebbar.

1593 erweiterten die Herren von Greiß einen bereits vorhandenen
Vierkanthof zu einem Renaissanceschloss. Von 1720 bis 1803 war Rosenau
im Besitz der Grafen Schallenberg. Erster Inhaber war Leopold Christoph
Graf von Schallenberg, der das Gut 1720 kaufte. Er ließ das Schloss
nach den Plänen des Baumeisters Joseph Munggenast im Barockstil umbauen
und richtete dort Räume für eine Freimaurerloge ein. Außerdem entstand
in dieser Zeit die fast vollständig erhaltene Gutshofsiedlung. Von
dieser Gutsherrschaft zeugen das Altersheim (Spital), das Forsthaus,
der ehemalige Meierhof, die Bandweberei, die Wagenremise, der Pfarrhof,
die Volksschule und die Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit. Josef Graf
Schallenberg verkaufte das Schloss 1803.

Es erwarb Ernst Christoph Georg August Graf Hardenberg, königlich
hannoverscher Gesandter in Wien, dessen Neffe es 1832 an den Ökonomen
Freiherr Andreas von Stift verkaufte. 1863 wurde Creszentia Stummer,
Witwe des Händlers Carl Stummer aus Brünn Schlossherrin, nachdem die
Stiftschen Erben das Gut veräußert hatten. Bereits fünf Jahre später
erwarb der Eisenbahntechniker Mathias von Schönerer Schloss und Gutshof.

Georg Heinrich Ritter von Schönerer erbte den Besitz 1883 und
verwaltete das Gut bis zu seinem Tode 1921. 1907 ließ er nördlich des
Schlosses den einzigen Bismarckturm Österreichs errichten. Für das Wohl
der ansässigen Bevölkerung schuf er auf dem Gut und in der Umgebung
zahlreiche soziale und wirtschaftliche Einrichtungen. Seine Tochter
verwaltete das Erbe bis 1928. 1943 übernahm die Deutsche
Ansiedlungsgesellschaft das Schloss. Von 1943 bis 1945 war Baron
Lazarini-Zobelsperg Schlossherr. Nach Kriegsende verwüsteten
sowjetische Truppen das Schloss, darauf folgte die Beschlagnahme durch
die Besatzungsmacht bzw. die USIA, nach Ende der Besatzungszeit 1955
die Rückgabe an Baron Lazarini-Zobelsperg. Er verkaufte das durch die
Zerstörungen unwirtschaftlich gewordene Schloss 1964 an die
Siedlungsgesellschaft des Landes Niederösterreich.

Nach beträchtlichen Investitionen seitens des Landes wurden am 26.
September 1974 Schlosshotel und Restaurant eröffnet. Ein Jahr später
erfolgte die Eröffnung des Österreichischen Freimaurermuseums im
Schloss. In der Pfarrkirche zeigt ein Deckenfresko, das dem Maler Paul
Troger zugeschrieben wird, die Anbetung der Heiligen Dreifaltigkeit.
Die Kirchenemporen für die Familie und das Personal der Schlossbesitzer
sind so konstruiert, dass man sie ohne Umweg von den Gemächern im 1.
Stock des Schlosses aus betreten kann.

Das im 18. Jahrhundert umgebaute Schloss ragt bis heute hervor durch
die Arbeiten des Baumeisters Joseph Munggenast, der Maler Paul Troger,
Daniel Gran und des „welschen Perspektivenmalers“ Rincolin, der in
Rosenau begraben liegt. Die dem Tode Schallenbergs im Jahr 1800
nachfolgenden Eigentümer – darunter der für seine antisemitischen
Umtriebe berüchtigte Georg Ritter von Schönerer – wussten nichts mehr
von der besonderen Bedeutung des Schlosses als freimaurerische
Wirkungsstätte. Die symbolischen Malereien wurden zugedeckt und
übermalt.

Freimaurerei in der Zeit der Habsburger-Monarchie
1717 24. Juni: Gründung der ersten Großlage der Welt in London (UGLE)
1738 Bannbulle „In Eminenti" gegen die Freimaurerei von Papst Clemens XII.
1742 Gründung der ersten Wiener Loge „Aux Trois Canons" (Zu den Drei Regeln)
1751 Bulle „Providas" von Papst Benedikt XV gegen die Freimaurer
1770 Gründung der Loge „Zur Hoffnung", später „Zur Gekrönten Hoffnung" in Wien
1776 Abschaffung der Folter in Österreich über Antrag des Freimaurers Joseph von Sonnenfels
1780 Tod Maria Theresias, Nachfolger wird ihr Sohn Joseph II.
1781 Joseph II. erlässt das.
Toleranzpatent: Freie Religionsausübung sowie gleiche politische Rechte
für alle protestantischen Bekenntnisse und die griechisch-orthodoxe
Kirche
1781 Gründung der Loge „Zur Wahren Eintracht" in Wien
1784 Gründung der Großen Landesloge von Österreich; Aufnahme Wolfgang Amadeus Mozarts in die Loge „Zur Wohltätigkeit"
1785 "Freimaurerpatent": Die
Freimaurerei wird einerseits staatlich anerkannt, andererseits
überwacht und die Anzahl der Logen beschränkt
1790 Kaiser Joseph II. stirbt,
in der Folge ab 1793/95 Verbot und systematische Verfolgung der
Freimaurerei bis in die Ära Kaiser Franz Josephs
1867 Der „Ausgleich" mit Ungam
führt zur Schaffung der Doppelmonarchie, Kaiser Franz Joseph bestätigt
das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger -
als Folge ist in Ungam die Freimaurerei ab nun erlaubt - in Österreich
bleibt sie verboten
1869 Österreichische Freimaurer
besuchen die Loge „Zur Verbrüderung" in Ödenburg (Sopron) und erhalten
den entscheidenden Impuls für die Gründung von „Grenzlogen"
1871 Wiener Freimaurer gründen
auf ungarischem Boden in Neudörfl die erste Loge mit dern Namen
„Humanitas". In der Folge etablieren österreichische Freimaurer 16
Logen auf ungarischem Gebiet
1908 Ferdinand Hanusch wird von
der Loge „Lessing" aufgenommen, Alfred H. Fried von der Loge „Sokrates"
- ihm folgt 1909 Richard Schlesinger, der 1919 zum Ersten Großmeister
der Großioge von Wien gewählt wird

Tartsche, 1653 - Schild der Steinmetze
Grabstein des Wolfgang Tenk, um 1513 - Wolfgang Tenk, Baumeister der Pfarrkirche Steyr
Tartsche, Mitte 17. Jahrhundert - Schild der Steinmetze

Grabschild der Steinmetz-Zunft, 1665 - Metallschild aus Silber vergoldet
Neben den Tätigkeiten einer Standesvertretung und sozialen
Unterstützungen war es eine der wichtigsten Aufgaben einer Zunft, auch
ein würdiges Begräbnis für ein verstorbenes Mitglied zu arrangieren.
Daher gehörte auch eine Sammlung von dekorativen Grabschilden zur
notwendigen Ausstattung der Zünfte. Diese Embleme wurden paarweise auf
eine Textildecke gehängt, die den Katafalk mit dem Sarg des
Verstorbenen bedeckte.
Grabschilde wurden in unterschiedlichen Formen und Materialien
hergestellt. Bekannt sind Textilschilde („Tartschen"), die mit
Reliefapplikationen und plastischen Stickereien verziert sind. Es gab
aber auch zahlreiche in Metall gearbeitete, aufwendig gepresste und
gehämmerte Schilde. Neben den typischen Zeichen und Gegenständen des
jeweiligen Handwerks, finden sich Darstellungen von Symbolen des
Lebens, des Todes, gemeinsam mit Motiven der Vergänglichkeit (Vanitas).
Das hier präsentierte Grabschild stammt von einer Steinmetz-Zunft aus
dem Raum Prag (Beschauzeichen auf der Rückseite samt Meistermarke). Es
ist sehr hochwertig in Silber gearbeitet, teilweise vergoldet und mit
der Jahreszahl 1665 versehen. Da die erste Loge in Prag erst 1741 („Zu
den drei Sternen") gegründet wurde, hat dieses Schild keinen dezidiert
freimaurerischen Ursprung, weist aber auf die symbolischen Bezüge der
Freimaurer zu den alten Dombauhütten und Steinmetz-Zünften hin. Dieses
Exponat wurde dem Museum in dankenswerter Weise von Brüdern der Loge
Mozart in Wien gestiftet.

Warum Freimaurerei?
„Das Freimaurertum basiert auf der Anerkennung und Befolgung des
allgemeinen, alle Menschen gleichermaßen verpflichtenden
Sittengesetzes, kennt jedoch keine Dogmen, lehnt Rassen- und
Klassenhass auf das entschiedenste ab und baut so wie es in der Sprache
der Freimaurerei heißt - „am Tempel der allgemeinen Menschenliebe". Die
Durchsetzung der Menschenrechte, die nun seit 1776 mehrfach neu
kodifiziert wurden, ist heute das Ziel sehr vieler Parteien und
Staaten. Die Menschenrechte global durchzusetzen, gelingt bis jetzt
nicht. Es fehlt an Altruismus, es fehlt an Toleranz, es fehlt an
Humanität. Das Ziel der totalen Durchsetzung der Menschenrechte mag
manchem als unerreichbar und utopisch erscheinen, aber, einmal gefasst
und erkannt, ist es eine höchst wirksame soziale Kraft, die sich
freilich nur asymptotisch ihrem Ziel nähert."
(Alexander Giese, Großmeister der Großloge von Österreich 1975-1987)
Der Tapis (Die Arbeitstafel)
Der Tapis/Arbeitsteppich ist ein zentrales Instrument der Freimaurerei,
denn er zeigt einen Großteil der maurerischen Symbolik. Ursprünglich
mit Kreide auf den Boden gezeichnet, liegt der Tapis in der Mitte der
Loge und dient der Ordnung, Kontemplation und Inspiration. In
Abwandlungen finden sich seit Jahrhunderten die wesentlichen Elemente
immer wieder. Der Tapis soll ein Abbild der Loge sein, eine Art
heiliger Urgrund. Er beschreibt den symbolischen Logenraum als von
Osten bis Westen, von Norden bis Süden, vom Mittelpunkt der Erde bis an
den Himmel reichend.
Im unteren Abschnitt erhebt sich gleichsam aus einem musivischen
(mosaikartiken) Pflaster (unserem rational strukturierten Leben) der
Tempel der Humanität, in der Architektur des Salomonischen Tempels. Ihm
vorgesetzt sind die beiden Säulen J (Jakin/Jachin) und B (Boas), als
Grundpfeiler dieser Humanität. In der Mitte des Arbeitsteppichs haben
die aus derm Handwerk der Steinmetze und Baumeister übernommenen
Symbole ihren Platz: Senkblei, Winkelwaage, Winkel und Zirkel. Weiters
der zu behauende raue Stein und der geglättete, Hammer, Kelle usw. Am
oberen Rand des Tapis sehen wir Sonne, Mond (und Sterne); denn im
Angesicht des Himmels soll sich der Freimaurer zunehmend als Flammender
Stern verstehen, inmitten eines Pentagramms stehend, und sich dabei der
Werte Freiheit, Toleranz, Brüderlichkeit und Transzendenz besinnen.
Umfangen werden die Symboldarstellungen von einer Kordel mit drei
Lemniskaten (Liebes-/Freundschaftsknoten), als Zeichen für die
Verbundenheit des Maurers mit seinen Brüdern.
Seit dem 19. Jahrhundert werden die Arbeitsteppiche besonders kunstvoll
ausgestaltet. Als Beispiel mag der von Herbert Schmid-Korlath
gefertigte, hier im Tempel aufliegende Tapis (Kopie des sog. „Wiener
Tapis" aus den 1860er Jahren) dienen. Besondere Prunkstücke der
künstlerischen Gestaltungskraft stellen die beiden Arbeiten der
renommierten österreichischen Künstler Adolf Frohner und Michael
Prachensky dar, die hier erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sind.

Österreichische Freimaurerei im 20. Jahrhundert
1918 12. November: Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich
8. Dezember: Gründung der „Großloge von Wien" durch die bisherigen
Grenzlogen „Humanitas", „Sokrates", „Eintracht", „Treue", „Lessing zu
den 3 Ringen", „Kosmos", „Gleichheit", „Zukunft", „Schiller",
Freundschaft", „Goethe", „Pionier", „Zur Wahrheit" und „Fortschritt".
Die Logen arbeiten im Logenhaus in Wien in der Dorotheergasse 12
1920 Julius Tandler wird von
der Loge „Lessing zu den drei Ringen" aufgenommen. Als Wiener Stadtrat
für Wohlfahrtspflege schafft er ein international vielbeachtetes
Wohlfahrtssystem
1921 Tod von Alfred Hermann
Fried, der für sein Konzept des Pazifismus 1911 mit den
Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Er beeinflusst das Denken der
Großloge nachhaltig
1922 Richard Coudenhove-Kalergi
wird in die Loge „Humanitas" aufgenommen. Seine Paneuropa-Ideen gelten
els Ursprung der Idee einer Europäischen Union und werden von der
Großloge unterstützt
1926 Gründung der „Österreichischen Liga für Menschenrechte" unter Beteiligung zahlreicher Freimaurer
1933 Ausschaltung des
Parlaments durch Bundeskanzier Engelbert Dollfuß und Errichtung des
autoritären Ständestaates. Dolltuß wird im Zuge eines
nationalsozialistischen Putschvorsuches im Juli 1934 ermordet
1934 Bürgerkrieg im Februar
1934; Ausschaltung der Sozialdemokratie; die Freimaurerei wird unter
Kuratel gestellt. Staatsbeamte müssen sich zwischen ihrem Arbeitsplatz
und der Mitgliedschaft entscheiden. Polizeibeamte können zu den
Versammlungen und Arbeiten kommen. Die Logenarbeit wira schwieng bis
unmöglich. Dadurch geht die Zahl der Brüder in den Folgejahren um die
Hälfte zurück
1938 12. März: Einmarsch
deutscher Truppen in Österreich. Das Logenhaus in der Inneren Stadt
wird bereits am 13. März von Nazionalsozialistern gestürmt und
geplündert. In den nachfolgenden Tagen Verhaftung zahlreicher
Freimaurer, darunter auch von Großmeister Dr. Richard Schlesinger durch
die Gestapo. Er stirbt infolge verweigerter ärztlicher Versorgung im
Gefängnis am 5. Juni 1938
1945 Bereits kurz nach der
Befreiung Wiens wird im August 1945 von 48 überlebenden Freirnaurern
der Neubeginn bzw. die Wiedergründung der Österreichischen Großloge
beschlossen. Zum ersten Großmelster wird der Arzt Dr. Karl Doppler
gewählt, nach dessen Tod wird zwei Jahre später Bennard Scheichelbauer
sein Nachfolger
1955 Die „Großloge von Wien - für Österreich" wird nach dem Staatsvertrag zu der bis heute bestehenden „Großloge von Österreich"
2022 In der „Großloge von Österreich" arbeiten 82 Logen mit rund 4.000 Mitgliedem

Das Deckengemälde - Daniel Gran, 1694 - 1757
Antiker Götterhimmel, links Diana und Aktäon, dahinter Perseus mit dem
Medusenhaupt, rechts Vulkan und Venus, sowie - über Pallas Athene -
Apoll, der Sonne zugewandt. Apoll, Gott der Wissenschaften und Künste,
als Weltenbaumeister mit Bibel, Zirkel und Winkelmaß und darüber die
Sonne. Die letztgenannten vier freimaurerischen Symbole finden wir
später in allen Freimaurertempel wieder. In den Rundfeldern der Ecken
ist die Musik, Geographie, Geschichte und Grammatik durch kleine Putten
mit den jeweiligen Attributen symbolisiert. Kunst und Wissenschaft
gehören zu den erstrebenswerten Aufgaben des Freimaurers. Sucht man
nach einem sinnvollen Zusammenhang der Deckengemälde des ersten und
zweiten Raumes, so findet man ihn in der Steigerung von natürlichem
Licht zu geistigem Licht.

Der Schurz des Freimaurers
Der Schurz ist der Hauptteil der symbolhaften Bekleidung aller
Freimaurer weltweit. Seinen Ursprung hat er im schützenden
Steinmetz-Bekleidungsstück der Dombauhütten. Freimaurer sehen hierin
eine Reminiszenz (v. lat.: reminisci = sich erinnern) an ihre Ursprünge
und betrachten den Schurz als Teil der sinnstiftenden Metaphern aus der
Dombau-Zeit.
Der Schurz wird in der spekulativen Maurerei als Zeichen dafür
getragen, dass der Maurer Zeit seines Lebens an sich (wie der Steinmetz
an einem rauen Stein) zu arbeiten hat und keine Scheu vor
absplitternden Steinstücken haben soll. Da der Schurz einen Freimaurer
bekleidungsmäßig als solchen ausweist, findet er ohne ihn keinen
Einlass in einer Loge. Ursprünglich rein weiß in Leder gearbeitet, hat
sich über die Zeit eine aufwändigere Gestaltung durchgesetzt, nur der
Schurz des Lehrlingsgrades ist nach wie vor einfach weiß. Gesellen
tragen einen blau einfassten Schurz, die Meister einen solchen, der
zusätzlich mit drei blauen Rosen geschmückt ist. In der
Hochgradmaurerei spielt der Schurz eine wichtige Rolle als Abzeichen
des jeweiligen Grades (bis zu 33 Grade). Hier findet sich eine
dekorativere Ausgestaltung, etwa in Samt und Seide, in roter, grüner,
blauer, gelber oder anderer Farbe, eingefasst und bestickt, mit Silber
und Gold verziert und mit diversen symbolischen Emblemen ergänzt.
Schurz des Helvetius. Geschenk an Voltaire anlässlich seiner Rezeption in die Loge Neuf Soeurs, 1778 Paris
Schurz des Generals Marquis Marie Joseph La Fayette 1757-1834.
Er wurde in Gegenwart von George Washington 1779 in eine Militärloge aufgenommen.
Kopie: Originalschurz im Washington Memorial
Arbeitsschurz aus Frankreich um 1740
Schurz der Pariser Adoptionsloge „Zur heiligen Josephine", Anfang des 19. Jahrhunderts, gegründet von Joséphine de Beauharnais, der Gattin Napoleons

Tempel Salomonis
Eine der idealisierten Darstellungen alttestamentarischer Bauwerke aus
der von Johann Bernhard Fischer von Erlach herausgegebenen Sammlung
„Entwurff Einer Historischen Architectur" / Band 1, 1721

Das Deckenfresko - Daniel Gran, 1746
Eine allegorische Darstellung, wieder mit Pallas Athene. Die drei
Johannisrosen werden dem aus der Loge Austretenden entgegengehalten.
Links unten hält ein Putto den Granatapfel mit seinen zahlreichen Samen
als Symbol für die Verbreitung des Gedankens der Freimaurerei. Rechts
oben ein Bienenkorb-Zeichen für gemeinsame, sinnvolle Arbeit. Dem
Eintretenden jedoch streckt ein Putto die Spitze des Zirkels entgegen,
Symbol der allumfassenden Freundschaft.

Die „Dunkle Kammer",
französisch „Chambre de Reflexion" genannt, diente der Vorbereitung des
Kandidaten für die Aufnahme in den Bund der Freimaurer. Umgeben von
Symbolen der Vergänglichkeit hatte der Kandidat sein Leben zu
überdenken und seinen Entschluss, Aufnahme in die Bruderschaft zu
suchen, noch einmal genau zu überprüfen. Die Gegenstände in diesem Raum
sind alle aus dem 18. Jahrhundert.

Den aufklärerisch-liberalen Tendenzen am Ende des 18. Jahrhunderts
folgten Kriege, wirtschaftliche Depression sowie eine geistige
Enttäuschung. Zu kompromisslos war die Aufklärung zur Tat geschritten,
zu sehr hatte sie die rationalen Mächte der Tradition sowie die
Nachteile einer einseitigen Intellektualisierung unterschätzt. Dennoch
wies sie den Weg in die moderne Welt und blieb als Denkhaltung bis
heute von Wichtigkeit. Ob das Projekt Aufklärung jemals abgeschlossen
werden kann, ist mehr als fraglich. Sie ist und bleibt ein
unvollendetes und vielleicht auch nicht vollendbares Projekt.
„In dieser Parodoxie liegt
wahrscheinlich ihre anhaltende Aktualität und die Chance, aus ihr eine
neue Aufklärung als Denkmodell gegen den Fundamentalismus zu
entwickeln." (Michael Kraus, Altgroßmeister der Großloge von Österreich)

Albert Kasimir, Herzog von Sachsen-Teschen (1738-1822)
Abguss von Prof. Walter Leitner, nach einer Büste von Franz Xaver Messerschmidt

Porzellanfigurengruppe, zwei Freimaurer
Meissen um 1745, von Johann Joachim Kaendler

„Tempel der Vollkommenheit“
errichtet 1791, gestiftet von Franz Edler von Mack zum Gedächtnis - wie
die Gedenksteine angeben - an Albert, Herzog von Sachsen-Teschen und
dessen Gemahlin Maria Christina, Erzherzogin von Österreich (Tochter
Maria Theresias)
Der „Tempel der Vollkommenheit" in Kalksburg, auch „Monument" genannt,
war ursprünglich als zentrales Bauwerk in einen Englischen
Landschaftsgarten eingebunden. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Wien
und Umgebung in vielen Gartenanlagen ähnliche tempelartige Bauwerke,
die ähnlich rätselhaft benannt waren: „Tempel der Nacht" in Schönau bei
Baden (der auch als Vorbild für das Bühnenbild zu Mozarts „Zauberflöte"
diente), „Tempel der Unsterblichkeit" in Bad Vöslau und „Tempel der
Schatteninsel" in Bruck an der Leitha. All diese Bauwerke weisen
erstaunliche Gemeinsamkeiten auf: Der Zeitpunkt ihrer Errichtung liegt
jeweils zwischen 1780 und 1795. Immer waren sie zentrale Bauwerke in
diesen für die damalige Zeit neuartigen Gartenlandschaften. Nicht
selten waren dabei ägyptische Obelisken neben chinesischen Pavillons
und künstliche Grotten mit griechischen Hermes- oder ägyptischen
Isis-Statuen vorzufinden.

Porzellanschüssel, Ende des 18. Jahrhunderts, Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Meisterschurz nach schottischem Ritus im 18.Grad, 2. Drittel 18. Jahrhundert
Englischer Meisterschurz, Ende des 18. Jahrhunderts
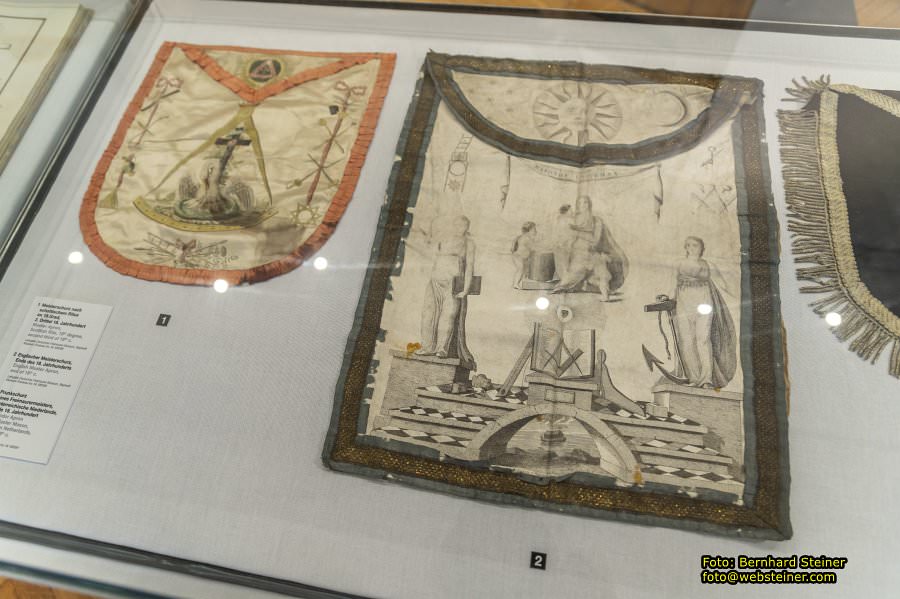
Die Loge „Zur Wahren Eintracht"
Mit Joseph II. begann in mancherlei Hinsicht eine neue Epoche: 1773 war
der Jesuitenorden als dogmatisch-religiöse Ordnungsmacht verboten
worden, die Bindungen des Feudalstaates hatten sich überlebt, und die
im Barock dominierende Gegenreformation vermochte nicht mehr dem von
England ausgehenden Gedankengut der Aufklärung Einhalt zu gebieten. In
dieser Situation wurde 1781 die Loge,„Zur Wahren Eintracht" gegründet,
die sich - vor allem nach dem Eintritt von Born und Sonnenfels -
schnell zur Wiener Elite-Loge entwickelte. Zu den 226 Brüdern dieser
Loge zählten die bekannten Ärzte Johann Peter Frank, Johann Nepomuk
Hunczowsky und der Anatom Joseph Barth. Joseph Haydn wurde in diese
Loge aufgenommen. Die Literaten Aloys Blumauer und Joseph Ratschky,
Johann Baptist Alxinger und Cornelius von Ayrenhoff waren ihre
Mitglieder. Wolfgang Amadé Mozart war häufig Gast bei den Arbeitern
dieser Loge und wurde auch hier zum Gesellen befördert. Zum
unvergänglichen Ruhm dieser Loge hat auch der Umstand beigetragen, daß
sie ihre Baustücke (Vorträge, die bei der Zusammenkunft der Brüder
gehalten werden) im „Journal für Freymaurer" drucken ließ.
Das Ende 1792/1795
Nachdem seit 1787 in Wien nur noch die Loge „Zur Gekrönten Hoffnung"
(wieder unter ihrem alten Namen) bestand. ließ der Regierungsantritt
Leopolds II. maurerische Hoffnungen aufkeimen. Der Herrscher versuchte,
Freimaurer in seine politischen Pläne einzubeziehen und in einer
„Freimaurer-Assoziation" konservative Logen zu vereinigen. Unter der
Staatsführung Franz I. und unter dem Eindruck der Französischen
Revolution kam für alle geschlossenen Gesellschaften im Habsburgerreich
bald das Ende. Mit dem Kriminalpatent von 1795 hatte man die Handhabe
zum gänzlichen Verbot der Freimaurerei.

Der Tod Joseph II., Huldigungsblatt mit Pyramide Darstellung der von Joseph II. erlassenen Dekrete, 1790

Der „Josephinismus", die Reformpolitik Kaiser Josephs II., fand vor allem in der Kirchenpolitik ihren Ausdruck:
Durch das Toleranzpatent von 1781 wurde Protestanten und
Griechisch-Orthodoxen freie Religionsausübung zugestanden. 1782 wurde
die Aufhebung zahlreicher Klöster in Österreich und Ungarn und des
Hofstaates angeordnet. Die Hofburg war nur noch das Büro des Kaisers.
1783 wurde durch das „Ehepatent" die Zivilehe neben der weiterhin
obligaten kirchlichen Trauung eingeführt. 1784 erfolgten beim
Begräbniswesen einschneidende Änderungen. Natürlich haben diese
Änderungen den Widerstand von Papst Pius VI. hervorgerufen, der aus
diesem Grund bereits 1782 nach Wien kam, um den Kaiser von weiteren
Aktionen im Sinne des „aufgeklärten Absolutismus", die zu einer
verstärkten Staatskontrolle führten, abzuhalten. Allerdings war der
Besuch ohne Erfolg. Der Kaiser verordnete auch weit reichende
Änderungen auf anderen Gebieten: In der Verwaltung, im Schulwesen, im
Rechts- und Gesundheitswesen. Obwohl dieses dem Geist der Aufklärung
entsprechende politische Programm hätte erwarten lassen, daß Joseph II.
Freimaurer gewesen ist, war dies im Gegensatz zu seinem Vater Franz
Stephan nicht der Fall. Es gehörten jedoch mehrere seiner engsten
Berater, insbesondere Joseph von Sonnenfels, dem Bunde an.
Joseph von Sonnenfels und die Aufhebung der Tortur
Zu seiner besonderen aufklärerischen Denkart gehörte es, daß er
erstmals den Begriff der „Beförderung der allgemeinen Glückseligkeit"
als Endziel eines guten Staatswesens prägte. Seine mehr als vielseitig
betriebenen Berufe und Beschäftigungen gaben ihm reichlich Gelegenheit,
seinen Standpunkt zu vertreten, daß Vorschriften nicht gegen, sondern
für die Bürger gemacht werden müssen. Er trat ein für die Errichtung
von Jugendämtern und Waisenhäusern, für die Erhaltung von Schulen auf
öffentliche Kosten, für eine selbst dirigistische Hebung der
Allgemeinbildung, für den korrekten Gebrauch der deutschen Sprache auch
um den Preis einer entsprechenden Zensur, für die Schaffung von
Arbeitsgerichten und einer Gesundheitspolizei, für Alters- und
Witwenversorgung über Versorgungskassen, für die Kontrolle eines
festgesetzten Mittelpreises für Lebensmittel zur Verhinderung der
Teuerung und vieles andere mehr. In seinem liberalen Radikalismus
bezeichnete er die Bauern als die nützlichste Klasse unter den Bürgern.
Fanatisch war sein Kampf gegen Folter und Todesstrafe, wobei sein
persönliches Einwirken auf Maria Theresia schließlich 1775 zur
Aufhebung der Tortur führte. Unter Joseph II. wurde die Todesstrafe
außer für Hochverratsdelikte aufgehoben. Joseph von Sonnenfels war
Meister der Loge „Zur Wahren Eintracht" und gründete das berühmte
„Journal für Freimaurer".

Raum der verlorenen Schritte
Der Raum ist reich mit Symbolen gestaltet. Über dem Fenster eine große
schwarze Muschel, Symbol der Verschwiegenheit, am Boden eine
Sonnenrose, Symbol des Weltenbundes, umgebend von einem Mäanderband,
Symbol der Bruderkette. An der Stirnwand ein unvollendeter Obelisk,
zwei Widderköpfe, Symbol der Stärke, flankieren den Sockel. Im unteren
Teil ist ein Weinstock, Symbol der Wiederkehr, sichtbar.
Gerade in unserer Zeit ist es immer schwieriger, der ständigen Hast,
den Spannungen und „Sachzwängen" unseres Alltags zu entkommen. Die
Emotionen des Augenblicks verstellen aber oft den Blick aufs
Wesentliche und machen hastig oder ungerecht im Urteil. Im „Raum der
verlorenen Schritte", der sich vor dem eigentlichen Logenraum befindet,
soll der Freimaurer versuchen, sich von den täglichen Verstrickungen zu
lösen, sich zu besinnen und zu sammeln.

Der Tempel ist der besondere
Logenraum, in dem Symbol und Ritual zu jener nicht bestimmten und nicht
bestimmbaren Einheit werden, die masonisches Sein möglich und
masonisches Ziel denkbar macht. Die Metaphorik des Raumes ordnet das
Ritual der Freimaurer. Im (symbolischen) Westen befinden sich die
Plätze des Ersten und Zweiten Aufsehers sowie die beiden Säulen aus dem
Vorhof des Salomonischen Tempels. Die Sitzreihen im Norden und Süden
lassen ein Rechteck in der Mitte frei. Hier liegt als Symbol der Loge
der Tapis (Teppich) zwischen den drei Lichter tragenden Säulen der
Weisheit, der Stärke und der Schönheit. Im erhöhten Osten bildet den
Mittelpunkt der Altar, auf dem Bibel, Winkelmaß und Zirkel liegen.
Dahinter hat der Meister vom Stuhl seinen Platz, um die Arbeit der
Brüder anzuleiten. Die Einrichtung des Tempels ist original aus dem 18.
Jahrhundert. Die Wände des Tempels sind, unvollkommen mit weißen
Flecken, aus Steinen errichtet. Symbol des Steines ist der einzelne
Freimaurer-Bruder, der als Baustein des Tempels der allgemeinen
Menschenliebe verstanden wird.

Leopold Christoph Graf Schallenberg als Gestalter von Schloss Rosenau
Der junge Leopold Christoph Graf Schallenberg baute im frühen 18. Jhdt.
seinen ererbten Besitz Rosenau zu einem repräsentativen Schloss um und
aus. Schallenberg war ein hochrangiger Beamter am Hof Maria Theresias
und kam dort in engen Kontakt mit der Aufklärung und der Freimaurerei.
Dies dürfte auch der Impuls dafür gewesen sein, im Schloss
Repräsentationsräume und einen Tempel für Logenarbeiten der Freimaurer
einzurichten. Seit 270 Jahren ist dieser Bau in seiner Substanz
unverändert und gilt als Meisterwerk barocken Gestaltungswillens.
Schallenberg beschäftigte einige der bedeutendsten Künstler seiner
Zeit. So den Barockbaumeister Joseph Munggenast (Neffe von Jakob
Prandtauer), der vorher schon beim Bau der Stifte Melk, Altenburg und
Zwettl tätig war.
Top-Künstler des Barock schufen ein wahres Universum von
freimaurerischen Symbolen. Sie finden sich in den Fresken von
Bartolomeo Altomonte, Daniel Gran und vor allem des Architekturmalers
Johann Rinkolin wieder. Erst im Zuge der Renovierungsarbeiten in den
1970er Jahren entdeckte man unter vielen Schichten von Übermalungen
alte Fresken mit freimaurerischen Symbolen und konnte so die
maurerischen Gestaltungsformen rekonstruieren.

Von der Kuenringerburg zum Freimaurermuseum
1194 Hadmar von Kuenring wird
erstmals als Eigentümer einer „Feste Rosenau" urkundlich erwähnt. Dabei
handelte es sich um eine Wasserburg (3 km nordwestlich vom heutigen
Schloss gelegen) als Vorfestung zu Weitra zum Schutz des Weges von und
nach Böhmen.
Im 14. und 15. Jahrhundert erfolgt ein oftmaliger Besitzerwechsel
Rosenaus vom Geschlecht der Pottendorfer zu dem der Liechtensteiner,
der Puchheimer und schließlich zu den Herren von Greiß.
1583 kaufen die Brüder Greiß den sogenannten „Wernhartshof".
1593 baut der jüngere Bruder,
Wolf Dietrich von Greiß, auf diesem Platz ein neues Schloss im
Renaissancestil, das er gleichfalls „Rosenau" nennt.
1614 heiratet Greiß' Tochter
Barbara Magdalena den Grafen Wolf Christoph von Schallenberg. Das
Geschlecht der Schallenbergs bleibt bis zum Jahre 1803 Besitzer der
Herrschaft Rosenau.
Im 17. Jahrhundert wird die Gutshofsiedlung rund um das Schloss durch
die Errichtung von Wirtschaftsgebäuden (Meierhof, Schüttkasten,
Taverne, Bräuhaus etc.) erweitert.
1736-1748 Um- und Ausbau des
Renaissanceschlosses in seine heutige barocke Gestalt durch Leopold
Christoph von Schallenberg (1712-1800). In dieser Zeit werden auch die
Volksschule mit dem angebauten Glockenturm, die Kirche mit dem
Pfarrhof, das „Spital", das „Forsthaus" und „Bandlhaus" mit dem
„Baderhaus" (Haus für den Arzt) errichtet. In diesem Zustand besteht
die Gutshofsiedlung Schloss Rosenau weitgehend bis heute.
1800 Nach dem Tode Leopold Christophs im Jahre 1800 wechseln Schloss und Gutshof mehrmals den Besitzer in relativ kurzen Abständen:
1800-1803 Leopold Christophs Sohn Joseph Schallenberg
1803-1832 der hannoversche Gesandte in Wien, Graf Ernst Christoph von Hardenberg
1832-1863 der Ökonom und Bankier Freiherr Andreas von Stifft
1863-1868 die Handelsfrau Creszentia Stummer aus Brünn
1868 erwirbt der Eisenbahn-Pionier Mathias Ritter von Schönerer das Schloss.
1881 übernimmt dessen Sohn, der
Reichsratsabgeordnete und Führer der deutschnationalen Bewegung in
Österreich, der „Alldeutschen Partei", und notorische Antisemit, Georg
Ritter von Schönerer das Schloss aus dem Nachlass des Vaters.
1921 erben Schönerers drei Töchter den Besitz und erleiden 1935 wirtschaftlich Konkurs. Der Besitz wird zwangsverwaltet.
1938 Übernahme im Zuge des „Anschlusses" an das Deutsche Reich durch die „Deutsche Ansiedlungsgesellschaft".
1943 Von dieser erwirbt der Gutsbesitzer Baron Ludwig Lazarini-Zobelsperg das Schloss.
1945 erklärt die sowjetische
Besatzungsmacht das Gut als „Deutsches Eigentum" und stellt es unter
USIA-Verwaltung. Es folgen Jahre der Plünderung, Zerstörung und
Verwahrlosung.
1955 gelangt der Besitz wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer Lazarini-Zoberlsperg.
1964 Lazarini-Zobelsperg muss
den stark ramponierten Besitz an die N.Ö. Siedlungsgesellschaft
veräußern. Erste Renovierungsarbeiten beginnen.
1964 Gründung des Vereins
„Waldviertelmuseum Schloss Rosenau" (später „Museumsverein Schloss
Rosenau - Österreichisches Freimaurermuseum"). Unter dessen Obmann, dem
damaligen Zwettler Bürgermeister Dr. Anton Denk, wird ein Konzept für
die Nutzung des Schlosses erarbeitet.
1974 Fertigstellung der vom
Land Niederösterreich, Bund und der Stadt Zwettl geförderten Umbau- und
Restaurierungsarbeiten am Schlossgebäude.
1975 Eröffnung des neuen
Freimaurermuseums Schloss Rosenau. Die Einrichtung der ständigen
Ausstellung und die Erweiterung der Sammlung des Museums gelingt durch
die Mitwirkung zahlreicher Brüder der verschiedenen Logen.
2021/22 Umfangreiche
Renovierungsarbeiten der Ausstellungsräume (Fresken, Böden,
Haustechnik) und von Teilen des Schlosshotels durch das Land
Niederösterreich.

Die Stiftung der Pfarre Schloss Rosenau
Im Zuge der Ausgestaltung der Gutshofsiedlung und des Schlossumbaus
wurde von Graf Leopold von Schallenberg mit Zustimmung von Kardinal
Kollonitsch als Propst des Kollegiatsstiftes Zwettl und des Passauer
Konsistoriums in Wien die Pfarre Schloss Rosenau gestiftet. Ein
Original des Stiftsbriefes, der am 1. Juli 1740 ausgestellt und im
Passauerhof in Wien am 2. Oktober 1740 besiegelt worden war, verblieb
bei der Herrschaft und kann im Schloss Rosenau besichtigt werden. Ein
weiteres Exemplar kam in die Kirchenlade und das dritte ging an das
Passauer Konsistorium in Wien.
Eine Abschrift dieser Urkunde aus dem Jahre 1839 fasst kurz zusammen:
„1740 Juli 1, Leopold Graf von Schallenberg stiftet umgränzt und
dotiert mit Einwilligung des Sigismund Cardinal Kollonitsch als Propst
von Zwettl die neuerrichtete Pfarre Schloss Rosenau." Dieser
Stiftsbrief ist nicht nur kirchenrechtlich von Interesse, da
darin Vorsorge getroffen wird, in der neu errichteten Pfarre sowohl den
Unterhalt des Pfarrers, als auch den Bau und die Instandhaltung von
Kirche und Pfarrhof zu sichern. Der Pfarrer von Rieggers wurde für
seinen Verdienstentgang, welcher ihm durch die Abtretung seines
bisherigen Pfarrsprengels Rosenau entstand, entschädigt. Auch
verwaltungstechnisch ist diese Urkunde bedeutsam; denn hier werden
die gesamten Besitzungen des Grafen von Schallenberg angeführt und vor
allem jene Gebiete, welche aus der „Amtskanzley" Rosenau verwaltet
werden, eingegrenzt. Auch die administrative Einheit von Kirche und
Schule ist erkennbar, denn der Schulmeister hatte in der Kirche Dienste
als Mesner zu leisten und für den Gesang in der Heiligen Messe zu
sorgen.
Das Datum des Stiftsbriefes fällt in die letzte Lebensphase von Kaiser
Karl VI., welcher am 20. Oktober 1740 verstarb. Seine Tochter Maria
Theresia folgte ihm als Landesfürstin von Österreich, Königin von
Ungarn und Böhmen. Den Titel als Kaiserin trug sie nicht kraft eigenen
Rechts, sondern als Gemahlin von Franz Stephan von Lothringen, der im
Jahre 1745 in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen Kaiser als Franz
I. gekrönt wurde.

Porträt Leopold Christoph Graf Schallenberg (1712-1800), Kopie, Öl auf Leinwand

Die Welt der Symbole auf den KANONEN-Gläsern der Freimaurer
Die Jahrhunderte der Entstehung der „spekulativen Maurerei", d.h. der
Freimaurerei in unserem heutigen Verständnis, haben eine große Vielfalt
an Freimaurerorganisationen, Obödienzen, Großlogen, Logen, Orden,
Grade, Nebengrade und Hochgrade hervorgebracht. Gleichzeitig entstand
auch eine Unzahl verschiedenster Symbole, die zum Teil bis in die
Sonnenkulte Ägyptens, des Zwischenstromlandes, der Antike und die Zeit
des Alten Testaments zurückreichenund als symbolische „Zitate" auf den
historischen Kanonen-Gläsern zu sehen sind.
Die gesamte Bandbreite der Symbole darzustellen und zu erklären, ist im
Rahmen dieser Präsentation wertvoller Kanonen-Gläser nicht möglich.
Hier können wir nur auf die Fachliteratur zu diesem Thema verweisen und
müssen uns auf eine kleine Auswahl der wichtigsten, bis heute
gebräuchlichen rituellen Symbole und ihre Bedeutung in der Freimaurerei
konzentrieren.
Die Bibel - Das Buch heiliger
Überlieferungen; liegt bei der Logenarbeit im Tempel aut -je nach Art
und Stand des Rituals in geöffneter oder geschlossener Form.
Winkelmaß und Zirkel - Das
Winkelmaß bestimmt das rechte Handeln des Freimaurers, der Zirkel seine
Beziehung zu den Brüdern und zur ganzen Menschheit.
Setzwaage - Symbol für die Gleichheit, das gleiche Recht, die gleiche Würdigung aller. In der Loge das Zeichen des Ersten Aufsehers.
Senkblei - Dieses maurerische
Grundsymbol lehrt die Wahrheit zu suchen und ihr zum Recht zu
verhelfen. In der Loge das Zeichen des Zweiten Aufsehers.
Setzhammeг - Auch Großmeisterhammer" genannt, und teilweise als solcher auch benutzt.
Spitzhammer - Arbeitswerkzeug dest. Grades (Lehrlingsgrad) zur symbolischen Bearbeitung des „rauen Steines"
Sonne - Hauptsymbol einer umfassenden freimaurerischen Lichtsymbolik. Häufiger Logenname, „Zur Sonne".
Mond - Symbol im Abglanz des
Sonnenlichtes. Sonne, Mond und Meister vom Stuhl bilden in der
Freimaurerei die „Drei kleinen Lichter", diese versinnbildlichen. die
Lichtquellen des Lebens.
Kelle - Sinnbild der verbindenden und festigenden Arbeit innerhalb der Bruderschaft. In vielen Lehrarten Symbol des Gesellengrades.
Musivisches Pflaster - Das Pflaster im Salomonischen Tempal. Das Symbol zeigt die Welt als eine ursächliche Verkettung von Gut und Böse.
Die Säulen im Vorhof des Salomonischen Tempels
- Die Säulen J und B sind Hauptsymbole der Freimaurerei-mit Bezug auf
die symbolische Arbeit am salomonischen Tempel der Allgemeinen
Menschenliebe.
Totengedenkzeichen - Memento Mori
Akazienzweig - Maurerisches Symbol des Todes.
Hexagramm - Religiösen Symbol des Judentums, auch als Siegel Salomonis.
Vereinigungsband - zeigt
das geistige Band, das alle Freimaurer zusammenhält. Die darin
enthaltenen Liebesknoten symbolisieren die Verbindung von Diesseits und
Jenseits, von Menschlichem und Göttlichem, das heilige Band der Liebe.
Kette - Symbol der „maurerischen Bruderkette".
Uroboros - Einigkeits- und Unendlichkeitssymbol der sich in den Schwanz beißenden Schlange.
Rauer Stein - Der unbehauene
und raue Stein als Symbol des Lehrlingsgrades. Mit dem Spitzhammer als
Symbol für die Arbeit am rauen Stein", Sinnbild für die Arbeit an sich
selbst.
Behauener Stein - Symbol für den erstrebenswerten, aber nie ganz erreichbaren Endzustand, das ideale Endprodukt der, Arbeit am rauen Stein".
Stufen - Die meisten
Darstellungen mit drei, fünf oder sieben Stufen. Verschiedene Deutung
als Gradsymbole, aber auch: z. B. drei Stufen symbolisieren Mäßig keit,
Gerechtigkeit, Wohlwollen; sieben Stufen die sieben freien Künste und
Wissenschaften.
Tempel Salomonis - Symbol des Tempels der Humanität
Rosen - Sinnbild der Schönheit, der Sehnsucht des Menschen nach neuem, häherom Leben. Auch für Verschwiegenheit.
Schlüssel - Oft gedeutet als Symbol der Verschwiegenheit.
Schwert - Symbol der Ritterlichkeit.
Jakobsleiter - Die Stufen versinnbildlichen die Höherentwicklung der Seele zum Wahren Licht.
Zollstab - Der
vierundzwanzigzöllige Maßstab soll mahnen, seine Zeit gut einzuteilen,
um nicht nur seiner Arbeit, sondern auch allen anderen
Menschenpflichten nachkommen zu können.
„Auge Gottes" - Dieses Symbol soll an die alle Geheimnisse durchdringende ewige Wachsamkeit Gottes gemahnen.

Logengläser, genannt „Kanonen" fanden und finden, in vielen Obödienzen
& Logen bei Festessen an der rituellen „Weißen Tafel" bei
Trinksprüchen und Toasts Verwendung. Das kräftige „Aufsetzen" der
„Kanonen" nach einem ausgebrachten Toast, entsprach der damaligen Sitte
an Fürstenhöfen, Glückwünsche & Botschaften mit Böllerschüssen aus
Kanonen zu bekräftigen, was ihren Namen, wie auch ihre massive
Konstruktion erklärt. Über die Jahrhunderte entstand die Tradition,
„Kanonengläser" durch kunstvolles und üppiges Dekor mit
freimaurerischen Symbolen, zu wertvollen Geschenken bei Ehrungen,
Logenbesuchen, Auszeichnungen, und festlichen Anlässen aller Art zu
machen, wodurch sie u.a. auch zu begehrten Sammelobjekten von
Freimaurern und Kunstexperten wurden.
9 charakteristische Grundformen freimaurerischer Kanonen-Gläser:
Flachfußkanone, Klumpfußkanone, Walzenfußkanone, Facettenfußkanone,
Steindelfußkanone, Klotzfußkanone, Zierfußkanone, Taillenkanone,
Römerkanone

Ein neuer Anfang: Die Zeit der Grenzlogen 1867-1918
Für Österreichs Freimaurer bedeutete der „österreichisch-ungarische
Ausgleich" von 1867 den Aufbruch in eine neue Zeit. Bis dahin war die
Freimaurerei in der Habsburger-Monarchie fast ein
Dreivierteljahrhundert lang verboten gewesen. Doch jetzt wurde sie
durch ein liberales Vereinsgesetz im ungarischen Teil der nunmehrigen
Doppel-Monarchie ermöglicht. Denn der Wiener Ingenieur und
Schriftsteller Franz Julius Schneeberger fand für die in Wien lebenden
Freimaurer einen kreativen Ausweg: Er gründete in Wien den
,,nicht-politischen Verein Humanitas" (1869) und unmittelbar jenseits
der Grenze im damals ungarischen Neudörfl (bei Wiener Neustadt) die
reguläre Loge „Humanitas" (1871). Dort hielten die österreichischen
Freimaurer ihre rituellen Arbeiten ab - in Wien trafen sie sich
lediglich zu Diskussionen und administrativen Arbeiten. Weitere Logen
folgten dem Beispiel der „Humanitas", die meisten hatten ihre
Ritualräume (Tempel) in Pressburg (heute Bratislava, ungarisch
Pozsony). Dieses System der so genannten „Grenzlogen" bescherte der
Freimaurerei einen neuen Aufschwung. 1914 zählte man 14 solcher
„Grenzlogen" mit insgesamt mehr als 1.000 Brüdern.

Menschlichkeit und Karitatives als Programm
In der Grenzlogenzeit wurde der Grundstein für zahlreiche karitative
Aktivitäten im Sinne der Wohltätigkeit und Menschlichkeit gelegt. Als
Beispiele seien hier unter anderen ein Asyl für schutzlose Mädchen,
Knabenbeschäftigungsanstalten und Asyle für schulpflichtige Kinder,
Heime für obdachlose Familien, Ferienkolonien für Kinder, ein Asyl für
blinde Kinder, das Franz-Josephs-Rekonvaleszentenheim oder ein Asyl für
misshandelte Kinder genannt. Weitere Hilfsmaßnahmen waren die Gründung
der Entbindungsanstalt „Lucina" sowie eines Witwen- und Waisenfonds,
Unterstützungen für den Verein gegen Verarmung und Bettelei, für die
Ausspeisung armer Schulkinder, für die Suppen- und Teeanstalt und für
die Wiener Rettungsgesellschaft. Besonders hervorzuheben ist das von
der Loge „Humanitas" 1875 gegründete „Erste österreichische Kinderasyl"
im Kahlenbergerdorf bei Wien: Es bestand bis 1931 und sorgte für die
Erziehung und Ausbildung von Waisenkindern, von 1898 bis 1913 wurde
dafür sogar ein zweites Kinderheim in Saubersdorf im südlichen
Niederösterreich eingerichtet. Bis heute gehören langjährige
Hilfsaktionen für soziale Einrichtungen und die nachhaltige
Unterstützung einzelner Notleidender zu den Leistungen der Logen im
Dienst der Wohltätigkeit.
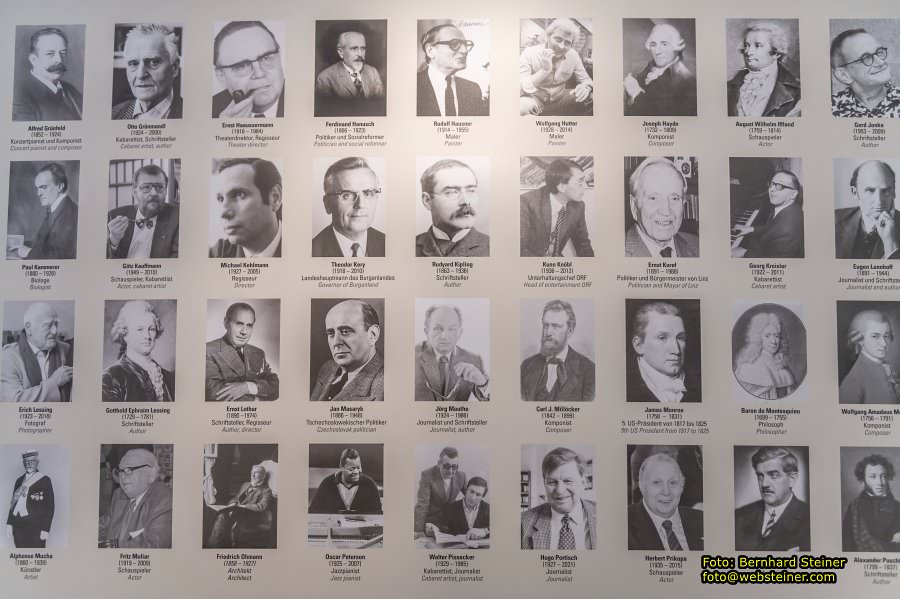
Die Gründung der Großloge von Wien 1918
Wenige Tage nach dem Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918
und der Ausrufung der Ersten Republik am 12. November 1918 erfolgte am
8. Dezember die Gründung der „Großloge von Wien" durch die bisherigen
Grenzlogen „Humanitas", „Sokrates", „Eintracht", „Treue", „Lessing Zu
den 3 Ringen", „Kosmos", „Gleichheit", „Zukunft", „Schiller",
„Freundschaft", „Goethe", „Pionier", „Zur Wahrheit" und „Fortschritt.
Die Logen arbeiteten im Logenhaus in Wien, in der Dorotheergasse 12.
Dr. Adolf Kapralik war hammerführender Meister bei der Gründung der
Großloge, und ein Großbeamtenrat mit 15 Mitgliedern unter Führung von
drei Deputierten Großmeistern (Dr. Adolf Kapralik, Dr. Hans Neeser und
Dr. Heinrich Ornstein) leitete zunächst die Geschäfte. Bei der Wahl am
31. Mai 1919 wurde Dr. Richard Schlesinger zum Großmeister gekürt. Er
sollte das Amt bis zum Ende der Ersten Republik 1938 ausfüllen. Er
verstarb nach Gestapo-Haft infolge verweigerter ärztlicher Versorgung
im Gefängnis am 5. Juni 1938. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg nutzte
die Großloge von Wien die Strukturen der Grenzlogen und entwickelte
sich rasch zu einem Treffpunkt für Persönlichkeiten, denen die
Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit am Herzen lagen.
In der praktischen Arbeit konzentrierte sich die Tätigkeit vor allem
auf soziale Aktivitäten zur Linderung der Not im Nachkriegsösterreich.
1926 erfolgte die Gründung der „Österreichischen Liga für
Menschenrechte" unter Beteiligung zahlreicher Freimaurer.
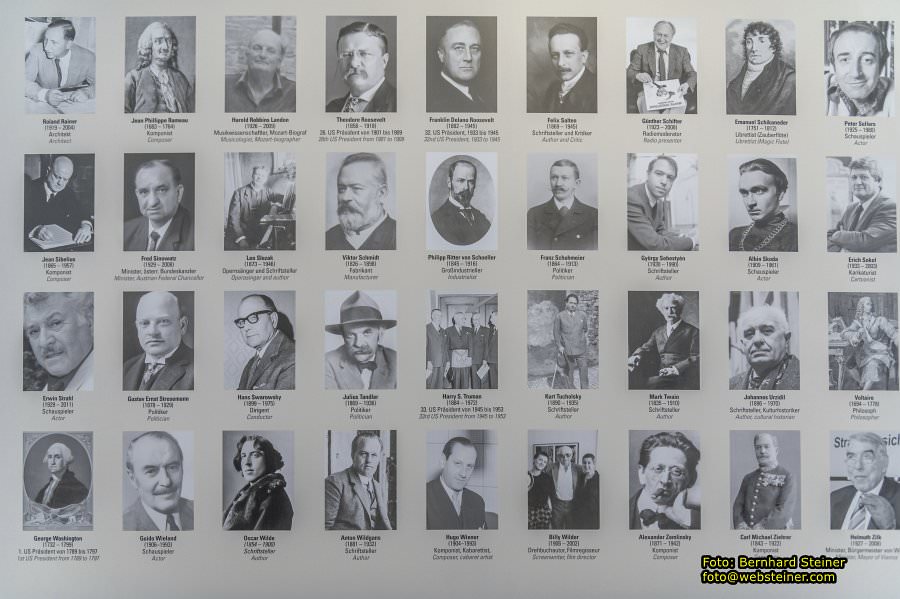
Für eine gerechtere Welt
Nach dem Ersten Weltkrieg war der Alltag der Menschen durch eine
katastrophale Wohnsituation, triste Familienverhältnisse, verwahrloste
Kinder mit mangelnder Bildung und, vor allem in den Großstädten, von
Arbeitslosigkeit und Lohndumping bestimmt. An der Lösung dieser
Probleme beteiligten sich zahlreiche Freimaurer. Besonders in Wien
versuchten sozialdemokratische Politiker mit einem neuen politischen
und sozialen Gesellschaftsmodell Antworten zu finden, was zum Teil auf
erheblichen Widerstand konservativer politischer Kräfte stieß.
Der 1922 in der Loge „Lessing Zu den drei Ringen" zum Meister erhobene
Anatom Dr. Julius Tandler zählte zweifellos zu den wichtigsten
Sozialreformern in der Zwischenkriegszeit. Seine Idee vom
„geschlossenen System der Fürsorge" sah die Aufgabe der Sozialpolitik
vorrangig im Verhindern von Krankheiten und ihrer sozialen Ursachen.
Der Großteil der bis heute wirksamen sozialmedizinischen Reformen geht
auf den damaligen Wiener Stadtrat für Gesundheitswesen zurück:
Bekämpfung der hohen Säuglingssterblichkeit und der Tuberkulose,
großzügige Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten und
Kinderhorte, Mutterberatungsstellen, Schulzahnkliniken und der Kampf
gegen den Alkoholismus. An das von Tandler 1927 eingeführte kostenlose
Säuglingswäschepaket erinnern sich viele bis heute. Es war gebunden an
die gleichzeitige gesundheitliche Kontrolle der werdenden Mütter - ein
System, das heute im „Eltern-Kind-Pass" seine Fortsetzung findet. Basis
für Tandlers Aktivitäten waren die von Sozialminister Ferdinand Hanusch
(1866-1923) eingeleiteten Reformen im Sozialversicherungswesen.

Friedensnobelpreis und Europaidee
Der Zweifel an der wirtschaftlichen und politischen Lebensfähigkeit
Österreichs und die instabile politische Weltlage veranlassten viele
Freimaurer, sich aktiv gegen den Krieg und für Frieden und
Zusammenarbeit zu engagieren. Das Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges war von verzweifelten Versuchen geprägt, die Ideale von
Humanität und Toleranz im Sinne eines umfassenden Pazifismus am Leben
zu erhalten. Ein wichtiger Vertreter der Friedensbewegung dieser Jahre
war der überzeugte Pazifist und Freimaurer der Grenzloge „Sokrates",
Alfred Hermann Fried (1846-1921).
Er gründete 1892 mit der ebenso überzeugten Pazifistin Bertha von
Suttner, die „Deutsche Friedensgesellschaft" und veröffentlichte
Publikationen wie „Die Friedenswarte". Fried wurde für seine
Friedensaktivitäten 1911 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Als
Teil seiner pazifistischen Weltanschauung und Möglichkeit einer
umfassenden Völkerverständigung engagierte sich Fried auch für die
„Sprache des Friedens", Esperanto, für die er 1903 sogar ein Lehrbuch
veröffentlichte. Ebenfalls in diesem Zeitraum entwickelte ein anderer
Bruder, Richard Coudenhove-Kalergi, seine Vision und seinen Plan für
die Schaffung einer „Paneuropa-Bewegung" zur Friedenssicherung und
Völkerverständigung, die als eine gedankliche Grundlage der heutigen
Europäischen Union anzusehen ist.

Die Feinde der Freimaurer - die Verschwörungstheoretiker
Die Freimaurer stellen ein zentrales Feindbild für totalitäre Systeme
dar. Der Grund liegt vor allem darin, weil sie die Souveränität und
Würde jedes Menschen gegen den Totalitätsanspruch von Staaten, Nationen
und Parteien verteidigen. Freimaurer bestehen auf dem Recht der eigenen
Meinung, auf Pluralismus und Demokratie. Obwohl der Anteil der
Freimaurer an der Gesamtbevölkerung gering ist, überschätzten und
überschätzen autoritäre Systeme wie der Nationalsozialismus, der
Faschismus oder der Bolschewismus den Einfluss der Maurerei und
missverstanden das freimaurerische Gedankengut völlig.
Einem bekannten psychologischen Muster folgend, identifizierte zum
Beispiel der Nationalsozialismus alle Systemgegner als „geheime
Verschwörer". Für diese Rolle war die diskrete Gesellschaft der
Freimaurer besonders geeignet. Überdies wurde, vom hohen Anteil an
jüdischen Mitgliedern in Österreich ausgehend, die Gleichsetzung von
„Freimaurer" und „Jude" vollzogen und so ein Feindbild mit einem
anderen verstärkt. Im Kampf gegen die Freimaurerei erschien eine Unzahl
von fanatischen Schmähschriften und verhetzenden Artikeln in der Presse.

Auf dem Weg zum Austrofaschismus 1933 bis 1938
In Krisenzeiten sind Verschwörungstheorien an der Tagesordnung, um
gegen einen vermeintlichen inneren oder äußeren Feind vorzugehen.
Antimasonismus und Antisemitismus gehören dazu: So beschuldigte zum
Beispiel der Wiener deutschnationale Abgeordnete Friedrich Wichtl die
Freimaurer der Beteiligung an der Ermordung des Thronfolgers Franz
Ferdinand und daher die wahren Urheber des Ersten Weltkriegs zu sein.
Der deutsche General Erich Ludendorff tat sich auf internationaler
Ebene als Vertreter antimasonischer Verschwörungstheorien besonders
hervor: In zahlreichen Artikeln und mehreren Pamphleten führte er nach
seinem politischen Scheitern in der Weimarer Republik einen heftigen
Kampf gegen Freimaurer, Juden und Jesuiten sowie gegen die
Nationalsozialisten, an deren Seite er anfangs eine politische Karriere
zu machen gehofft hatte.
Mit der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 durch Bundeskanzler
Engelbert Dollfuß und der Errichtung des autoritären Ständestaates
verstärkten sich die antimasonischen Positionen im politischen System
Österreichs. Zwar wurden die Freimaurer im Gegensatz zu politischen
Parteien und deren Vorfeldorganisationen nicht verboten, die
Logenarbeit wurde aber von der Polizei überwacht. Von Beamten aller
Ebenen der öffentlichen Verwaltung wurde gefordert, aus den Logen
auszutreten. Dies legte wiederum die Großloge von Wien, aus Sorge um
ihre Sicherheit, ihren deklariert sozialistischen Mitgliedern nahe -
die Folge war ein großer Aderlass von bis zu 700 Mitgliedern. Dies
verschärfte sich nach dem Bürgerkrieg im Februar 1934, Logenarbeit
wurde nahezu unmöglich.

Das Ende der Freimaurerei 1938: Die Vernichtung einer Idee
Duldete der christliche Ständestaat die Freimaurerei, wenn auch mit
großen Einschränkungen, so ging es nach der Annexion Österreichs durch
Nazi-Deutschland Schlag auf Schlag: Am 13. März 1938, nur einen Tag
nach dem Einmarsch deutscher Truppen, wurden nicht nur die jüdische
Bevölkerung, sondern auch die Freimaurer verfolgt, beraubt und zum Teil
auch ermordet. Das Vermögen der „Großloge von Wien" wurde eingezogen,
das Logenhaus in der Dorotheergasse 12 verwüstet und alle beweglichen
Güter inklusive Archiv in die Gestapo-Leitstelle und später von dort
nach Berlin verbracht. Einzig die Bibliothek der „Großloge von Wien"
wurde 1938 auf Betreiben von Paul Heigl, dem NS-Generaldirektor der
Österreichischen Nationalbibliothek, in deren Bestand integriert. Das
Archiv und wertvolle Exponate transportierte 1945 die siegreiche Rote
Armee zusammen mit anderen „Beuteakten" nach Moskau, wo sie noch heute
lagern. An die 100 Brüder wurden in NS-Konzentrationslagern ermordet,
an die 600 gingen ins Exil, wo sie eigene Logen gründeten. Es soll
allerdings nicht verschwiegen werden, dass unter den verbleibenden
österreichischen Brüdern nur eine verschwindende Minderheit Widerstand
leistete und sich viele mit dem NS-Regime arrangierten, um ihre
Karriere fortsetzen zu können.

Freimaurerei im Exil
Etwa 600 österreichischen Freimaurern gelang nach dem „Anschluss" im
März 1938 und der damit verbundenen Zerschlagung der Großloge von Wien
die ihr Leben rettende Flucht aus ihrer Heimat in eine unbekannte neue.
Viele wurden vom NS-Regime verfolgt, weil sie Juden waren. Die ersten
Stationen ihrer Flucht waren Prag, Paris oder London, viele ließen
nichts unversucht, den europäischen Kontinent aufgrund der absehbaren
Kriegshandlungen rasch in Richtung Amerika zu verlassen. Da die
Freimaurerei in Ritualen und Gebräuchen von Land zu Land sehr starke
Unterschiede aufweist, war es das Bestreben vieler Freimaurer im Exil,
ihre spezielle österreichische Art des Logenlebens mit Schroeder-Ritual
und Vortrag mit anschließender Diskussion auch an ihren neuen
Aufenthaltsort zu verpflanzen.
In Paris konnte 1939 unter dem Dach der Grande Loge de France die Loge
„Mozart" gegründet werden, die wenige Monate nach Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs ihre Pforten wieder schließen musste. Österreichische
Exillogen, die sich während oder nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem
Dach der in den Ländern jeweils vorhandenen Großlogen konstituierten,
versuchten auch eigene Logen zu gründen, allein der Weg dorthin war
lang und steinig. So konnte zum Beispiel in London die Loge „Mozart"
erst 1948 gegründet werden, da während des Krieges österreichischen
Freimaurern sogar der Besuch britischer Logen untersagt war. Die USA
waren das Wunschziel der meisten Exilanten ab 1938 und auch noch nach
1945. Dies lag am Mythos des klassischen Einwanderungslandes, in dem
sich auch Juden vor Verfolgung sicher fühlten. Flüchtlinge aus dem
NS-Herrschaftsbereich wurden allerdings nur im Rahmen der geregelten
Einwanderungsquoten aufgenommen.

Der Neubeginn nach 1945
Nur wenige Tage nach dem Ende des 2. Weltkrieges berief der bis März
1938 amtierende Deputierte Großmeister Karl Doppler in Wien für den 28.
Juli 1945 die erste Versammlung von Brüdern ein. Es wurde dabei die
Gründung einer „Sammelloge", der Loge „Humanitas renata," beschlossen:
Von den knapp 2.000 Freimaurern der Vorkriegszeit erschienen nur mehr
67 in den alten Räumlichkeiten in der Dorotheergasse 12; die meisten
waren verschleppt oder ermordet worden, in Gefangenschaft geraten,
ausgewandert oder inzwischen verstorben. Am 20. Oktober 1945 fand
schließlich eine erste rituelle Arbeit statt, die ganz dem Gedenken an
die unter dem NS-Regime Ermordeten und Verschleppten stand.
Die damals noch kleine Gemeinschaft - trotz der geringen Anzahl an
Mitgliedern wurde nach 1945 streng darauf geachtet, dass keine
Personen, die mit der NSDAP oder ihren Vorfeldorganisationen in
Verbindung gekommen waren, aufgenommen wurden - bezog wieder das 1938
verwüstete und beschlagnahmte Logenhaus in der Wiener Dorotheergasse
Nr. 12. Kurze Zeit später nahm mit Genehmigung der Besatzungsmächte die
„Großloge von Wien für Österreich" ihre Arbeit auf. Zum ersten
Großmeister wurde der Arzt Dr. Karl Doppler gewählt, nach dessen Tod
zwei Jahre später Bernhard Scheichelbauer als sein Nachfolger. Er
erreichte 1952 die Anerkennung durch die Großloge von England und damit
die volle Einbindung in die Gemeinschaft aller regulären
Freimaurer-Logen und Großlogen der Welt. Nach dem Staatsvertrag 1955
wurde die „Großloge von Wien für Österreich" zu der bis heute
bestehenden „Großloge von Österreich" umbenannt.
Freimaurerei in der Zweiten Republik
Nach der Konsolidierung der Logenarbeiten in Wien wurde auch in den
anderen Bundesländern die freimaurerische Tätigkeit (wieder)
aufgenommen. Einige der bereits vor 1938 bestehenden Logen wurden Zug
um Zug reaktiviert und begannen die freimaurerische Aktivität: Schon am
11. Oktober 1945 arbeitete die erweckte Kärntner Loge „Paracelsus"
wieder rituell und in den nächsten Jahren folgten die Arbeiten in
wieder belebten oder neuen Logen in Oberösterreich (1950), Tirol
(1954), Steiermark (1964), Salzburg (1967), Burgenland (1971),
Niederösterreich (1990) und zuletzt auch Vorarlberg (2005).
Mit 2023 stehen mittlerweile 82 Logen mit etwa 4.000 Mitgliedern unter
dem Schutz der regulären Großloge von Österreich. Im Laufe der Jahre
konstituierten sich auch andere Obödienzen, die nicht von der Großloge
von England und damit auch nicht von der Großloge von Österreich
anerkannt werden: 1955 hatten sich mehrere Mitglieder der Loge
„Zukunft" von der regulären österreichischen Großloge getrennt und die
„Unabhängige Freimaurerloge Wien" (heute „Großorient von Österreich")
gegründet; ebenfalls 1955 wurde der sowohl für Frauen als auch Männer
offene Freimaurerorden „Droit Humain" wieder belebt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: