web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Ambras Innsbruck
Kunstmuseum, Oktober 2024
Unter der Bezeichnung Schloss Ambras Innsbruck wird Schloss Ambras bei Innsbruck als Kunstmuseum vermarktet. Es ist das einzige außerhalb der Bundeshauptstadt Wien befindliche Bundesmuseum der Republik Österreich. Verwaltungsmäßig ist es dem Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) zugeordnet und gehört zum KHM-Museumsverband. Schloss Ambras ist eine dreiteilige Renaissance-Schlossanlage, bestehend aus dem Ambraser Unterschloss, dem Ambraser Hochschloss sowie dem Spanischen Saal. Im Kern beinhaltet es die Sammlungen eines des bedeutendsten Sammlers der Habsburgerdynastie: Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595).

Der Renaissancefürst Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) war der Sohn
Kaiser Ferdinands I. Zunächst residierte er als Statthalter im
Königreich Böhmen und war dann fast dreißig Jahre lang Landesfürst von
Tirol. Er ließ die mittelalterliche Burg Ambras als Geschenk für seine
Frau Philippine Welser (1527-1580) zum prachtvollen Renaissanceschloss
ausbauen und lebte hier ab 1567 (heute Hochschloss).
Ferdinand II. war eine der bedeutendsten Sammlerpersönlichkeiten seiner
Zeit. Unterhalb des Hochschlosses entstand ein zusätzliches Gebäude für
seine reichhaltige Bibliothek, seine Rüstkammern und die berühmte
Kunst- und Wunderkammer (heute Unterschloss). Die Anlage wurde schon
damals als „Museum" bezeichnet und war eine der frühesten ausdrücklich
für diesen Zweck errichteten Bauten. Bis heute befindet sich ein Teil
von Ferdinands Sammlungen am ursprünglichen Bestimmungsort auf Schloss
Ambras Innsbruck. Auf diese Weise ist das Unterschloss bis in unsere
Zeit selbst zum Renaissance-Exponat geworden: das erste Museum der Welt!

ZWEI FELDHARNISCHE
NÜRNBERG, UM 1515 UND UM 1520/25, EISEN
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER
Der Riefelharnisch ist die typische Rüstung der süddeutschen und
österreichischen Kavallerie des frühen 16. Jahrunderts. Die Fältelung
der Feldharnische ahmt plissierte textile Stoffe nach und erhöht damit
die Festigkeit der Rüstung.
KINDERHARNISCH VON KÖNIG LUDWIG II. VON UNGARN
KONRAD SEUSENHOFER, INNSBRUCK, 1515, EISEN
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER
Erzherzog Ferdinand II. nahm diesen Knabenharnisch König Ludwigs II.
von Ungarn (1506-1526) in seine Sammlung auf. Der junge König war 1526
in der Schlacht bei Mohács gegen die Türken gefallen - dadurch fielen
die Königsreiche Ungarn und Böhmen an die Habsburger.
ERZHERZOG FERDINAND II. IN DER ADLERGARNITUR
FRANCESCO TERZIO (?), 1556-1557, ÖL AUF LEINWAND
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE (SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK)
Das Porträt zeigt Erzherzog Ferdinand II. in der sog. Adlergarnitur mit
dem für ihn charakteristischen „Böhmischen Hut". Auf dem Tisch neben
ihm liegen ein Mantelhelm mit rotem Federbusch ein Fausthandschuh sowie
eine rote Schärpe. Diese militärischen Bezüge verweisen auf das
Kommando Ferdinands in Ungarn gegen die Osmanen im Jahre 1556. Der
Kempfküriss mit den vergoldeten Wappenadlern in Ätzdekor und setzt sich
aus 87 Einzelteilen zusammen. Er wurde 1547 von Jörg Seusenhofer für
Ferdinand hergestellt und war eine der teuersten Rüstungsensembles der
Zeit.

Schloss Ambras Innsbruck ist ein Renaissance-Juwel. Einen wichtigen
Teil bilden die Rüstkammern mit Rüstungen, Waffen und Porträts. In der
Heldenrüstkammer setzt Erzherzog Ferdinand II. eine damals neue und
einzigartige Idee um: In Kästen aus Zirbenholz stellt er Rüstungen von
berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit aus, um an ihre besonderen
„Heldentaten" zu erinnern. Es ist für das Zeitalter der Renaissance
charakteristisch, dass das Individuum im Mittelpunkt des Interesses
steht. Ferdinand stellte in seinen umfangreichen Rüstkammern neben
berühmten Kriegsherren und der Habsburgerdynastie auch das ritterliche
Turnier sowie nicht zuletzt sich selbst dar.

HARNISCH ZUM FREIRENNEN, INNSBRUCK, UM 1580/90, EISEN
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, HOFJAGD- UND RÜSTKAMMER
Die Größe und der vergoldete Rüsthaken des Plankengestech-Harnischs mit
rot-weiß-roter Federzier lassen erkennen, dass er Erzherzog Ferdinand
II. selbst gehörte. „Freiturnier" oder „Freirennen" wurde der
sportliche Reiterkampf genannt, der zuerst mit scharfen Spießen und
anschließend mit Schwertern ausgetragen wurde. Dazu trug man den
Feldharnisch mit kleineren Verstärkungen. Der beim Freirennen übliche
Sattel wurde als „Kürißsattel" bezeichnet. Die Zäumung und Schirrung
aus Hanfgurten sind größtenteils original erhalten.

SECHS HARNISCHE ZUM FREIRENNEN
ANTON PEFFENHAUSER, AUGSBURG, UM 1560/70; INNSBRUCK, UM 1560/80, EISEN
SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Anton Peffenhauser (1525-1603) war der berühmteste Plattner aus der
Augsburger Werkstätte. Erzerhzog Ferdinand II. ließ bei ihm bereits zu
seiner Prager Zeit Harnische anfertigen, als er Statthalter im
Königreich Böhmen war (1547-1567). „Freiturnier" oder „Freirennen"
wurde der sportliche Reiterkampf genannt, der zuerst mit scharfen
Spießen und anschließend mit Schwertern ausgetragen wurde. Dazu trug
man den Feldharnisch mit kleineren Verstärkungen.

Die zweite Rüstkammer rückt Erzherzog Ferdinand II. als Gastgeber,
Veranstalter und Regisseur höfischer Turniere und Feste in den
Mittelpunkt. Die Rüstungen sind Meisterwerke Prager sowie Innsbrucker
Plattnereien, wobei vor allem der Innsbrucker Jakob Topf mehrere
Großaufträge erhielt. Zu sehen sind Turnierharnische für das
Fußturnier, das Plankengestech und das Freiturnier. Das Fußturnier
wurde zu zweit oder in einer Gruppe mit Langspießen und Schwertern auf
einem eingezäunten Platz ausgefochten. Das Plankengestech verdankt
seinen Namen einer hölzernen Barriere, die die Kämpfenden in Augenhöhe
der Pferde trennte. Als Freiturnier bezeichnet man den sportlichen
Reiterkampf, der zuerst mit scharfen Lanzen und anschließend mit
stumpfen Schwertern ausgetragen wurde.
Das Zentrum der Leibrüstkammer bildet der Hochzeitsharnisch Ferdinands
in antikisierendem Stil. Er trug die Prunkrüstung zu den
Feierlichkeiten seiner zweiten Hochzeit mit Anna Caterina Gonzaga 1582.
Die Porträts zeigen berühmte Feldherrn des 16. Jahrhunderts, deren
Harnische und Waffen Ferdinand in seiner Heldenrüstkammer präsentierte.

In der dritten Rüstkammer sind Rüstungen und Waffen aus dem
Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) zu sehen. Dieser Krieg wurde vor
allem in Deutschen Landen und in Böhmen ausgetragen. Er entstand
zunächst aufgrund religiöser Gegensätze und entwickelte sich bald zu
einem Kampf um die Vorherrschaft in Europa. Die Harnische und Waffen im vorderen Teil der Rüstkammer (bis zum
vierten Fenster) gehen auf die erste Hälfte des Dreißigjährigen Krieges
zurück. Auf der rechten Seite befinden sich Kavallerie-, auf der linken
Infanteriewaffen. Der hintere Rüstkammerbereich dokumentiert die zweite
Phase des Dreißigjährigen Krieges und den Beginn des Türkenkriegs 1663
unter Kaiser Leopold I. (1640-1705). Die Waffen und Rüstungen sind seit
1981 hier ausgestellt und stammen großteils aus den Beständen des
ehemaligen Wiener Zeughauses. Sie machen den Unterschied von
prunkvollen Einzelanfertigungen der Renaissance zu sereinmäßigem
Kriegswerkzeug der Barockzeit deutlich. Zugleich führen sie das
Aussehen einer barocken Zeughausaufstellung vor Augen.
Das Deckengemälde wurde 1586 von Giovanni Battista Fontana gemalt und
1880 hierher transferiert. Ursprünglich befand es sich im fürstlichen
Speisesaal in einem Gebäude gegenüber des Hochschlosses (heute
Terrassen-stöckl), das im 19. Jahrhundert umgebaut wurde.

Der Ambraser Sternenhimmel ist
das Resultat des Zeitgeistes der Renaissance mit dem Drang des
Menschen, die ihn umgebende Natur zu entdecken und seinen
Wissenshorizont zu erweitern. Das Ambraser Deckengemälde von Giovanni
Battista Fontana, dem Hofmaler Erzherzog Ferdinands II., befand sich
ursprünglich im heute nicht mehr erhaltenen Speisesaal.
Die Gestaltung des Gemäldes berücksichtigt zwar die Einteilung in eine
nördliche und eine südliche Hemisphäre, die Personifikationen der
Sternbilder sind astronomisch jedoch willkürlich angeordnet. Die
Zusammenstellung folgt den Schriften des antiken Astronomen Claudius
Ptolemäus: 37 Sternbilder sind vor dem himmelblauen Hintergrund
dargestellt, darunter auch das „Haar der Berenike", das erst in den
1530er Jahren in die Astronomie eingeführt wurde. In den Seitenfeldern
sind die damals bekannten sieben Planeten sowie in den Ecken die vier
Elemente dargestellt. Die zwölf Tierkreiszeichen umlaufen in einem
ovalen Band das Universum. Sternenhimmel als Dekoration waren in der
Renaissance in fürstlichen Residenzen überaus beliebt.
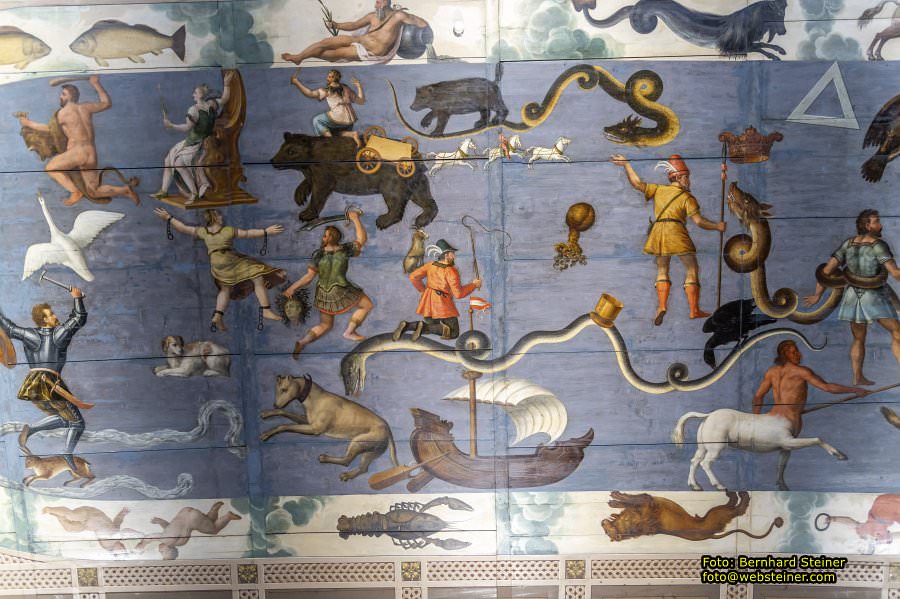
Am ursprünglichen Ort der Kunst- und Wunderkammer wurde im 19.
Jahrhundert die Raumhöhe aufgestockt und das Deckengemälde des
»Sternhimmels« (Giovanni Battista Fontana, um 1586) montiert. Heute
zeigt das Museum dort seit 1981 Rüstungen und Waffen aus dem
Dreißigjährigen Krieg (1618–1648), die großteils aus den Beständen des
ehemaligen Wiener Zeughauses stammen. Sie machen den Unterschied von
prunkvollen Einzelanfertigungen der Renaissance zu serienmäßigem
Kriegswerkzeug der Barockzeit deutlich. Zugleich führen sie das
Aussehen einer barocken Zeughausaufstellung vor Augen.

Erzherzog Ferdinand II. ließ eigens für seine bereits zu Lebzeiten
berühmten Sammlungen ab 1570 das sogenannte Unterschloss von Schloss
Ambras errichten: eine als unregelmäßiges Fünfeck konzipierte
selbständige Anlage. Es war damals einer der frühesten Bauten
überhaupt, der explizit für den Verwendungszweck als Museum gedacht
war. Bereits zu Ferdinands II. Lebzeiten wurde dafür der Begriff
„Museum“ verwendet, wie ein Federzeichnung des Hofmalers Joris
Hoefnagel belegt. Das Ambraser Unterschloss ist das einzige noch
erhaltene Museumsgebäude der Renaissance, in dem sich bis heute ein
Teil der Sammlungen Ferdinands II. an ihrem ursprünglichen
Bestimmungsort erhalten haben und immer noch dort ausgestellt sind:
Schloss Ambras ist in dieser Hinsicht das erste Museum der Welt und das
Unterschloss auf diese Weise bis in unsere Zeit selbst zum Exponat
geworden.

Erzherzog Ferdinands II. Museumsidee war gänzlich neu: Er wollte von
berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit Rüstungen, die diese tatsächlich
getragen hatten, sammeln. Diese Harnische präsentierte er „zum ewigen
Gedächtnis“ der Feldherren in der sogenannten Heldenrüstkammer. Damit
verbunden entstand das sogenannte Armamentarium Heroicum: Dieses
Prachtbuch zeigt auf der einen Seite eine Darstellung des jeweiligen
„Helden“ und führt auf der anderen dessen Biographie an. Zudem legte er
eine enorme Sammlung an Porträts in den unterschiedlichsten Formaten
von Miniatur bis Lebensgröße an. Mit dieser neuartigen Museums-Idee der
Heldenrüstkammer kann Ferdinand II. als der Begründer des
systematischen Sammlungswesens gelten.

Die Kunst- und Wunderkammern der Renaissance waren enzyklopädische
Sammlungen, die das gesamte Wissen ihrer Zeit zu erfassen versuchten.
Bereits im 16. Jahrhundert war die Kunst- und Wunderkammer Erzherzog
Ferdinands II. eine der bedeutendsten ihrer Art. Heute ist sie die
einzige erhaltene Kunstkammer der Renaissance, die sich noch immer in
dem für sie errichteten Gebäude befindet.
Die herausragende Sammlung umfasst außergewöhnliche Naturgegenstände
und kostbare Kunstobjekte etwa aus Bergkristall und Koralle, aber auch
Silber- und Goldschmiedearbeiten sowie Bronzeplastiken, Glas oder
Porzellan und filigrane Drechselarbeiten aus Holz und Elfenbein oder
Seidenmalereien, wissenschaftliche Instrumente und Musikinstrumente.
Auch rare, exotische und außergewöhnliche Naturgegenstände sowie
Porträts von Menschen oder Tieren, die als »Wunder der Natur« galten,
waren begehrte Sammelstücke. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Kunst-
und Wunderkammer 1974, als sie in Anlehnung an historische Inventare
hier am Ort der einstigen Bibliothek Ferdinands neu aufgestellt wurde.

Ariadne und Bacchus, Italien, 16. Jh.
Diese Figurengruppe aus Alabaster stellt den griechischen Weingott
Dionysos (röm.= Bacchus) und seine Frau Ariadne dar. Die Tochter des
kretischen Königs Minos hatte Theseus geholfen, aus dem Labyrinth ihres
Halbbruders Minotaurus zu entkommen. Sie floh mit ihm zusammen aus
Kreta, wurde aber auf Naxos von ihm zurück gelassen, wo sich der
Weingott in sie verliebte.

Adam und Eva, Deutsch, spätes 16. Jh. (?)
Die beiden Figurengruppen sind Beispiele für die an der Anatomie
geschulte Darstellung nackter Menschen in der Renaissance. Adam und Eva
hatten Künstlern allerdings bereits im Mittelalter eine der wenigen
Gelegenheiten geboten, Akte zu gestalten. Adam nimmt hier den Apfel des
Paradieses aus Evas Hand hinter der Schulter versteckt entgegen.

SPIEGEL, MURANO (?), 2. HÄLFTE 16. JH., SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Nach Art einer Rosette sind um ein Mittelstück 14 blattförmige
Konvexspiegel strahlenförmig angeordnet, sodass eine Multiplikation des
Gespiegelten erreicht wird. Die Spiegelgläser sind auf Pappe aufgelegt
und mit Stanniol unterlegt. Es sind, wie im Mittelalter üblich, konvexe
Rundspiegel. Erst 1516 war es zwei Glasmachern aus Murano gelungen,
plane Glasspiegel herzustellen.

KABINETTSCHRANK, AUGSBURG, ENDE 16. JAHRHUNDERT
ALABASTER, MARMOR, HOLZ, VERGOLDETE BRONZE, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Der Kabinettschrank in Form eines zwölfachsigen, dreigeschossigen
Palastes aus Alabaster und Marmor diente zur Aufbewahrung von Münzen,
Kameen und Schmuck. Einer der vier Treppentürme ist abnehmbar und am
Sockel versperrbar. Dahinter befindet sich ein zylinderförmiger,
drehbarer Holzkasten mit 6 mal 28 übereinander liegenden Laden. Die
besondere Bedeutung des Kabinettschrankes liegt in seiner
Doppeldeutigkeit als kostbares Kunstwerk und raffinierter Tresor.

ESTHER UND AHASVEROS, HANS SCHÖPFER D. A. (?), 1546-1569
ÖL AUF LEINWAND, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, GEMÄLDEGALERIE
1569 erbat sich Erzherzog Ferdinand II. vom Augsburger Patrizier Karl
Villinger dieses Historienbild und stellte es genau an diesem Platz
aus. Es zeigt die alttestamentarische Geschichte von Esther und
Ahasveros. Die schöne, junge Jüdin Esther rettete ihr Volk vor den
Verfolgungen Hamans, dem ersten Minister des Perserkönigs Artaxerxes (=
Ahasveros). Am Ende wurde der Verschwörer hingerichtet und die
Verfolgten gelangten zu hohen Ehren. Im 16. Jh. galt die Geschichte als
Parallelfall zum Kampf der katholischen Kirche gegen den
Protestantismus. Am linken Bildrand ist ein Profilbildnis Kaiser
Maximilians I. erkennbar, der Villingers Vater zum Ritter geschlagen
hatte.

Die Ambraser Sammlung birgt eine der bedeutendsten europäischen
Sammlungen an „Exotica“, von denen etwa die „Ryukyu Schale“, die
einzigen außerhalb Japans erhaltenen Seidentücher aus dem 16.
Jahrhundert oder eine der weltweit fünf erhaltenen Weltchronik in Form
eines Fliegenwedels hervorzuheben sind. Höhepunkte der Ferdinandeischen
Kunst- und Wunderkammer sind die spätmittelalterliche Skulptur aus
Birnbaumholz, das „Tödlein“, der Ambraser „Schüttelkasten“, das Bildnis
des Mannes mit Behinderung, die Familie der Haarmenschen, das Porträt
des riesigen Ambraser Schweins, das einzige zeitgenössische Porträt von
Graf Dracula oder der Ambraser Fangstuhl mit den Trinkbüchern sowie den
beiden Trinkgefäßen des Ambraser Willkomm.

Teller, Urbino, Anfang 17. Jh.
Der Majolika-Teller aus dem frühen 17. Jh. zeigt das Urteil des Paris
nach einem Stich des an Raffael orientierten Marcantonio Raimondi.
Aufgrund eines vergleichbaren Objektes in Braunschweig wird dieser
Teller der Werkstatt des Fayenciers Francesco Patanazzi aus Urbino
zugeschrieben.

FANGSTUHL, DEUTSCH, 2. HÄLFTE 16. JH., EISEN
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, KUNSTKAMMER
Der aus Eisen gefertigte Stuhl ist an der Rückseite in
Eisenschnitttechnik mit floral-grotesker Ornamentik und Jagdmotiven
dekoriert. Er ist durch Scharniere an der Vorder- und Rückseite
zusammenklappbar und wurde im siebten Kasten der Kunstkammer Erzherzog
Ferdinands II. aufbewahrt, wie ein Eintrag im Nachlassinventar von 1596
belegt. Ob er tatsächlich auch bei den Trinkspielen in der Ambraser
Bacchusgrotte verwendet wurde lässt sich nicht eindeutig belegen, ist
aber wahrscheinlich: Wer sich auf den Stuhl setzte, wurde durch einen
verborgenen Mechanismus von zwei Greifarmen festgehalten. Der Gast
wurde erst wieder befreit, nachdem er eine Trinkprobe bestanden hatte.

PEDRO GONZALEZ - DER HAARMENSCH, DEUTSCH, UM 1580, ÖL AUF LEINWAND
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Die außergewöhnlich starke Körperbehaarung des Pedro Gonzalez wird als
Hypertrichosis Universalis Congenita und seit 1993 als „Ambras Syndrom"
bezeichnet. 1537 auf Teneriffa geboren, kam Gonzalez in jungen Jahren
an den Hof König Heinrichs II. von Frankreich, wo er eine gute
Erziehung genoss. 1559 gelangte er in die Niederlande an den Hof
Margarethes von Österreich, die ihn und seine Familie 1583 nach Parma
mitnahm. In der Ambraser Kunst- und Wunderkammer befinden sich drei
Bilder von Haarmenschen, Vater, Sohn und Tochter. Die Bildnisse
entstanden um 1580 in München und waren wohl Geschenke der dortigen
Herzöge an Erzherzog Ferdinand II.

Quilin, China, 18. Jh.
Auf einem am Hinterkopf gehörnten Tier reitet eine aus hellerem
Speckstein gefertigte männliche Figur. Bei dem Tier handelt es sich um
Quilin (Ch'i-lin), ein friedliches, glückverheißendes Fabelwesen. Sein
Erscheinen galt als Anzeichen für die Ankunft eines weisen Herrschers.
In der chinesischen Mythologie ist es außerdem Diener des gerechten
Richters Gao Yao.

Spielbrett mit Schachfiguren, Deutsch, Mitte 16. Jh.
Aus der Anzahl der ursprünglich 64 Figuren ergibt sich, dass von der
Schmalseite des 15 x 8 Felder großen Brettes aus gespielt wurde. Jede
Farbe besteht aus „König", „Dame", 2 „Springern", 2 „Türmen", 2
„Läufern", 2 „Rittern", 2 „Türken", 2 „Bärtigen", 2 „Wappenträgern",
„Bauern" und „Offizieren". Auf den Außenseiten sieht man Justitia und
Venus, Symbole für Kalkül und Kampfeslust.

HERINGSHAI, FUCHSHAI, KUGELFISCH, ECHSEN, KROKODIL - TIERPRÄPARATE
SCHLOSS AMBRAS, INNSBRUCK UND DAUERLEIHGABEN DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS WIEN
Exotische Tiere waren ein wichtiger Bestandteil in Kunst- und
Wunderkammern. Die naturkundlichen Raritäten wurden ausgestopft oder
als Tiergemälde gezeigt. Im Ambraser Inventar von 1596 sind sieben
ausgestopfte Krokodile verzeichnet. Die Originale waren mit Holzwolle
und Stroh nur ungenügend präparierten und sind daher nicht mehr
erhalten. Die hier gezeigten Präparate Heringshai (Lamna nasus)
Fuchshai (Alopias vulpinus), Kugelfisch und die Echsen stammen aus dem
19. Jahrhundert, das Krokodil aus dem 20. Jahrhundert.

ERZHERZOG FERDINAND II., FRANCESCO TERZIO, NACH 1557, ÖL AUF LEINWAND
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) war der zweite Sohn Kaiser
Ferdinands I. Nachdem er 1564 Landesfürst von Tirol wurde, errichtete
er für seine Sammlungen eigens das Unterschloss mit der weithin
berühmten Kunst- und Wunderkammer; die heute einzige am ursprünglichen
Ort erhaltene Kunstkammer der Renaissance. Dort brachte er Bücher,
Gemälde, Kunstwerke, „Wunder der Natur", Exotika aber auch
wissenschaftliche Messinstrumente, Musikinstrumente und Tierpräparate
unter. Das Porträt entstand 1557, dem Jahr seiner geheimen
Eheschließung mit Philippine Welser auf Schloss Bresnitz in Böhmen. Der
Erzherzog trägt die spanische Tracht und auf der Brust die Kette des
Ordens vom Goldenen Vlies.

Ein wesentliches Merkmal der Renaissance ist die Beschäftigung mit der
Antike - der Geschichte, Literatur und Kunst der Griechen und Römer.
Das Antiquarium war dabei ein
Rückzugsort, um bewusst den Studien der Antike nachzugehen und auch, um
relevante Objekte zu präsentieren. Im Ambraser Antiquarium von
Erzherzog Ferdinand II. ging es jedoch nicht primär um den Besitz
originaler Kunstwerke aus der Antike, sondern um die dargestellten
Sujets, wofür Ferdinand Kopien und Abgüsse anfertigen ließ.
In den 85 Nischen ist seine Sammlung von Gips-, Ton- und Marmorköpfen
berühmter Persönlichkeiten der Antike und der Mythologie ausgestellt.
Die 20 Bronzebüsten römischer Imperatoren waren ursprünglich für das
Grabmal Kaiser Maximilians I. gedacht und kamen erst 1695 hierher.

Von den ursprünglich 34 für das Grabmal Maximilians I. geplanten
Imperatorenbüsten aus Bronze sind 20 in Schloss Ambras erhalten
geblieben. Ihre Vorbilder findet man in den Herrscherbildnissen antiker
Münzen. Kaiser Maximilian I. leitete seine Herkunft von den antiken
Imperatoren ab und legitimierte dadurch seine eigene Herrschaft. Sein
Enkel und Testamentsvollstrecker Ferdinand I. verzichtete darauf, die
Büsten in der Innsbrucker Hofkirche aufzustellen. So befanden sie sich
zur Zeit Erzherzog Ferdinands II. zunächst in Schloss Ruhelust, bis sie
1695 ins Antiquarium von Schloss Ambras gelangten.

VISIERUNG ZUM KENOΤΑΡΗ KAISER MAXIMILIANS I., FLORIAN ABEL, 1561 (?)
TEMPERA AUF PAPIER, AUF LEINWAND KASCHIERT KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, KUNSTKAMMER, (SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK)
Der Kenotaph (griech. „leeres Grab") Kaiser Maximilians I. zählt zu den
bedeutendsten Renaissancedenkmälern Europas. Maximilians Enkel
Ferdinand I. ließ ab 1553 die Innsbrucker Hofkirche als Aufstellungsort
errichten und fügte in das ursprüngliche Konzept eine prunkvolle, mit
Marmorreliefs geschmückte Tumba (Hochgrab) ein. Wichtige Szenen aus dem
Leben des Kaisers sollten darauf dargestellt werden. Die Vorzeichnungen
in Originalgröße dafür schuf der Prager Hofmaler Florian Abel. Diese
Visierung auf Papier ist eine grafische Rarität des 16. Jahrhunderts.
Sie war ursprünglich in der Bibliothek Erzherzog Ferdinands II.
verwahrt, und hat sich bis heute erhalten.

In den 1560er Jahren baute Ferdinand die mittelalterliche Burg zu einem
prächtigen Renaissanceschloss um und schenkte es seiner geheimen Frau,
Philippine. Das Hochschloss war ihr Bereich: Hier badete sie, hier
pflegte sie ihr Arznei- und Kräutergärtlein, hier fanden Feste statt!
Das später erbaute Unterschloss war Ferdinand vorbehalten. Es besteht
aus mehreren Gebäudeteilen. Hier richtete er seine berühmte Kunst- und
Wunderkammer, die Rüstkammern und seine Bibliothek ein: Bibliotheca et
Musaeum.
MODELL VON SCHLOSS AMBRAS, INNSBRUCK, 1858, GIPS
Erzherzog Karl Ludwig, jüngerer Bruder Kaiser Franz Josephs I., ließ
Schloss Ambras von 1855 bis 1858 zu seiner Sommerresidenz umbauen. Die
Architekten Ludwig und Heinrich Förster verwendeten dem Zeitgeschmack
entsprechende neugotische Gestaltungselemente, die das Gipsmodell
anschaulich dokumentiert: Der Spanische Saal erhielt eine neue
Westfassade in Form eines Stufengiebels; der Bergfried des
Hochschlosses wurde um eine vierte Etage aufgestockt und mit einem
schlanken Türmchen bekrönt; der Südfassade ein bis zum zweiten
Obergeschoß reichender Treppenturm und Balkone hinzugefügt. Das
Vorschloss, in dem sich ursprünglich der Speisesaal befand, wurde zu
einem von Zinnen bewehrten „Terrassenstöckl". Die größte Veränderung im
Schlosspark war die neue, breit angelegte Auffahrtsrampe vom
Unterschloss zum Hochschloss.

Der Zugang zum Spanischer Saal erfolgt über das östlich davon gelegene Kaiserzimmer,
dessen Stuckarbeiten zur ursprünglichen Gestaltung gehören. Sie stellen
die ersten zwölf römischen Imperatoren – von Cäsar bis Domitian – dar.
Die malerische Gestaltung ist in das Jahr 1719 zu datieren und setzt
die Thematik des Spanischen Saales fort. Sie zeigt zehn Porträts der
Nachfolger von Ferdinand II. als Landesfürsten von Tirol, beginnend bei
Kaiser Rudolf II. und endend bei Kaiser Karl VI.
Kaiserzimmer: KAISER RUDOLPH. 1576-1612, KAISER MATHIAS. 1612-1619.
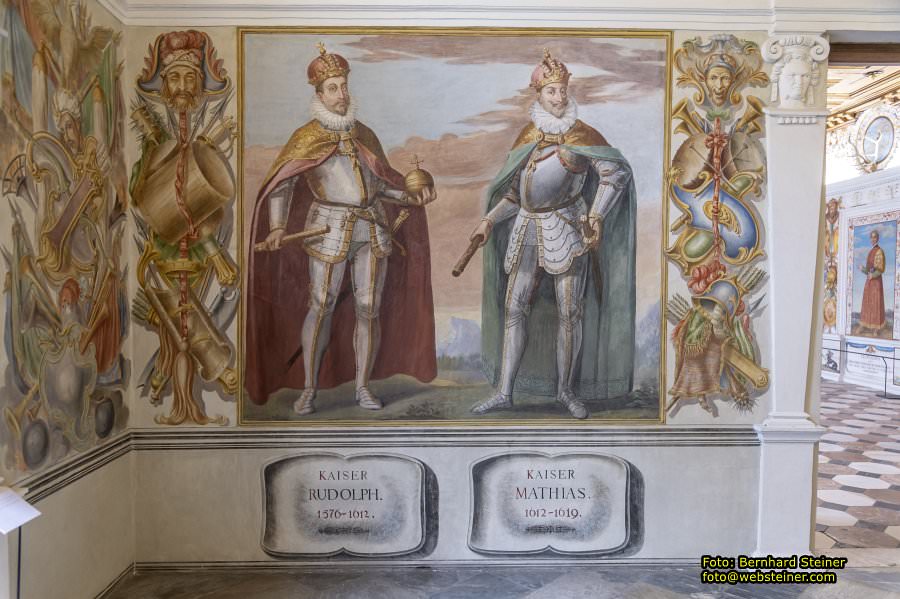
Kaiserzimmer: KAISER LEOPOLD I. 1057-1705, KAISER JOSEF I. 1705-1711, KAISER CARL VI. 1711-1740
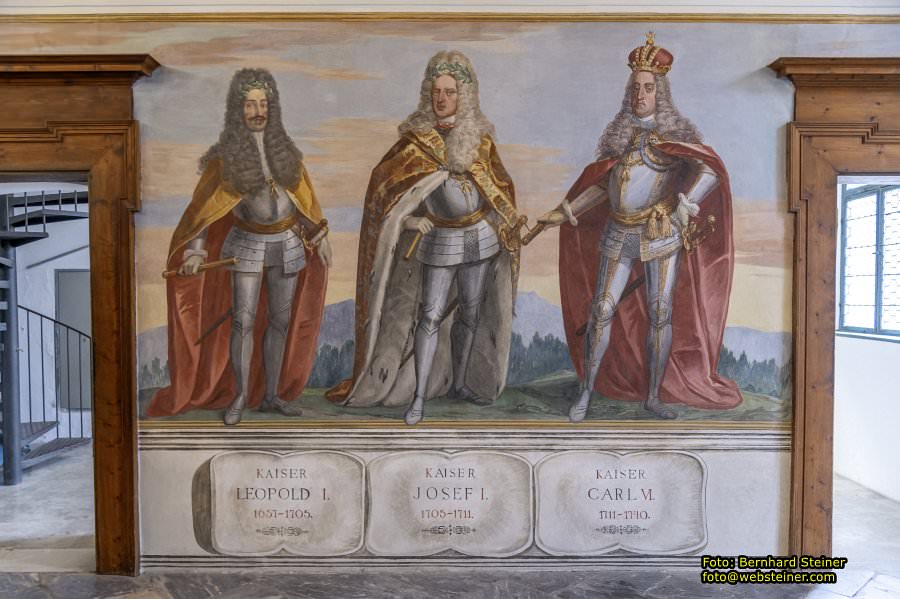
Der Spanische Saal wurde als
Repräsentationsraum errichtet und zählt zu den bedeutendsten
freistehenden Saalbauten der Renaissance. Die Fresken an den Sockeln
und über den Fenstern sind von der römischen Antike beeinflusst. Sie
zeigen die Taten eines der größten antiken Helden: Herkules. Unter den
Fenstern sind Darstellungen aus der Lebensgeschichte von Romulus und
Remus zu sehen. Die Fensternischen sind mit Groteskmalereien dekoriert,
welche zu wesentlichen Stilelementen der Renaissance wurden. Die
gemalten Trophäen an den Pfeilern erinnern an die bei römischen
Triumphzügen mitgeführten erbeuteten Waffen. Die Wandfelder zeigen 27
ganzfigurige Porträts der Grafen von Tirol bis hin zu Erzherzog
Ferdinand II. Dieser ist als selbstbewusster Renaissancefürst in der
Rolle des Herkules abgebildet.

Der Repräsentationssaal Spanischer Saal
zählt zu den schönsten freistehenden Saalbauten der Renaissance. Er
wurde 1569–1572 nach den Vorstellungen Erzherzog Ferdinand II.
errichtet. Ursprünglich als „Großer Saal“ bezeichnet, ist seit dem 19.
Jahrhundert der Name Spanische Saal geläufig. Bestimmend für den
festlichen Gesamteindruck des Saales sind vor allem die von Conrad
Gottlieb, dem Hoftischler Ferdinands, aus verschiedenen Holzarten
zusammengesetzten Türen und die zum Teil vergoldete und ebenfalls
intarsierte Holzkassettendecke.

INTARSIENTÜR, CONRAD GOTTLIEB, 1572
EICHE, BIRNE, ERLE, NUSS, LINDE, WEIDE, ROSENHOLZ - SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Die gesamten Holzarbeiten des Spanischen Saals waren dem
Erzherzoglichen Hoftischler Conrad Gottlieb übertragen worden, so auch
die prunkvolle Decke. Sein Monogramm »CG« ist an der westlichen Saaltür
in die Intarsien eingelassen. Ansonsten zeigen diese vor allem
Grotesken und Trophäen.

Die malerische Gestaltung des 43 m langen Saales wird von den 27
ganzfigurigen Porträts der in Tiroler Landesfürsten bestimmt und reicht
von Graf Albrecht I. von Tirol über die Grafen von Görz-Tirol und
Margarethe Maultasch bis zu den Habsburgern, um mit Erzherzog Ferdinand
II. zu enden. Diese Gemälde von Giovanni Battista Fontana wurden im
Zuge einer ersten umfassende Restaurierung in den Jahren 1878–1880, die
aufgrund großer Feuchtigkeitsschäden nötig geworden waren,
rekonstruiert, wobei auf die Vorlagen von Kupferstichen von Dominicus
Custos zurückgegriffen wurde, die von den Originalen im 16. Jahrhundert
angefertigt worden waren. Die Porträts stehen vor einem
Landschaftshintergrund, wodurch der Saal nach beiden Seiten geöffnet
scheint. An den Sockeln der Ost- und Westwand sind die Tugenden und
freie Künste dargestellt, an den Sockeln der Südwand Szenen aus der
Geschichte von Romulus und Remus und an der Nordwand der
Herkulesmythos, wobei dieser erst im 19. Jahrhundert ergänzt wurde. Von
der Groteskenmalerei auf der Fensterseite hingegen konnte der
Originalzustand des 16. Jahrhunderts restauriert werden.

Architektonisches Herzstück des Hochschlosses ist der Innenhof,
der zwischen 1564 und 1567 mit typischen Themen der Renaissance
gestaltet wurde. Seine Freskomalerei in Grisailletechnik (franz., gris
= grau) zählt zu den am größten und besten erhaltenen ihrer Art.
Rundum zieht sich ein Bacchuszug mit Wagen, Satyrn und Bacchanten. In
einer Szene musiziert Orpheus vor den Tieren. Allegorien der Freien
Künste Musik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie, Grammatik, Dialektik
und Rhetorik, aber auch Musen, Schlachtenszenen und Ritter in
fantastischen Rüstun-gen schmücken die Wände. Gezeigt werden
alttestamentarische Heldinnen wie Judith, Esther und Jael oder Judith
mit dem Haupt des Holofernes. Die Tugenden Fides (Glaube), Spes
(Hoffnung), Caritas (Nächstenliebe), Justitia (Gerechtigkeit),
Prudentia (Klugheit), Fortitudo (Standhaftigkeit), Temperantia
(Mäßigkeit) und Sapientia (Weisheit) sind genauso dargestellt wie die
„neuen Helden" Alexander der Große, Gottfried von Bouillon, David,
Artus, Karl der Große, Judas Makkabäus, Josua, Hector und Caesar.

Erzherzog Franz Ferdinand (1863-1914) war der letzte Habsburger, der in
Schloss Ambras seine Spuren hinterlassen hat. 1913 erhielt er von
Kaiser Franz Joseph I. beträchtliche Geldmittel und die Genehmigung,
einen großen Umbau des Schlosses „nach seinem Gutdünken" durchzuführen.
Neben der baulichen Wiederherstellung des Hochschlosses in das
ursprüngliche Erscheinungsbild der Renaissance plante der Erzherzog
auch einen elektrischen Aufzug. Auf Grundrissplänen von 1913 ist dieser
Aufzug eingezeichnet. Als 1914 Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo
ermordet wurde und der erste Weltkrieg ausbrach, kamen die Bauarbeiten
in Schloss Ambras zum Stillstand. 1920 wurden der bereits errichtete
Liftschacht sowie Mauer- und Deckendurchbrüche wieder geschlossen.
2024 wurde der Lift schließlich an exakt jener Stelle errichtet, die
bereits vor 111 Jahren für den elektrischen Aufzug Franz Ferdinands
vorgesehen war. Er erschließt alle drei Stockwerke des Hochschlosses.
Im Erdgeschoß gewährt eine Glastüre im Inneren des Lifts einen Blick in
den ehemaligen Heizraum für das Bad der Philippine Welser.

Das Bad der Philippine Welser,
Schlossherrin von Schloss Ambras und erste Gemahlin Erzherzog
Ferdinands II., stellt eine kulturgeschichtliche Rarität dar. Es
handelt sich mit Wanne, Schwitz- und Heizraum sowie dem Ruheraum um die
einzig noch vollständig erhaltene Badeanlage des 16. Jahrhunderts. Der
Umkleideraum, die sogenannte „Abziehstube“, weist eine reiche hölzerne
Kassettendecke auf, die Wände haben bis auf eine Höhe von ca. 1,60
Metern eine Holzvertäfelung, datiert mit der Jahreszahl 1567. Oberhalb
der Wandtäfelung befindet sich ein umlaufender Fries in Freskomalerei,
der zwischen 1563 und 1567 vermutlich von Hanns Polhammer geschaffen
wurde. Die eher schlecht erhaltenen Fresken zeigen Szenen einer
Festgesellschaft in einer Laube, eine Jungbrunnendarstellung oder das
Motiv Diana im Bade.
Die „Abziehstube" wurde 1567 mit Holz vertäfelt und darüber mit einem
umlaufenden Fries in Freskomalerei geschmückt. Als Vorlagen dienten
Badedarstellungen von Albrecht Dürer, Virgil Solis, Hans Sebald Beham
und Georg Pencz aus der Sammlung von rund 5.000 Kupferstichen und
Holzschnitten, die Erzherzog Ferdinand II. besaß.
Fresko links vom Fenster: Die Tischlaube von Virgil Solis wurde zu einem runden Tisch verändert. Möglicherweise sollte sie damit
der Rotunde angeglichen werden, jenem Tisch im Garten, welcher samt
seinen Gästen mit Wasserkraft in schnellere oder langsamere Drehungen
versetzt werden konnte. Die Darstellung ist ein Hinweis darauf, dass
das Baden stets mit Geselligkeit, Essen und Trinken verbunden war.

Bad der Philippine Welser - Das Wannenbad:
Die Badewanne ist etwa 1,60 Meter tief in den Boden eingelassen und mit
verzinntem Kupferblech verkleidet. Die Badenden saßen nicht auf dem
Wannenboden, weil dort heiße Steine für die Wassererwärmung lagen; sie
benutzten vielmehr Schemel oder Bänke. Der steinerne Hocker mit
hölzerner Sitzfläche gehört zum ursprünglichen Bestand. Zum
Zurücklehnen war ein „hülzerns Haubtküssen" vorhanden. Die Wandtäfelung
ist original aus dem 16. Jahrhundert. Der Fußboden hingegen wurde im
19. Jahrhundert mit vorhandenen Holzresten erneuert. Die Holzdielen
fallen zur Raummitte hin ab und weisen Rillen auf, durch die das
Spritzwasser abfließen konnte. Eine Wasserleitung transportierte das
heiße Wasser aus dem Heizraum in die Wanne, während das kalte direkt
über eine Rohrleitung aus dem Keuchengarten heraufgeführt wurde.
Inventare und erhalten gebliebene Rechnungen geben uns ein gutes Bild
von der ursprünglichen Ausstattung: Aus zwei Hähnen mit Löwenköpfen
lief das kalte und warme Wasser in die Wanne. Auf der marmornen Ablage
vor dem Badfenster stand ein Springbrunnen, der mit bemalten
Tierfiguren dekoriert war. Außerdem gab es hier mehrere Schaffe aus
Kupfer sowie Becken aus Messing, „Lassköpfe" (= Saugnäpfe) samt einem
Fass für den Aderlass, ferner ein Laugenfass mit Sieb und Kellen aus
Messing. Hier ließen die Badenden sich das Haar waschen, die Rasur
vornehmen und sich schröpfen. Die dabei verwendeten Utensilien wie
Kämme und Kosmetika wurden nicht im Bad verwahrt, sondern vom Barbier
oder aus den Wohnräumen mitgebracht. So befand sich auch das berühmte
Toilettekästchen der Philippine Welser in ihren persönlichen Gemächern
des zweiten Stockwerks (heute: Kunsthistorisches Museum Wien).

Die wechselhafte Geschichte der St.-Nikolaus-Kapelle reicht bis ins 14.
Jahrhundert zurück. Ihr heutiges Erscheinungsbild geht auf das 19.
Jahrhundert zurück, als der Statthalter von Tirol, Erzherzog Karl
Ludwig, die schadhaften Wandmalereien des 16. Jahrhunderts abschlagen
ließ und eine allgemeine Neugestaltung bei August von Wörndle in
Auftrag gab. Mit ihrer künstlerisch gelungenen Gestaltung von 1862
stellt die Kapelle im Schloss ein wichtiges Bindeglied vom Mittelalter
über die Renaissance bis zur jüngeren Vergangenheit dar. In der Kapelle
ist heute ihr bedeutender Kapellschatz ausgestellt.
DIE ST. NIKOLAUSKAPELLE
1867, WANDMALEREI: AUGUST VON WÖRNDLE, ALTAR UND KIRCHENGESTÜHL: MICHAEL STOLZ
Die Geschichte der St. Nikolauskapelle von Schloss Ambras reicht bis
ins 14. Jahrhundert zurück. Nach ihrer ersten Weihe im Jahr 1330
folgten zahlreiche Umbauten. Das heutige Erscheinungsbild der Kapelle
geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als der Statthalter von Tirol,
Erzherzog Karl Ludwig (1832-1896), Schloss Ambras für seine Zwecke
adaptieren ließ.

Im Jahr 1864 erhielt Maler August Wörndle den Auftrag, die Kapelle „al
secco" auszumalen. Die 1867 fertiggestellten Malereien zeigen unterhalb
der Langhausfenster an der Nordwand die Geburt Christi, Christus
lehrend und die Kreuzigung, an der Südwand Auferstehung, Himmelfahrt
und Sendung des Heiligen Geistes. Im Chorbogen in einer spitzgiebeligen
gemalten Nische sind der Heilige Josef und die Unbefleckte Empfängnis
dargestellt. An der Brüstung der Oratoriumsfenster zeigt das mittlere
von jeweils drei Feldern Christus als Sämann bzw. als guten Hirten. Die
Glasfenster wurden von den Brüdern Neuhauser aus der Innsbrucker
Glasmalereischule 1863 nach Entwürfen August Wörndles angefertigt.

Ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammen die Kirchenbänke und der
neugotische Altar mit der Statue des Heiligen Nikolaus in einer
Baldachinnische vom Bildhauer Michael Stolz. An der Stirnseite der
Predella sind die Figuren der Heiligen Rudolf, Franziskus, Joseph,
Elisabeth und Gisela in Blendarkaden eingestellt. Mit ihrer
neugotischen Ausstattung stellt die Kapelle ein wichtiges Bindeglied
zwischen Vergangenheit und Gegenwart dar.

Paradies- und Arzneimittelgarten
Der Weg vom Spanischen Saal über eine Wendeltreppe zum Hochschloss
hinauf führt an einem nach Osten ausgerichteten Gärtchen für
Arzneimittelkräuter vorbei. Seit dem Mittelalter war es, vor allem in
Klöstern, üblich, Pflanzen zu medizinischen Zwecken anzubauen.
Erzherzog Ferdinand II. hatte ein besonderes Interesse an der Medizin,
was durch seine beachtliche Sammlung klassischer und zeitgenössischer
medizinischer Literatur in der Ambraser Bibliothek dokumentiert ist.
Die Grundlage für die heutige Auswahl der Heilpflanzen bildet das in
der Ambraser Sammlung erhaltene Arzneimittelbuch der Philippine Welser
von 1560/1570. Anna Welser, die Mutter von Philippine, der
Schlossherrin von Ambras und Erzherzog Ferdinands erster Gemahlin,
hatte es für ihre Tochter anfertigen lassen.

Die Glassammlung Strasser ist eine der bedeutendsten Glassammlungen
weltweit. Kostbare Gläser aus den wichtigsten europäischen
Glaserzeugungsgebieten bieten einen Einblick in die Geschichte der
Glaskunst von der Renaissance bis zum Barock.
DIE GLASSAMMLUNG STRASSER
Die Sammlung Strasser ist eine der weltweit bedeutendsten
Glassammlungen. Sie wurde in mehr als 50-jähriger Sammeltätigkeit von
Prof. Rudolf Strasser angelegt und umfasst insgesamt über 300 kostbare
Gläser von der Renaissance bis zum Klassizismus aus den wichtigsten
europäischen Glaserzeugungsgebieten. 1919 als Rudolf Strasser von
Györvár in Pressburg (Bratislava) geboren und im elterlichen
Barockschloss Majorháza aufgewachsen, waren es „lachende"
Biedermeiergläser, wie der Sammler sie gerne bezeichnet, die zu Hause
durch Licht und Farbe seine Aufmerksamkeit fingen.
Nach bewegten Jahren im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und in
politischer Haft wirkte Strasser als Mitarbeiter des späteren
Bundeskanzlers Julius Raab im Wiederaufbau Österreichs. 1954 verlegte
er seinen Wohnsitz in die USA. Als Korrespondent österreichischer
Medien und Banker an der Wall Street kam der Liebhaber von Literatur,
Geschichte, Porzellan und Glas in Berührung mit vielen namhaften
Sammlern und Kunsthändlern, die von Europa in die Neue Welt
ausgewandert waren. Seine eigene Sammeltätigkeit begann Rudolf Strasser
in diesem aufregenden New York der späten 1950er Jahre. Eine enge
Zusammenarbeit mit dem Corning Museum of Glass im Staat New York
brachte Impulse zu Studien und Publikationen.
Das besondere Interesse der Sammlung lag bald auf der historischen
Aussage der Gläser. Gerade Erzherzog Ferdinand II., Herr von Ambras und
Gründer der musealen Sammlung dieses Schlosses, prägte mit seiner
Vorliebe für die Glaskunst und den menschlichen Dimensionen seiner
Sammellust das Kunstverständnis Strassers. Der Glasschnitt des Barock
und die Eigenart des böhmischen Hausmalers Ignaz Preissler, aber auch
die Anmut diamantpunktierter Gläser der Niederlande des späten 18.
Jahrhunderts gehören zu seinen favorisierten Bereichen der
Glasveredelung. Nach Österreich zurückgekehrt, kam die Sammlung
Strasser 2004 in den Besitz des Kunsthistorischen Museums Wien, 2013
wurden siebzig Objekte der Wiener Kunstkammer zugeordnet. Der weitaus
größere Anteil der Gläser fand im gleichen Jahr seine endgültige Heimat
in Schloss Ambras.

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - FARBGLÄSER UND EMAILMALEREI
Die Ähnlichkeit der farblosen Gläser mit dem Bergkristall war eine
Attraktion, doch auch das Leuchten farbiger Gläser wurde bereits in der
Antike geschätzt. Die Herstellung von Farbglas durch Beimischung von
Metalloxiden wurde in venezianischen Hütten des 15. Jahrhunderts
perfektioniert und in der Folge auch im Norden aufgenommen. Der Reiz
der Farbigkeit erhielt durch die Kaltmalerei und besonders durch die
Entwicklung der Emailmalerei weitere Ausdrucksmöglichkeiten. Gerade
nördlich der Alpen kam die Technik zu ihrer charakteristischen Blüte.
Narrative weltlich-politische oder religiöse Bildthemen, heraldische
Motive oder Ornamente, die sich an der Hafnerkunst orientierten,
schmückten einen hohen Anteil der Gläser im 16. und vor allem im 17.
Jahrhundert. Die opaken Dekore wurden zunehmend dichter und überzogen
die Gefäße oft gänzlich.
Die Emailfarbe besteht aus einem mit Metalloxiden gefärbten Glasfluss,
der zu Pulver zerrieben und zu einem Brei gerührt mit Pinseln auf die
Glasoberfläche aufgetragen und dann bei einer Temperatur von ungefähr
600 Grad Celsius eingebrannt wird. Bei diesem Prozess verschmilzt die
Emailfarbe mit der Glasoberfläche. Für die Bemalung mit Emailfarben
sind unkomplizierte Formen am besten geeignet. So sind es vor allem die
zylindrischen Humpen, die im 17. Jahrhundert reich bemalt und mit
Trinksprüchen beschriftet werden. Diese Humpen illustrieren die rauen
Trinksitten des Nordens, wobei nach Ausruf eines Trinkspruchs eine oft
zur Bewusstlosigkeit führende Menge geschluckt werden musste.
Vanitasbecher (Lautenspieler, Tod und Mädchen)
NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, DATIERT 1598 //ENTFÄRBTES GLAS, DIAMANTGRAVUR //H. 14.9 CM. D. 10,5 CM
Flügelkaraffine mit Doppeladler
NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, UM 1690 //ENTFÄRBTES UND BLAUES GLAS, DIAMANTGRAVUR //H. 14 CM
Krug mit Blattranken
SÜDLICHE NIEDERLANDE, FAÇON DE VENISE, UM 1670 //ENTFÄRBTES UND BLAUES GLAS, DIAMANTGRAVUR//H. 13,5 CM, D. 12,3 CM

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - DIE GLASHÜTTE HALL 1534-1615
Im Jahr 1534 gründete der Augsburger Montanist Wolfgang Vitl
(1495-1540) die erste Glashütte Tirols in Hall bei Innsbruck. Sein Ziel
war, Gläser nach venezianischer Art zu erzeugen. Zuvor bezog das Land
deutsches und böhmisches Waldglas, aber auch das begehrte farblose Glas
aus Murano. Vitl errichtete sein Werk nahe der Schiffslände und des
Holzrechen, wo das Triftholz aus dem Oberinntal und dem Engadin
aufgefangen wurde. Wegen des extremen Holzbedarfs durfte nur ein
Schmelzofen unterhalten werden. Trotz seiner Beziehungen zu
süddeutschen und Haller Patrizierfamilien und der erfolgreichen
Herstellung von Scheibenglas starb Vitl hochverschuldet.
Sebastian Höchstetter, aus einer geadelten Augsburger Handels- und
Gelehrten-familie und ein Gläubiger Vitls, übernahm die Glashütte und
führte sie durch den Export von Scheibenglas und farblosen Trinkgläsern
zu beachtlicher Blüte. Sein Bruder, der Tiroler Regierungsrat
Chrysostomus Höchstetter, setzte die Produktion ab 1569 mit
Unterstützung des Hauses Habsburg fort, das über die Höchstetter auch
Darlehen erhielt. Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) bezog bereits als
Statthalter in Prag Gläser aus Hall, die von der Formentradition
deutscher Glashütten geprägt waren. Ab 1599 verpachtete der Erbe
Hieronymus Höchstetter die Hütte an Paul Kripp, der 1615 ihr Ende
besiegelte. Glas aus Böhmen, Schlesien und Sachsen dominierte
inzwischen den Markt. Nach einer wechselvollen Geschichte musste 2011
die Umfassungsmauer der Hüttenanlage einem Wohnbau weichen. Kurz zuvor
hatten archäologische Grabungen Scherben und Gefäßfragmente, Reste von
Rohstoffen und Werkzeugteile zu Tage gebracht. Die Funde geben
wertvolle Einblicke in die technischen Möglichkeiten der Glashütte, die
einst als „zier des landes" galt.
DIE KUNST DES GLASSCHNITTS
Ein von Christoph Weigel in Nürnberg um 1700 herausgegebenes Büchlein zu den Ständen enthält die kommentierte Illustration: Der Glasschneider /Unbedachtsams Wagen bringt für Nützen Klagen
und beschreibt damit auch die Herausforderung des Glasschnitts. Man
benötigte Glas, das mit genügend Härte und Wandungsstärke dem Einwirken
des Glasschneiders standhalten konnte. Zum ersten Mal in der
Glasgeschichte war nicht Venedig der Vorreiter einer
Veredelungstechnik, die in der Lagunenstadt erst im 18. Jahrhundert
unter der Bezeichnung „à la façon de Bohème“, nach ihrem böhmischen
Ursprung benannt, zur Anwendung kam.
Als ideales Medium des Glasschnitts eignete sich Kreideglas, wie es
1683 von Michael Müller in Südböhmen entwickelt wurde. Als Werkzeug
dienten verschieden große Kupferscheiben, die über eine mit dem Fuß
betriebene Welle zum Rotieren gebracht wurden. Auf dem Rand der
Kupferscheiben wird ein „Schmirgel" oder „Trippel" aus Glaspulver mit
Ölzusatz aufgetragen, wodurch das weiche Kupfer die nötige Schneidkraft
erhält. Gleichzeitig verdeckt der Schmirgel den entstehenden Schnitt
vor dem Glasschneider, der die erwünschte Feinheit seiner Arbeit nur
durch erfahrenes Gefühl für seine Materialien zustande bringen kann.
Zunächst waren es einfache Blumenmotive oder figürliche Darstellungen,
die im Laufe des 17. und vor allem in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts zu aufwendigen und malerischen Kompositionen anwuchsen.
Die Nürnberger Glasschneider hatten bereits zur Mitte des 17.
Jahrhunderts die lebendige Kombination aus matten und polierten
(geblänkten) Details des Glasschnitts erreicht, der in Böhmen und
Schlesien um 1730 zur Vollendung gebracht wurde.
Becher mit erotischer Jagdsymbolik
NORDBÖHMEN, UM 1680 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNΙΤΤΕΝΗ H. 11.3 CM. D. 9.5 CM
Becher mit St. Veitsdom in Prag und erzbischöflichem Wappen
NORDBÖHMEN, VOR 1692 // ENTFARBTES GLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN // H.
12 CM. D. 10 CM // WAPPEN DES ERZBISCHOFS JOHANN FRIEDRICH WALDSTEIN
(1642-1694)
Pokal mit Waldstein-Wappen und Fortuna
NORDBÖHMEN, RIESENGEBIRGE, DATIERT 1685//ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNITTEN,
TEILS POLIERT //H. 26,8 CM. D. 8,7 CM //INITIALEN „B.W.", „G.W." FÜR
BERTHOLD WALDSTEIN
Deckelpokal mit Fritillaria und Insekt
SCHLESIEN, UM 1720 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 33 CM, D. 10,5 CM
Deckelpokal mit Jagd- und Fischerei-Szenen
NORDBÖHMEN, UM 1720 //ENTFÄRBTES GLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 35,8 CM. D. 12,6 CM
Deckelpokal mit farbigen Glassteinen
NORDBÖHMEN, ISERGEBIRGE, UM 1700 //ENTFÄRBTES, GRÜNES, ROTES UND BLAUES GLAS. GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN //H. 26,5 CM, D. 8 CM

DIE GLASSAMMLUNG STRASSER - DIAMANT UND GLAS
Zu den frühesten Dekoren des venezianischen Glases gehört der
Diamantriss, auch Diamantgravur genannt. Ein Stift mit Diamantspitze
wird dabei über die kalte Oberfläche des Glases gezogen und graviert
Ornamente oder Beschriftungen ein. In Venedig wurden seit dem 13.
Jahrhundert zahlreiche Verordnungen erlassen, um die Herstellung von
Glas, das bald zu einem sehr bedeutenden Luxusexportartikel werden
sollte, streng zu regeln. Die Gestaltung der frühen venezianischen
Gläser war stark von byzantinischen Vorbildern mit ihren
aufgeschmolzenen oder in Email gemalten Dekoren beeinflusst, jenen
Gläsern, mit denen Venedig seit Jahrhunderten Handel betrieb. Zu den
eigenständigen Erfindungen Venedigs gehören das Farbglas und die Faden-
und Netzgläser („vetro a fili" und „vetro a ritorti"). Auch der
Diamantriss, der wie viele Techniken der Glasverdedelung bereits in der
Antike bekannt war, kam in Venedig zu eigener Ausprägung.
Die Signoria gewährte 1549 dem Glasmacher Vincenzo di Angelo dal Gallo
ein Privileg zur Ausübung des Diamantrisses, wobei überliefert ist,
dass diese Technik bereits um 1540 eingeführt war. Als eine der
delikatesten Veredelungstechniken respektierte der Diamantriss die
angestrebte Transparenz des Glases. Die Ausführung erforderte eine
geübte Hand, da nachträgliche Korrekturen nicht möglich waren. Doch
nicht nur die Technik an sich wurde von Venedig aus durch Europa
verbreitet, auch die floralen und geometrischen Ornamentmotive finden
sich vielerorts wieder, so auch in Hall und Innsbruck, und erschweren
eine definitive lokale Zuschreibung.
EIN KUNSTWERK DER ALCHEMIE: GOLDRUBINGLAS
Die tiefrote Farbpracht des Goldrubinglases wurde im 17. und 18.
Jahrhundert durch Montierungen aus Gold und Silber sowie mit Gold- und
Schnittdekoren auf kostbare Art gesteigert. Gold ist auch Bestandteil
des Glases selbst, das dem Rubin gleich scheinen sollte. Diesem
feurigen Edelstein wurden seit jeher stärkende Kräfte nachgesagt. Rot
wurde zudem mit Macht und Privileg assoziiert. In der Alchemie hoffte
man, über die Goldrubinglas-Experimente den „Stein der Weisen" zu
erlangen, jene Substanz, die unedle Metalle in Gold oder Silber
verwandeln sollte.
Gold wird in Königswasser (Salpeter- und Salzsäure) gelöst. Es entsteht
Goldchlorid, das mit einer Zinnlösung vermischt das Gold in seine
atomare Form zurückführt. Diese purpurfarbene Substanz wird der
Glasschmelze beigefügt. Zunächst bleibt das Glas farbfrei, erst durch
nochmaliges Erhitzen (Tempern) auf 600 Grad Celsius entsteht die
Rotfärbung. Die Goldteilchen werden durch die hohe Temperatur stark
beweglich und wachsen zu gleichförmigen Nanopartikeln oder auch
Goldkolloiden (6-8 Nanometer; 1 Nanometer=1 Millionstel Millimeter) an.
Diese Partikel reflektieren rotes Licht, da sie vor allem die Grün- und
Blauanteile des Lichtspektrums absorbieren. Johann Kunckel (um
1632-1703) gilt als Pionier des Goldrubins. Er stammte aus einer
hessischen Glasmacherfamilie und stand als Alchemist im Dienst des
Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688).
Überfangener Rubinglasflakon mit Weinlaubdekor
DRESDEN, UM 1720/ GOLDRURINGLAS MIT FARBLOSEM GLAS ÜBERFANGEN,
GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, VERGOLDETE SILBERMONTIERUNG / H. 12,2 CM
Sechs Likörgläschen mit Früchtefestons
BOIMEN, UM 1700// GOLDRUBINGLAS GESCHNITTEN, VERGOLDETE SILBERMONTIERUNG H. ca. 5.5 CM
Krug mit Vögeln und Früchten
BOHMEN, UM 1700//GOLDRUBINGLAS, GESCHNITTEN, VERGOLDETE BRONZEMONTIERUNG / H. 30 CM. D. 9 CM
Becher mit Wappen der Allgäuer Familien Ebertz und Jenisch
GRAVUR: BÖHMEN ODER NÜRNBERG 1707 DATIERT // GLAS: BÖHMEN, UM 1700//
GOLDRURINGLAS, GESCHLIFFEN, GESCHNITTEN, TEILS POLIERT //H. 10 CM. D. 9
CM

ERZHERZOG FERDINANDS II. POSTREISE NACH BRÜSSEL
NIEDERLÄNDISCH, 2. HÄLFTE 16. JH., ÖL AUF LEINWAND
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN, GEMÄLDEGALERIE
1555 reiste Erzherzog Ferdinand II. im Auftrag seines Vaters, König
Ferdinands I., nach Brüssel. Er sollte seinen Onkel Kaiser Karl V. von
der Abdankung abhalten, der mit seiner Bemühungen um eine
Vormachtstellung des Katholizismus gegenüber dem Protestantismus
politisch gescheitert war. Die Reise ist in simultan wiedergegeben:
Rechts sieht man den Zug des berittenen Gefolges bis hin zu Ferdinand
II., dessen Ankunft von Hornisten angekündigt wird. Links ist die
Begrüßung vor einem Gebäude dargestellt, in dessen Obergeschoss das
Krankenbett Karls V. zu erkennen ist. Der Hintergrund zeigt die
Stadtsilhouette von Brüssel. Das Gemälde hatte ursprünglich seinen
Platz in Ferdinands Ambraser Bibliothek.

Die Zeit um 1500 gilt als „Geburtsstunde" des modernen Postwesens.
Maximilian I. benötigte für sein zersplittertes Herrschaftsgebiet ein
funktionierendes Nachrichten- und Transportsystem. Diesem Bedarf kam
die Familie Taxis nach, deren Mitglieder bereits als Kuriere in
Diensten der Päpste und der Republik Venedig tätig waren. Aufgrund
ihrer familiären Verzweigung konnten sie ein europaweit tätiges
Unternehmen aufbauen. Ab 1550 hatte die durch Heirat entstandene
Seitenlinie der Bordogna von Taxis Firmensitze in Brixen, Bozen und
Trient. Ihre wirtschaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten führten
zu einem Naheverhältnis zum Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand
II., dem Begründer der Ambraser Sammlungen. Damit verbunden war auch
ihre aktive Teilnahme am Innsbrucker Hofleben.
Die Bordogna von Taxis sicherten sich durch ihr unternehmerisches
Geschick von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Verstaatlichung der
Post 1769 das Vertrauen der Habsburger. Ihre Leistungen wurden dabei
durch die Verleihung der Postmeisterwürde auf Lebenszeit sowie durch
die Erhebung in den Freiherrenstand honoriert. Die Postmeisterporträts der Taxis-Bordogna erzählen gemeinsam mit
Dokumenten aus dem Archiv der Taxis-Bordogna die Geschichte der
Trientner Postmeister sowie die Entwicklung des Postwesens in Tirol.

Schloss Ambras Innsbruck besitzt eine Vielzahl an historischen
Kachelöfen, die in den Räumen des Hochschlosses bewundert werden
können. In ihren unterschiedlichen Stilrichtungen vom 16. bis ins 19.
Jahrhundert dokumentieren sie anschaulich die Hafnerkunst aus jenen
Zeiten, in denen das Schloss für Wohnzwecke genutzt wurde. Ihr
aufwändiger Dekor, ihre Farbigkeit und ihr vielschichtiges Bildprogramm
machen sie zu repräsentativen Objekten.
KACHELOFEN - BOZEN, ANFANG 18. JAHRHUNDERT, ΤΟΝ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Die vierseitige Basis ruht auf vier sitzenden Löwen. An den Ecken
fungieren römische Krieger als Karyatiden, in den muschelbekrönten
Feldern dazwischen sind Reiterstandbilder dargestellt. Die Ecken des
sechseckigen Aufsatzes bestehen aus gedrehten Säulen, dazwischen sind
in violett-braunem Rahmen Kriegergestalten dargestellt. Die
durchbrochene, weißglasierte Bekrönung zeigt Engel, die leere, gekrönte
Schilde tragen, und sich mit Männerbüsten abwechseln.

Auf drei Stockwerken des Hochschlosses befindet sich die Habsburger Porträtgalerie.
Sie umfasst Gemälde aus der Zeitspanne vom 14. bis 18. Jahrhundert,
eine Zeit also, in der die Habsburger wie kaum eine andere europäische
Herrscherdynastie die Geschicke Europas mitbestimmt haben und mit den
wichtigsten Herrscherhäusern verwandt oder verschwägert waren.
Ausgestellt sind Porträts der Habsburger wie Kaiser Maximilian I.,
Kaiser Karl V., König Philipp II. von Spanien und der jungen Maria
Theresia, aber auch von Mitgliedern anderer Herrschergeschlechter etwa
Königin Elisabeth I. von England, der Wittelsbacher, Medici, Valois, u.
a. m. Der Rundgang durch die Galerie auf drei Stockwerken des
Hochschlosses gestaltet sich als eine Reise durch die europäische
Geschichte. Die Porträts spiegeln nicht nur die Heirats- und
Bündnispolitik der Herrscherhäuser wieder, sondern auch die Kunst- und
Kulturgeschichte der Epoche ihrer Entstehung. Eine spezifische
Besonderheit sind die vielen Kinderporträts, etwa das Peter Paul Rubens
zugeschriebene Bild der dreijährigen Eleonora Gonzaga. Berühmte Maler
standen im Dienst der Herrscherfamilien; so präsentiert Schloss Ambras
Meisterwerke von Hans Burgkmair, Lucas Cranach d. J., Giuseppe
Arcimboldo, Jakob Seisenegger, Hans von Aachen, Peter Paul Rubens,
Anthonis van Dyck, Diego Velázquez und anderen.
Kaiser Leopold I. - Benjamin von Block, 1672, Öl auf Leinwand
Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie
Kaiser Leopold I. (1640-1705) war der Sohn Kaiser Ferdinands III. und
der Infantin Maria Anna. Nach dem Tod seines Bruders wurde er König von
Böhmen und Ungarn und folgte 1658 seinem Vater auf den Kaiserthron.
Bestimmend für seine Politik waren der Krieg gegen Ludwig XIV. von
Frankreich und gegen das Osmanische Reich. Der Kaiser ist im Harnisch mit dem Feldherrenstab dargestellt. Der Mode
der Zeit entsprechend trägt er eine Perücke. Besonderen Wert legte der
Maler auf den mit venezianischer Reliefspitze verzierten Kargen.

Erzherzogin Claudia Felizitas - Giovanni Maria Morandi, 1666, Öl auf Leinwand
Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie
Claudia Felicitas (1653–1676), die Tochter Erzherzog Ferdinand Karls
und der Anna de' Medici, wurde 1673 mit Kaiser Leopold I. verlobt,
starb aber schon vor der Hochzeit 1676. Das Bildnis von Giovanni Maria
Morandi zeigt sie in zeitgenössischer Mode. Die Erzherzogin ist durch
den geschulterten Köcher mit Bogen und Pfeilen, den Pfeil in ihrer
Rechten und den sie begleitenden Hund als Jagdgöttin Diana
charakterisiert. Auch der Kopfschmuck in Form einer Mondsichel ist ein
typisches Attribut der Diana, die in der römischen Mythologie mit Luna,
der Mondgöttin, gleichgesetzt wurde.
KAISER LEOPOLD I. - GUIDO CAGNACCI, CA. 1657/58, ÖL AUF LEINWAND, 190 X 120 CM
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Kaiser Leopold I. (1640 - 1705) war der Sohn Kaiser Ferdinands III. und
der Infantin Maria Anna. Nach dem Tod seines älteren Bruders wurde er
König von Böhmen und Ungarn und folgte 1658 seinem Vater auf den
Kaiserthron. In erster Ehe war er mit der Infantin Margarita Teresa, in
zweiter mit Erzherzogin Claudia Felicitas und schließlich in dritter
Ehe mit Eleonore Magdalena von Pfalz-Neuburg vermählt. Die Politik
Leopolds war von Kriegen gegen die Franzosen und die Türken geprägt.
Leopold war Komponist, Musikliebhaber und Förderer der Italienischen
Oper.
ERZHERZOGIN MARIA ANNA - DIEGO VELÁZQUEZ, 1653, ÖL AUF LEINWAND, 204 X 126,5 CM
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Maria Anna (1635 1696) war die Tochter Ferdinands III. und der Infantin
Maria. 1646 verlobte sie sich mit Baltasar Carlos, dem Sohn König
Philipps IV. Da Baltasar Carlos bereits 1647 starb, heiratete sie 1649
seinen Vater. Nach dem Tod des Königs 1665 führte sie bis 1675 die
Regentschaft für ihren Sohn, der als Karl II. der letzte spanische
König aus dem Haus Habsburg war. Das Porträt von Diego Velásquez zeigt
die junge Königin in der extrem ausladenden spanischen Damenmode um die
Mit des 17. Jahrhunderts.

Kaiser Ferdinand III. war dreimal verheiratet, in erster Ehe mit
Infantin Maria Anna, einer Tochter Philipps III. von Spanien, in
zweiter Ehe mit Maria Leopoldine, einer Tochter Erzherzog Leopolds V.,
die in jungen Jahren an der Entbindung ihres ersten Kindes Erzherzog
Karl Josephs starb, und in dritter Ehe schließlich mit Eleonore
Gonzaga. Erzherzog Leopold Wilhelm setzte den jungen Erzherzog Karl
Joseph zu seinem Universalerben, mit Ausnahme der Kunstsammlung, ein.
Karl Joseph verstarb jedoch bereits 1664 fünfzehnjährig. Die älteren
Geschwister Karl Josephs waren Ferdinand IV., seit 1653 deutscher
König, jedoch bereits im Jahr darauf verstorben, und Maria Anna, die
ihrerseits mit einem spanischen König, Philipp IV. (zugleich ihrem
Onkel), verheiratet war.
Der Nachfolger Großherzog Ferdinands I. von Florenz war sein Sohn
Cosimo II. Er starb noch in jungen Jahren an Tuberkulose. Seine
Schwester Catarina, mit dem Herzog von Mantua vermählt, fungierte
später als Statthalterin von Siena. Von den Söhnen Cosimos II. wurde
der älteste, Ferdinando II. Nachfolger als Großherzog, von den jüngeren
wandte sich Giancarlo dem geistlichen Stand zu, Francesco und Mattias
schlugen eine militärische Laufbahn ein.
Das große ganzfigurige Bildnis Erzherzog Leopold Wilhelms von Teniers
d. J. zeigt ihn als Kriegsmann des Dreißigjährigen Krieges mit der
Belagerung von Gravelingen im Hintergrund. Teniers war Hofmaler des
Erzherzogs und Direktor seiner Galerie in Brüssel. Als Maler vor allem
kleinformatiger Bilder stellt das große Repräsentationsbildnis eine
Ausnahme in seinem Werk dar. Die beiden Kinderbilder Erzherzog Karl
Josephs, des Sohnes Kaiser Ferdinands III. aus seiner Ehe mit Maria
Leopoldine, entstanden im Abstand weniger Jahre, das des etwa
Eineinhalbjährigen zeigt ihn in einem Kleid, das des Vier- bis
Fünfjährigen in der extremen französischen Mode der Zeit: mit weiter
Hose ("rhingrave"), kurzer Jacke, Stulpenstiefeln, Federhut und vor
allem einer Überfülle von Bändern und Spitzen. Der Nachfolger
Großherzog Ferdinandos I. von Florenz war sein Sohn Cosimo II. Seine
geringe politische Bedeutung wird aufgewogen durch sein hohes
künstlerisches Interesse und die Förderung der Naturwissenschaften
(Globus und Zirkel auf seinem Bildnis weisen darauf hin), die sich vor
allem in seinem engen Verhältnis zu Galileo Galilei äußerte. Das
Porträt von Cosimos Sohn Mattias von Carlo Dolci ist in der Präzision
der Zeichnung vielleicht das künstlerisch bedeutendste der insgesamt
sehr qualitätvollen Gruppe der Medici-Porträts.
* * *
Der Innenhof ist mit
Grisaillemalerei al fresco gestaltet, bei der durch die Verwendung
verschiedener Grautöne der Eindruck eines Reliefs erzeugt wird. Er
zählt zu den am besten und größten erhaltenen Beispielen der
Freskenmalerei des 16. Jahrhunderts. Die Malerei übernimmt auch die
architektonische Aufgabe, mit Hilfe des gleichmäßigen
Dekorationssystems den unregelmäßigen Hof zu vereinheitlichen und die
Enge des Hofraumes auszugleichen. Auftraggeber war Erzherzog Ferdinand
II., dessen Anliegen es im Sinne der Renaissance war, durch die
Darstellungen der Musen, weiblicher und männlicher Helden und
Heldentaten die Fürstentugenden hervorzuheben und den Fürstenstand
vorbildhaft auszuzeichnen. Es ist nicht überliefert, welcher Maler den
Auftrag ausgeführt hat.
An der Ostwand befindet sich im Erdgeschoß ein Scheinfenster mit einem
Hirschen, darüber alttestamentarische Heldinnen wie Judith, Esther und
Jael, über dem Bacchuszug zwischen erstem und zweiten Geschoß nicht
identifizierte weibliche Figuren dargestellt, außerdem Judith mit dem
Haupt des Holofernes, eine Schlachtenszene und Ritter in phantastischen
Rüstungen.

KAISER FERDINAND II. UND EIN MANN MIT KLEINWUCHS - JOSEPH HEINTZ D. Ä., 1604
ÖL AUF LEINWAND, 200 x 116 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Ferdinand (1578-1637), ein Sohn Erzherzog Karls II., übernahm 1596 die
Regierung. Da sein Onkel Kaiser Matthias kinderlos blieb, wurde
Ferdinand 1619 dessen Nachfolger. Ferdinands Politik wurde vom
30-jährigen Krieg und der Gegenreformation bestimmt. Das Bildnis zeigt
Ferdinand mit einem „Hofzwerg". Menschen mit Kleinwuchs wurden als
„lebende Wunder der Natur" gesehen, galten als Statussymbole und waren
an italienischen Fürstenhöfen und am spanischen Königshof populär.
Menschen mit Kleinwuchs hatten auch konkrete höfische Ämter inne.
Erzherzogin Maria Anna, Herzogin in Bayern - Joseph Heintz d. Ä., 1604
Öl auf Leinwand, Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie
Maria Anna (1574-1616) war eine Tochter Herzog Wilhelms V. von Bayern
und der Renate von Lothringen. 1600 wurde sei mit dem späteren Kaiser
Ferdinand II. vermählt, starb jedoch vor dessen Erhebung in die
Kaiserwürde 1616. Das Bildnis gehört zu einer 1604 von Heintz gemalten
Bildnisserie und ist ein Gegenstück zum Porträt ihres Ehemannes.

ERZHERZOGIN MARIA CHRISTIERNA - STEIRISCH, 1595
ÖL AUF LEINWAND, 174 X 118 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Maria Christierna (1574-1621), eine Tochter Erzherzog Karls II., wurde
nach einem Vertrag 1595 mit Sigismund Bathory, der auch die
Regentschaft in Siebenbürgen zugesichert bekam, vermählt. Bathory
jedoch verbannte Maria. Ihr Bruder Erzherzog Ferdinand III erreichte
die Ungültigkeit der Ehe. 1608 legte die Erzherzogin die Gelübde im
Haller Stift ab, wo sie 1612 zur Oberin gewählt wurde. Maria trägt ihr
Brautkleid aus hellem Goldbrokat. Weiße Hochzeitskleider, wie man sie
heute kennt, sind erst seit dem 19. Jahrhundert gebäuchlich.
HERZOGIN SYBILLE VON JÜLICH-CLEVE-BERG - LUCAS VAN VALCKENBORCH, CA. 1579/80
ÖL AUF LEINWAND, 166 × 109,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Herzogin Sybille (1557-1626) war eine Tochter Herzog Wilhelms von
Jülich-Cleve-Berg und der Erzherzogin Maria. 1601 wurde sie mit
Markgraf Karl von Burgau, ein Sohn Erzherzog Ferdinands II. und der
Philippine Welser, vermählt. Sie starb kinderlos 1626. Die Herzogin
trägt passend zu ihrer Krause ein Taschentuch mit Reticella
(„Netzchen"), einer beliebten italienischen Klöppelspitze.
Taschentücher galten damals als Luxusartikel.
ERZHERZOG MATTHIAS - LUCAS VAN VALCKENBORCH, 1579
ÖL AUF LEINWAND, 198 × 98 CM | WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Erzherzog Matthias (1557-1619), ein Sohn Kaiser Maximilians II.,
regierte 1577 bis 1582 in den Niederlanden und wurde 1595 Statthalter
von Niederösterreich. Nach ständigen Konflikten mit seinem Bruder
Kaiser Rudolf II. erlangte Matthias 1608 die Regierungsgewalt in
Ungarn, Mähren, Böhmen und Österreich. Konfessionelle Schwierigkeiten
in Böhmen eskalierten 1618 im zweiten Prager Fenstersturz, der trotz
der Friedensbemühungen von Matthias in weiterer Folge zum 30jährigen
Krieg führte.

In ihrem Umfang von rund 200 Bildern und ihrer künstlerischen Qualität
ist die Habsburger Porträtgalerie der Porträtsammlung auf Schloss
Versailles oder der National Portrait Gallery in London ebenbürtig.
ERZHERZOG WENZEL - SÁNCHEZ COËLLO, 1574
ÖL AUF LEINWAND, 151 × 97 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Erzherzog Wenzel (1561-1578) war ein Sohn Kaiser Maximilians II. und
der Infantin Maria. 1577 wurde er zum Großprior des Johanniterordens
erhoben, starb jedoch bereits ein Jahr darauf im Alter von siebzehn
Jahren. Das Bildnis zeigt den dreizehnjährigen Erzherzog in spanischer
Hoftracht aus weißer Seide. Die Braguette, die Schamkapsel, ist
auffällig zwischen den versteiften Hosenbeinen zu erkennen. Obwohl die
Modeerscheinung vom Klerus angeprangert wurde, erreichte ein solcher
Hosenlatz manchmal sogar die markante Größe eines Kinderkopfes.

KACHELOFEN - TIROL, 1. HÄLFTE 18. JAHRHUNDERT | ΤΟΝ | SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Der auf fünf weißglasierten, männlichen Figuren stehende Unterbau zeigt
Masken, Fruchtbilder, die Allegorien der vier Jahreszeiten und die
Wappen von Tirol und Österreich. Der ebenfalls viereckige Aufsatz weist
an den Ecken die Personifikationen der Regierungsgewalten auf: Szepter,
Krone, Reichsapfel und Gerichtbarkeit. In den Kacheln dazwischen kommen
abermals die von Ornamenten umgebenen Jahreszeiten vor.

KABINETTSCHRANK - ÖSTERREICHISCH (SIGNIERT HT) 1614
ESCHE, AHORN, OBSTHÖLZER, TEILWEISE VERGOLDET, SILBERAPPLIKEN, KUPFER EMAILIERT | SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Kabinettschränke weisen in ihrem Inneren viele Fächer und Schubladen
auf, um Kostbarkeiten und Kunstkammerstücke aufzunehmen. Die reich
intarsierten, architektonisch gegliederten Fassaden dieses besondere
Exemplar verbergen 117 raffiniert ineinander verschachtelte Laden
unterschiedlicher Größe, die aber wie der außerordentlich gute
Erhaltungszustand vermuten lässt nie zur Aufbewahrung diverser
Kleinkunstobjekte dienten. Der Kabinettschrank mit vier gleichwertigen
Schauseiten und dem sich nach oben stufenartig verjüngenden Aufsatz mit
palastartigem Mittelteil steht in der Tradition der Augsburger
Kunstschränke des 17. Jahrhunderts.

Maria von England - nach Anthonis Mor, 1554 (?), Öl auf Holz
Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie
Maria „die Katholische" von England (1516-1558) war die Tochter König
Heinrichs VIII. und seiner ersten Frau Katharina von Aragon. Nach der
Trennung der Ehe ihrer Eltern erklärte ihr Vater sie für illegitim.
Durch die Sukzessionsakte von 1544 konnte sie aber nach dem Tod ihres
Halbbruders Eduard VI. 1553 dessen Nachfolge antreten. 1554 heiratete
sie Philipp II. von Spanien. Ihre gewaltsamen Versuche, den
Protestantismus in England auszurotten, brachten ihr den Namen „Bloody
Mary" ein. Auf dem Portrait trägt sie den „joyel rico", ein
Schmuckstück, das ihr Philipp II. geschenkt hatte und das später von
den spanischen Königinnen getragen wurde.

MODELL VON SCHLOSS AMBRAS - INNSBRUCK, 1839/40, HOLZ
Nach Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) wurde Schloss Ambras nicht
mehr als Residenz von Tiroler Landesfürsten genutzt. Das Schlossgebäude
verfiel zusehends, zuletzt war es bis 1842 Militärkaserne. Erzherzog
Karl Ludwig (1833-1896), Statthalter von Tirol, wählte es dann zu
seinem Sommersitz. Vor dem Beginn diverser Umbauarbeiten wurde dieses
Modell der Gesamtanlage angefertigt, das den originalen
Renaissancezustand des Schlosses dokumentiert. Heute nicht mehr
vorhanden sind das „Ballspielhaus" rechtwinkling zum Spanischen
Saal sowie die der Hauptzufahrt vorgelagerte „Heldenrüstkammer" im
Unterschloss.

KURFÜRST AUGUST VON SACHSEN - LUCAS CRANACH D. J., 1564/65
ÖL AUF LEINWAND, 215 × 104 CM- WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Kurfürst August (1526-1586) war der Sohn Heinrichs des Frommen. 1553
folgte er seinem älteren Bruder Kurfürst Moritz von Sachsen in der
Herrschaft nach. Er wirkte entscheidend am Zustandekommen des
Augsburger Religionsfriedens von 1555 auf protestantischer Seite mit.
Durch die Goldstickerei in strengem Rautenmuster erhält die Kleidung
des Kurfürsten einen besonders repräsentativen Charakter.
ANNA VON DÄNEMARK, KURFÜRSTIN VON SACHSEN - LUCAS CRANACH D. J., 1564/65
ÖL AUF LEINWAND, 215 × 104 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Anna (1532-1585) war die Tochter Christians III. von Dänemark. 1548
heiratete sie Kurfürst August von Sachsen. Durch ihre ausführliche
Beschäftigung mit Medizin und Pharmazie und ihr ausgeprägtes soziales
Engagement erhielt sie den Beinamen „Mutter Anna". Sie starb 1585 in
Dresden an der Pest. Der in reichen Falten fallende Rock und das
kleine, flache Barett entsprechen der deutschen Mode der
Jahrhundertmitte.

ZAHLTISCH - JOHANN CHRISTOPH PAUL TOSCAΝΝΟ 1628
KEHLHEIMER STEIN, FICHTE, ESCHE, AHORN, OBSTHÖLZER, EICHE, NUSS
WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, KUNSTKAMMER
Der Zahltisch wurde für Finanzgeschäfte aller Art verwendet und ist ein
Unikat ohne Vergleichsbeispiele. Neben einem Kalender finden sich eine
Umrechnungstabelle von Dukaten zu Gulden und Schillingen, eine
Rechentafel, die das gleichzeitige Rechnen in mehreren Währungen
ermöglicht, sowie ein Zinsrechner für einen Jahreszinssatz von von 6%.
Die Inschriften richten sich gegen das Laster der Trunksucht und
ermahnen zu einem maßvollen und gottesfürchtigen Leben.

SULTAN SÜLEYMAN I. - VENEZIANISCH, 1530/40
ÖL AUF LEINWAND, 99 × 85 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Sultan Süleyman I. (1495-1566) unternahm während seiner Regentschaft 13
Feldzüge. 1521 eroberte er Belgrad und vertrieb 1522 die Johanniter aus
Rhodos. 1526 vernichtete er ein ungarisches Heer bei Mohács und stieß
mit seinem Heer bis tief nach Ungarn vor. 1529 belagerten seine Truppen
Wien und verbreitete in ganz Mitteleuropa Schrecken und Entsetzen.
Süleyman war an der Herrschaft sowohl über das Festland als auch, mit
der Hilfe von Chair-ad-Din Barbarossa, über das gesamte Mittelmeer
interessiert. In seinem Konflikt mit den Habsburgern verbündete sich
der Sultan mit König Franz I. von Frankreich. Er verstarb während eines
Ungarnfeldzuges.
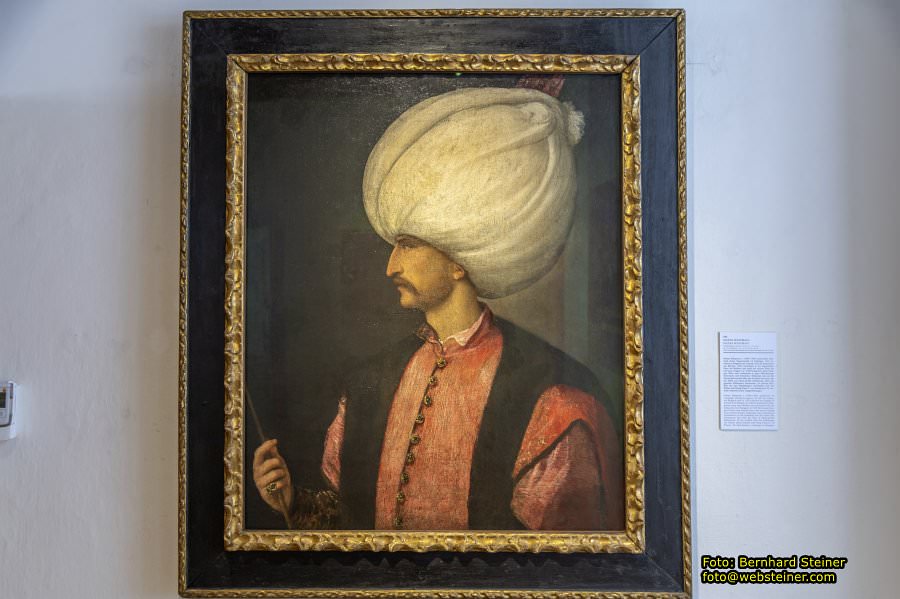
Kaiser Karl V. - Francesco Terzio, 1550
Öl auf Leinwand, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie
Kaiser Karl V. (1500-1558) war der älteste Sohn Philipps des Schönen
und der Juana von Kastilien. 1516 wurde er zum Nachfolger Ferdinands
von Aragon, 1519 zum Nachfolger Maximilians I. 1521/22 überließ er
seinem Bruder Ferdinand die Österreichischen Länder. 1526 heiratete er
Isabella von Portugal. 1530 wurde er in Bologna zum Kaiser gekrönt. Die
Portraitaufnahme Kaiser Karls V. als ca. 50-jährigem geht eher auf ein
Bildnis eines venezianischen Malers als auf ein verlorenes Original
Seiseneggers zurück.
Isabella von Portugal - Oberitalienisch, 16. Jahrhundert
Öl auf Leinwand, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie
Isabella (1503-1539) war die Tochter des Königs Manuel von Portugal und
der Maria, einer Tochter des katholischen Königs Ferdinand II. von
Aragon und der Isabella von Kastilien. 1526 heiratete sie ihren Vetter
Karl V., während dessen Abwesenheit sie die Regentschaft von Spanien
führte. Kurz nach der Geburt ihres siebten Kindes starb sie 1539.
Insgesamt überlebten nur drei Kinder: König Philipp II., Maria - die
spätere Frau Maximilians II. und Juana - die spätere Königin von
Portugal.

KAISER FRIEDRICH III. - HANS BURGKMAIR D. Ä. (?), ANFANG 16. JH.
ÖL AUF HOLZ, 78,5 × 51,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Friedrich III. (1415-1493) war der Sohn Herzog Ernsts „des Eisernen"
und der Cimburgis von Masovien. 1440 wurde er als Nachfolger Albrechts
zum deutschen König gewählt und 1452, als letzter Kaiser in Rom, vom
Papst gekrönt. Hier heiratete er auch Eleonore von Portugal. Bevor Wien
1485 vom ungarischen König Matthias Corvinus eingenommen wurde, legte
der Kaiser 1477 durch die Verlobung seines Sohnes Maximilian mit Maria
von Burgund den Grundstein für das spätere habsburgische Weltreich.
Nach 58jähriger Regierung starb Friedrich III. 1493 in Linz.
ELEONORE VON PORTUGAL - HANS BURGKMAIR D. A. NACH EINEM VERLORENEN ORIGINAL 1468
ÖL AUF HOLZ, 79 x 51,5 CM, WIEN, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, GEMÄLDEGALERIE
Eleonore (1436-1467) war die Tochter des Königs Eduard von Portugal und
seiner Frau Leonore von Aragon. 1452 heiratete sie in Rom Friedrich
III., einige Tage vor dessen Krönung zum Kaiser. 1467 starb sie
einunddreißigjährig in Wiener Neustadt. Von ihren fünf Kindern
überlebten sie Maximilian, der spätere Kaiser, und Kunigunde.

SAMMLUNG GOTISCHER SKULPTUREN beim Osteingang
Die Ambraser Sammlung gotischer Skulpturen
stammt aus der Zeit Kaiser Maximilians I. (1459–1519), dem Urgroßvater
Erzherzog Ferdinands II. Im 19. Jahrhundert wurden die teils gefassten,
teils roh belassenen Figuren gesammelt und ab 1880 auf Schloss Ambras
ausgestellt. Den Tiroler, vom süddeutschen Kunstraum beeinflussten
Werken stehen Skulpturen aus dem niederösterreichischen Raum gegenüber.
Die Sammlung ist im Erdgeschoss des Bergfrieds untergebracht, der am
Ende des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Gemeinsam mit Teilen des
Nordtrakts und der Kapelle gehört der Bergfried zum mittelalterlichen
Bauabschnitt des Schlosses.

Das Hauptwerk ist der imposante Georgsaltar, der im Auftrag Maximilians
von Sebold Bocksdorfer gefertigt wurde. Dieser Flügelaltar mit
freistehenden Figuren wurde allansichtig gearbeitet, was auf die
Raumfassung der Renaissance hinweist. Die Flügel des Altars zeigen die
Heiligen Christophorus, Katharina, Barbara und Florian.
Georgsaltar - Bildschnitzer: Sebald Bocksdorfer (?); Maler: Sebastian Scheel (?) nach 1516, vor 1519
Zirbenholz, Schloss Ambras Innsbruck
Der Georgsaltar ist ein Auftragswerk Kaiser Maximilians I. Im Zentrum
steht der hl. Georg, als Ideal des christlichen Ritters und Sinnbild
für Maximilians großangelegte Kreuzzugsidee. Maximilian förderte nicht
nur den von seinem Vater gegründeten St. Georgs-Ritterorden, sondern
rief selbst eine St. Georgs-Bruderschaft ins Leben. Die Altarflügel
schmücken Heiligenbildnisse, u.a. Achatius und Sebastian, die zugleich
verborgene Porträts von Maximilians Enkeln, Karl und Ferdinand, sind.
Die Wappenschilde verweisen auf die weitumspannenden
politisch-territorialen Ansprüche des Kaisers bis nach Portugal,
England und Neapel.

MARIENTOD - SÜDTIROL, UM 1520, ZIRBE, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Die Darstellungen von Marias Tod fußen auf der Homilie des Johannes von
Thessalonike und der Legenda aurea des Jacopus de Voragine. Nach der
Legende wurden die Apostel, als die Sterbestunde der Gottesmutter
nahte, von den verschiedenen Stätten ihres Wirkens auf wunderbare Weise
zu ihrem Haus gebracht, um ihr beizustehen. Maria sitzt in der Mitte,
die sie umstehenden Apostel beten. Wie bei vielen Gruppenbildnissen des
Spätmittelalters sind die Figuren flach übereinandergeordnet. Die
Gewänder sind einheitlich in Gold gefasst, wodurch die ausdrucksvollen
Köpfe besonders betont werden.

SCHMERZENSMANN | ECCE HOMO - ULM (?), CA. 1500, HOLZ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Die Skulptur des Schmerzensmannes ist stilistisch in die Nachfolge Hans
Multschers aus Ulm einzureihen. Die ursprüngliche gotische Hautbemalung
war in kräftigem Rosa auf Kreidegrundierung gehalten. Direkt darauf
befand sich eine breitangelegte gotische Blutbahn, welche bei der
letzten Restaurierung in ihrem Verlauf von der Seitenwunde bis an die
Innenseite des rechten Oberschenkels sichtbar gemacht wurde. Die
Letztfassung des rosa-grauen Inkarnats stammt aus dem Barock.

MARIENKRÖNUNGSALTAR - SÜDDEUTSCH, UM 1500, LINDEN- UND FICHTENHOLZ, SCHLOSS AMBRAS INNSBRUCK
Dargestellt ist die Krönung Marias zur Himmelskönigin durch Gottvater
und -sohn (Krone nicht erhalten). In der linken Nische steht auf einer
Säule Christus mit Dornenkrone und Wundmalen als sogenannter
Schmerzensmann, in der rechten Nische Maria Magdalena, die Zeugin von
Kreuzigung und Grablegung Christi. Die Schreinfiguren sind aus
Lindenholz, der Schreinkasten ist aus Fichtenholz gefertigt und ohne
farbige Fassung geblieben. Lediglich die Augen sind farbiggestaltet. Im
Fachjargon spricht man von „Holzsichtigkeit", ein Phänomen, das im
süddeutschen Raum in der Zeit von ca. 1470 bis 1530 zu beobachten ist.

Erzherzog Ferdinand II. bezog 1567 Residenz in Innsbruck, nachdem er
nach dem Tod seines Vaters Kaiser Ferdinands I. 1564 Tiroler
Landesfürst geworden war. Er brachte seine berühmten Sammlungen aus
Prag mit, die er bereits während seiner 20 Jahre langen Tätigkeit als
Statthalter im Königreich Böhmen begründet hatte. Nach Ferdinands II.
Tod 1595 erbte Markgraf Karl von Burgau das Schloss und dessen
Sammlungen und verkaufte alles an Kaiser Rudolf II. Dieser verleibte
sie jedoch nicht seiner eigenen Sammlung in Prag ein, sondern beließ
sie weiterhin auf Schloss Ambras.

Künstlich geschaffene Grotten wie diese waren in der Renaissance häufig
in Gärten anzutreffen. Das Interesse an antiken Bräuchen und
Gepflogenheiten und das bejahende Lebensgefühl in der Renaissance
ließen alte Trinkriten als feuchtfröhlichen Zeitvertreib
wiederaufleben. In der von Erzherzog Ferdinand II. angelegten Bacchusgrotte
im Schlosspark Ambras wurde der „Ambraser Willkomm“ zelebriert.
Verborgene Ketten und Gitter des Fangstuhls hielten dabei die Gäste
fest, die sich nur durch das Austrinken eines mit Wein gefüllten
Gefäßes befreien konnten. Deshalb wurde die Grotte nach dem römischen
Gott des Weines als Bacchusgrotte bezeichnet. Nach bestandener
Trinkprobe trugen sich die Gäste mit einem Spruch und ihrer
Unterschrift in Trinkbücher ein, die heute noch in den Ambraser
Sammlungen erhalten sind. Auf diese Weise haben sich wichtige
Persönlichkeiten der Zeit verewigt. Ebenfalls bis heute erhalten sind
die für den Ritus verwendeten Trinkgläser und der Fangstuhl.
Das Klima in der in Fels gehauenen Grotte ist feucht und kühl. Sie
wurde als Teil der Parkanlage künstlich erschaffen und ihre Wände waren
ursprünglich mit Muscheln verziert. Feste zu feiern war schon im 16.
Jahrhundert ein willkommener Zeitvertreib, deshalb wurde die
Bacchusgrotte gelegentlich als Weinkeller und Austragungsort
verschiedenster Feierlichkeiten genutzt.

Eine erste repräsentative Gartenanlage wurde an dieser Stelle unter
Erzherzog Ferdinand II. zwischen 1566 und 1572 errichtet. Im Norden
wurde dieser als "Keuchengarten"
benannte Freiraum vom Spanischen Saal, im Süden von der Bacchusgrotte
und im Osten vom Tierpark begrenzt. Im Westen stand ursprünglich das
sog. Ballspielhaus, das 1880 abgebrochen wurde. Der Keuchengarten
(benannt vermutlich nach einem mittelalterlichen, hier befindlichen
Gefängnis) war im späten 16. Jahrhundert ein Zentrum des
humanistischen, höfischen Lebens. Mehrere zeitgenössische
Beschreibungen geben davon Zeugnis, daß hier "Renaissancelust" gepflegt
wurde: In der Bacchusgrotte mußte man einen Trinktest bestehen, ein
"umlauffender Tisch" lieferte Wasserscherze, in den geometrisch
gestalteten Beeten pflegte man seltene Blumen und Kräuter. Matthäus
Merian versuchte in seiner "Topographia Provinciarum Austriacarum" 1649
die Erinnerung an diese - damals schon vernachlässigte -
Gartenschöpfung wachzurufen. Im 17. Jahrhundert entstand hier ein
Obstanger und im 18. Jahrhundert brach man den "umlauffenden Tisch" ab.
Zwischen 1852 und 1862 ließ Erzherzog Karl Ludwig das Hochschloß zu
seinem Wohnsitz umgestalten und gleichzeitig die Gärten im Sinne eines
Landschaftsparks erneuern. Zu dieser Zeit entstand das "Schwimmbecken"
im Keuchengarten als heute noch erhaltenes Kulturdenkmal des 19.
Jahrhunderts. 1914 wurde der Neorenaissance-Brunnen vor dem ehemaligen
Ballspielhaus aufgestellt und 1974 ein neuer geometrischer Garten von
den Bundesgärten Innsbruck (Ing. Otto Koppensteiner) errichtet. 1997
entstand hier ein Musterbeet der Renaissancezeit im Sinne von Hans
Puechfeldner (1592, 1594), der als Gärtner in kaiserlichen Diensten in
Prag wirkte und dessen Gartenbücher sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
in der Ambraser Bibliothek von Erzherzog Ferdinand II. befanden. Die
Rekonstruktion wurde von den Bundesgärten Innsbruck (Ing. Herbert
Bacher) gemeinsam mit dem Architekturbüro Dipl. Ing. Maria Auböck
(Wien) ausgeführt.

In den folgenden Jahrhunderten war das Schloss nicht mehr Residenz
eines Habsburger Landesfürsten und nur selten bewohnt. Durch mangelnde
Konservierungsmaßnahmen kam es zu Verlusten, die in den
handgeschriebenen Inventaren überliefert sind. In den dreißiger Jahren
des 18. Jahrhunderts erfolgte erstmals eine gründliche Sanierung der
Anlage und eine Neuaufstellung der Sammlung. Durch die spätere Nutzung
des Hochschlosses und des Spanischen Saales als Lazarett (1797–98), und
als Kaserne (1841–1843) entstanden allerdings wieder schwere Schäden an
der Bausubstanz. Nachdem 1805 Napoleon Bonaparte den privatrechtlichen
Charakter der Ambraser Sammlung nach der Niederlage Österreichs gegen
das Kaiserreich Frankreich anerkannte, wurden die Hauptbestände 1806
nach Wien in Sicherheit gebracht. 1814 wurden sie dann anlässlich des
Wiener Kongresses im unteren Schloss Belvedere unter dem Titel „K u K
Ambraser Sammlung“ ausgestellt. Sie kam aber bereits nach 1880 wieder
zurück nach Tirol, als auf Schloss Ambras ein Museum eingerichtet
wurde. Wertvolle Objekte verblieben jedoch in Wien, nachdem sie – ganz
der Mode der Zeit entsprechend – in die verschiedenen, neu entstandenen
Präsentationshäuser verteilt wurden. Seither bildet dieser Teil der
Sammlungen Ferdinands II. vor allem – zusammen mit den Sammlungen
Rudolfs II. – den Kernbestand des 1891 eröffneten Kunsthistorischen
Museums in Wien. Der andere bedeutende Teil wird auf Schloss Ambras
gezeigt.

Im Hochschloss sind die Habsburger Porträtgalerie, die Glassammlung
Strasser und die Sammlung gotischer Skulpturen von Schloss Ambras
untergebracht.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: