web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schlumberger Kellerwelten
Sektkellerei in Wien, Mai 2023
Entdecken Sie bei einer Führung durch die 300 Jahre alten Kellereien die Geheimnisse von Schlumberger. Tauchen Sie ein in die Welt der prickelnden Genüsse und verkosten Sie den sorgsam veredelten österreichischen Wein. Sie begleiten die Traube auf einer Sinnesreise vom Rebstock zum prickelnden Mousseux im Glas.

Das Unternehmen wurde 1842 von Robert Schlumberger gegründet. Er war
der erste Produzent von Sekt nach traditioneller Champagnermethode in
Österreich und schaffte es, sein Unternehmen von der Gründung bis zu
seinem Tod 1879 zu einem Lieferanten der königlichen Höfe Europas zu
machen. Dabei stellte er eine Produktionsstätte in Bad Vöslau auf. Wein
wird dort zum Teil noch immer geerntet. Schlumbergers „Vöslauer
Goldeck“ ist die älteste geschützte Weinmarke Österreichs. Schlumberger
war auch der erste, der in Österreich die bekannten Bordeauxrebsorten
Cabernet Sauvignon und Merlot anbaute. Der Wein, der auf zehn Hektar in
Bad Vöslau wächst, wurde als Privatkeller schnell erfolgreich und wird
auch heute noch als Schlumberger Privatkeller verkauft.

In der Sektkellerei in Döbling lagern 2 Millionen Flaschen. Das
Stammhaus bietet Besuchern einen gastronomischen Service, Führungen im
Keller sowie ein Museum an.

HISTORIE DER FAMILIE SCHLUMBERGER
Der Erfolgsgeschichte Robert Alwin Schlumbergers verdanken wir das
Bestehen der Marke Schlumberger seit 1842: Im September 1814 - in
Österreich findet der Wiener Kongress statt, die Welt ordnet sich neu -
wird Robert Alwin Schlumberger in Stuttgart geboren. Er verbringt seine
Jugend in Stuttgart und beginnt schließlich ein Studium, das er jedoch
nach dem Tod seines Vaters abbrechen muss. Er findet Arbeit in
Frankreich: Als Kaufmann beginnt er seine Karriere in der
Champagnerkellerei Ruinart Pére et Fils in Reims, wo er bis zum
Kellermeister und Produktionsleiter aufsteigt. Er ist kein Einzelfall,
zahlreiche Deutsche teilten dieses Schicksal. Doch Robert Alwins
Karriere nimmt eine neue Richtung, als er auf einer Rheinfahrt die
Tochter eines Wiener Knopffabrikanten kennenlernt.
Es ist der Beginn einer Liebesgeschichte, die ihn nach Wien führt:
Sophie und Robert Alwin träumen von einer gemeinsamen Zukunft, doch
Sophies Eltern stimmen der Übersiedlung ihrer Tochter nicht zu - so
folgt Robert Alwin Sophie 1842 nach Österreich. Sie heiraten. Mit dem
Ziel, hier ebenfalls eine Sektkellerei zu eröffnen, pachtet er vom
herrschaftlichen Zehentkeller in Bad Vöslau Weingärten am sogenannten
Goldeck im Maital. Bereits im Folgejahr spezialisiert er sich auf
Schaumweine, die er nach der „Methode der Champagne" erzeugt: einer der
ersten österreichischen Champagner ist kreiert! Anlässlich der Londoner
Weltausstellung 1862 kommt der Vöslauer Sparkling, wie er den
Schaumwein inzwischen nennt, auf die Weinkarte der britischen Königin
Victoria.
Auch in Wien wird der Champagner zum „königlichen Getränk":
Schlumberger wird zum k.u.k. Hoflieferanten. Der Vöslauer Sparkling
avanciert zum Lieblingsgetränk der Wiener Gesellschaft. Ein Jahr vor
seinem Tod im Jahr 1878 wird Robert Alwin Schlumberger mit dem Titel
Edler von Goldeck in den Adelsstand erhoben. Aufgrund des
Friedensvertrags von Saint Germain 1919 darf „Schlumberger Champagner"
nicht mehr länger so bezeichnet werden: Die Bezeichnung „Champagner"
ist ab nun, in der Champagne produzierten Schaumweinen, vorbehalten.
Die Methode der Herstellung des Schlumbergers bleibt aber bis heute die
gleiche.
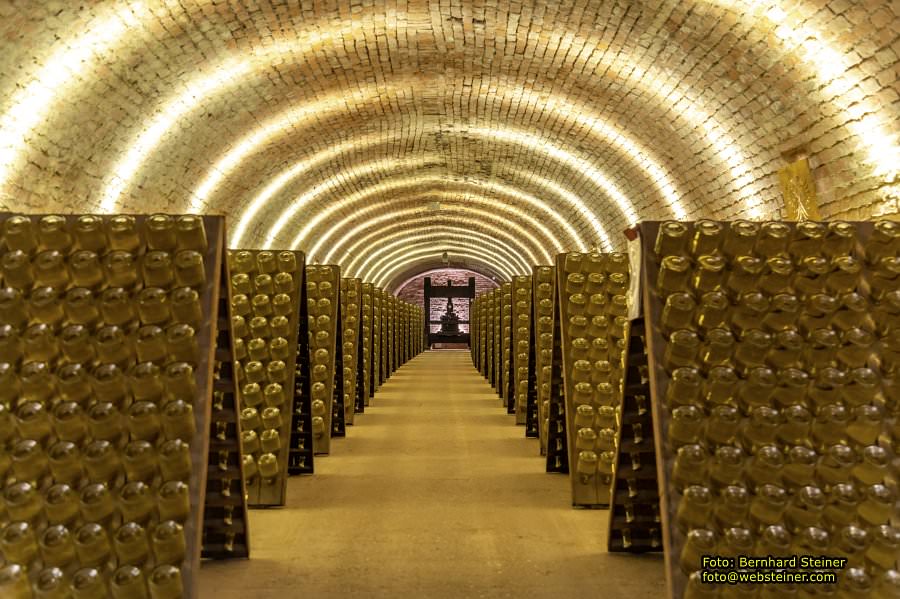
WAS IST EIN SEKTGRUNDWEIN?
Sektgrundweine müssen aus 100% gesundem, reifen Lesegut bereitet
werden, damit ein feines, frisches Säurebild entsteht. Daher werden
Sektgrundweine nicht nur nach Zuckergehalt, genannt Grad Oechsle,
sondern auch auf der Basis des Säuregehaltes (ph-Wert) gelesen. Diese
perfekt dosierte Säure verleiht dem Sekt in Verbindung mit der
Versanddosage einen vollen, ausbalancierten Geschmack und bildet eine
wichtige Basis für die Lagerfähigkeit.
Schlumberger hat in der Gegend um Poysdorf im Weinviertel ca. 400
Partnerwinzer, von denen die weissen Trauben bzw. Grundweine kommen.
Die Pinot Noir Trauben stammen aus dem nördlichen Burgenland.
Selbstverständlich wird der Anbau hinsichtlich der von Schlumberger
erwarteten Qualität ständig kontrolliert.
DIE ASSEMBLAGE - WAS IST EINE CUVÉE?
In der Praxis werden häufig verschiedene Grundweine zu einer
einheitlichen Cuvee zusammengestellt. Durch diese Vermählung - der
Assemblage mehrerer Weine - ist es möglich, die Eigenarten der
Grundweine zu einem gewünschten Optimum zu verbinden. Gleichzeitig
gelingt es dadurch, eine über mehrere Jahre gleichbleibend hohe
geschmackliche Qualität zu erzielen. Grundsätzlich verstärkt die
Versektung die Eigenart des Grundweines. Neben sortenreinen
Spezialitäten werden im Hause Schlumberger mehrheitlich Cuvées aus
Welschriesling, Chardonnay, Weissburgunder, grünem Veltliner und Pinot
Noir verarbeitet.

DIE TIRAGE
Nach der Zusammenstellung der Cuvée wird die sogenannte Fülldosage, der
Tiragelikör, zugesetzt. Dieser besteht aus 16 Gramm Zucker und 22
Milliliter Hefesuspension je 0,75L Flasche. Die Hefe-Zucker-Mischung
ist der Treibsatz für die zweite Gärung des Schaumweins. Der Zusatz des
Tiragelikörs darf den Gesamtalkoholgehalt der Cuvée nach Abschluss der
zweiten Gärung um höchstens 1,5 Volumenprozent erhöhen. Schlumberger
hat im Laufe der Jahrzehnte eine spezielle Reinzuchthefe entwickelt,
die auch rechtlich geschützt ist.
DIE TRADITIONELLE FLÄSCHENGÄRUNG
Bei der traditionellen Flaschengärung mit Rüttelverfahren, der méthode
champenoise oder auch méthode traditionnelle, erfolgt die Gärung in der
Originalflasche, die mit einem Kronenkorken und einer Bidule
verschlossen wird. Anschließend werden die Flaschen in einem ganzjährig
konstant 13 - 15°C kühlen Keller sich selbst überlassen.
DAS RÜTTELN
Hierzu werden die Flaschen auf Rüttelpulte gesetzt und ein bis zwei Mal
täglich aufgerüttelt, sowie um 45° gedreht. Ursprünglich waren
Rüttelpulte, früher „Bouteillen-Bretter" genannt - mit Löchern
versehene Bretter, in die die gewaschenen Flaschen kopfüber mit dem
Flaschenhals zum Abtropfen gestellt wurden. Aus der zunächst fast
waagrechten Lagerung der Flaschen werden diese allmählich in 24 - 32
Rüttelvorgängen in eine beinahe senkrechte Stellung übergeführt. Das
Drehen, Rütteln und Neigen bewirkt, dass die Hefe, selbst jene, die
sich an den Flaschenwandungen festgesetzt hat, in den Flaschenhals
gleitet, wodurch sich im Flaschenhals ein Hefedepot bildet. Ein guter
Remueur wendet bis zu 6.000 Flaschen in der Stunde, bzw. 35.000 bis
40.000 pro Tag.

DAS „DINGSDA"
Bidule ist ein zylinderförmiges Töpfchen aus Plastik, das als Einsatz
in einem Kronenkorken dient und während der traditionellen
Flaschengärung die Flasche verschließt. Der Name stammt aus dem
Französischen und bedeutet in der wörtlichen Übersetzung „Dingsda". Die
Qualität der Bidule hat erheblichen Einfluss auf die Qualität des
Weines, so wurden aufgrund der Durchlässigkeit der Bidule
Geschmacksunterschiede innerhalb derselben Charge in der Folge von
Oxidationsvorgängen festgestellt. Biduleeinsätze verringern das
Oxidationsrisiko und sammeln das Hefedepot, um das Degorgieren
(Enthefen) zu erleichtern.
DIE LAGERUNG
Sekt und Champagner verbessern sich nach abgeschlossener Gärung auf der
Hefe und können so über Jahre gelagert werden. Sobald die Hefe ihren
Dienst geleistet hat, vollzieht sie einen enzymatischen Prozess, die
Autolyse, die dem Schaumwein sein Aroma verleiht. Ferner sorgt dieser
Vorgang für die Einbindung der Kohlensäure im Wein, die später im Glas
für die feine, lang anhaltende Perlage sorgt. Vorgeschrieben sind daher
mindestens 15 Monate Reifezeit „sur lattes" (auf Latten) für
jahrgangslose Champagner und drei Jahre für Jahrgangs-Champagner. Auch
für Sekt ist die Lagerzeit auf der Hefe vom Weingesetz vorgeschrieben
und beträgt bei der traditionellen Methode mindestens 9 Monate. Die
nach dem Reifeprozess abgesetzten Hefen werden durch einen speziell
abgestimmten Rüttelvorgang, der Remuage, im Flaschenhals gesammelt.
EINE KLARE SACHE
Bis ins 19. Jahrhundert war Champagner trübe, weil die Hefe der zweiten
Gärung in der Flasche verblieb. Dann erfand 1806 Madame Clicquot
zusammen mit ihrem deutschstämmigen Kellermeister Antoine Müller und
Alfred Werlé das Rütteln und Degorgieren. Das erste Rüttelpult soll ein
Küchentisch gewesen sein. 1813 wurde diese Technik in André Julliens
„Manuel du Somalier" erstmals erwähnt. 1884 erfand Raymond Abelé die
mit einem Eisbad arbeitende Degorgiermaschine.
DAS DEGORGIEREN
Früher wurde warm degorgiert: Dabei wird der Kronenkorken mit einem
speziellen Kapselheber von der schräg nach unten gehaltenen Flasche
gehoben. Nach Herausschießen des Hefedepots aus dem Flaschenhals wird
die Flaschenöffnung mit dem Daumen verschlossen, die Flasche mit einer
schwungvollen Bewegung aufgerichtet und so weiterer Flüssigkeitsverlust
unterbunden. Dieses Verfahren, „à la volée" genannt, wird allerdings
heute kaum noch praktiziert, stattdessen wird die Hefe meist
eingefroren entfernt: Die Flaschen werden kopfüber soweit in ein
Kältebad, eine -24°C kalte Sole, getaucht, dass die im Flaschenhals
gesammelte Hefe zu Eis gefriert. Danach wird die Flasche aufgerichtet.
Nach dem Öffnen des Kronenkorkens schießt der Hefe-Eis-Pfropf aufgrund
des Drucks von 5 bis 6 bar aus der Flasche.

Was versteht man unter Sekt?
In Österreich und Deutschland wird Qualitätsschaumwein mit einem Druck
von mindestens 3,5 bar als Sektbezeichnet. Der Begriff ist weder auf
die Produktion in einer bestimmten Region noch oder auf eine Verwendung
bestimmter Rebsorten begrenzt. So kann Sekt beispielsweise aus allen
Teilen Österreichs oder Deutschlands stammen und ist sowohl in weiß als
auch rosé erhältlich. Ebenso wird in Österreich diese Bezeichnung
unabhängig von der Herstellmethode verwendet. Erst bei der
Eingliederung in Qualitätsstufen gemäß der Qualitätspyramide Sekt
Austria wird zwischen Herstellmethoden, Reifedauer etc. unterschieden.
Wer hat den Qualitätsschaumwein erfunden?
Auch wenn es ungewiss ist, wer den Qualitätsschaumwein tatsächlich
erfunden hat, führen die Spuren nach Großbritannien und
Frankreich: Bis in die 1650er Jahre war ausschließlich Stillwein
in der Gesellschaft erwünscht. Wenn der dennoch Bläschen hatte, war das
ein Makel. Nur die Engländer fanden Gefallen an dem prickelnden
Wein. Im Jahr 1662 hatte der britische Arzt, Mineraloge und
Chemiker Christopher Merret (1614-1694) als erstes die Herstellung des
Schaumweins glaubwürdig dokumentiert. In einem Brief an die Royal
Society beschrieb er, wie fein dosierter Zuckerzusatz oder Melasse dem
Stillwein ein Prickeln (Perlage) verleiht. Einige Jahre darauf
soll der Benediktinermönch Dom Pérignon (1638-1715), damals
Kellermeister der Benediktinerabtei Hautvillers in Frankreich, die
Herstellung von Schaumwein, vor allem die Methode Traditionnelle,
wesentlich weiterentwickelt haben. Von ihm stammt auch das Zitat: „Komm
schnell, ich trinke Sterne!“ Pérignon soll den Stillwein mit dem
Zuckerzusatz bereits in dickwandige 0,7L Flaschen gefüllt, diese mit
Kork und Kordel (später Agraffe) verschlossen und kühl und dunkel
gelagert haben. Dennoch blieb der Schaumwein bis ins 19.
Jahrhundert trüb. Erst seit der Erfindung des Rüttelns und Degorgierens
ähnelt er dem klassischen Sekt von heute auch optisch.

EIN HIMMLISCHES GETRÄNK, EINE TEUFLISCHE GESCHICHTE
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren Einkellerung und Vertrieb von
Champagner gefahren- und verlustträchtig. Infolge unterschiedlicher
Glasqualitäten und je nach Mischung unterschiedlich ablaufender
Gärungsprozesse in den Flaschen explodierte ein Teil schon im Keller
oder während des Transportes durch den Kohlensäureüberdruck. Die
Kellermeister trugen zur Arbeitssicherheit Eisenmasken, welche sie wie
mittelalterliche Folterschergen aussehen ließen. So entstand die
Bezeichnung „Wein des Teufels".
DIE DOSAGE - GEHEIMNIS DES KELLERMEISTERS
Durch die Dosage, z.B. in Wein gelöster Zucker, oder
Traubensaftkonzentrat, die exakte Zusammensetzung ist das Geheimnis des
Kellermeisters, erhält der durchgegorene Sekt seinen finalen Geschmack
je nach Charakter der Cuvée. Die Dosage gibt dem Sekt eine prägende
Note und bestimmt vor allem die auf der Flasche anzugebende
Geschmacksrichtung von brut nature über brut und trocken bis
halbtrocken und mild.

CHAMPAGNER BISCUIT IHRER MAJESTÄT, DER KAISERIN ELISABETH
Champagner wird zum Namensgeber diverser Speisen, selbst wenn das edle
Getränk „nur Begleitung" ist: Das Champagnerbiscuit zählt zu den
Lieblingskuchen der Kaiserin Sisi - trotz lebenslanger Diät.
15 dkg Zucker mit 5 Eiern aufschlagen. 6 dkg Butter und 9 dkg
Erdäpfelmehl einrühren. In befetteter, bemehlter Form backen. Mit
beliebiger Glasur glasieren.

GERUCHSFÄSSER
Grüner Veltliner
Abstammung: Kreuzung von Traminer und St.Georgen.
Weitere Bezeichnung auch Weissgipfler. Seine Aromen werden werden mit
weissem Pfeffer, Tabak, Citrus und Pfirsich assoziiert. Er ist nicht
verwandt mit Rotem oder Frührotem Veltliner.
Weissburgunder
Abstammung: Mutation aus Grauburgunder.
Der Weissburgunder wird auch Pinot Blanc oder Pinot blanco genannt. In
Österreich wird diese Burgundersorte manchmal als Klevner bezeichnet.
Aromanoten: Zitrus, ein wenig Heu.
Welschriesling
Abstammung: unbekannt.
Eine Verwandtschaft mit dem Riesling besteht nicht. Aus den
Welschrieslingtrauben werden Weine mit leichter Struktur und frischem
Aroma gewonnen in dem „Grüner Apfel" vorherrscht.
Chardonnay
Abstammung: verwandt mit den Burgundersorten.
Typisch für ist sein nussiger Geschmack. In der Steiermark wird der
Chadonnay als Morillon bezeichnet. Ein weiterer bekannter Chardonnay
ist der Chablis, der einer der drei Champagner-Rebsorten ist.
Pinot noir
Abstammung: in direkter Linie von einer Wildrebe.
Diese Sorte trägt auch die Bezeichnung Spätburgunder oder Blauburgunder
und ist eine wichtige Grundlage für Champagner. Aromanoten: Waldbeer,
moosig, Pilze.

1500 V. CHR. - DIE ERSTEN „WEINMARKEN” ENTSTEHEN
Im Neuen Reich des alten Ägypten (1550 - 664 v. Chr.) wurden die
Weingefäße mit Hieroglyphen bezeichnet und sehr genau etikettiert.
Inschriften auf Weinkrügen liefern oft bessere Informationen über den
ehemals darin enthaltenen Wein als heute übliche Flaschenetiketten. So
wurde das Jahr der Lese, die Qualität und die Herkunft, aber auch der
Eigentümer des Weingartens auf den Tongefäßen vermerkt. Selbst der
Oberwinzer, der für das Produkt verantwortlich war, wurde genannt.
6. JHDT. V. CHR. - DER BEGINN EINER SEHR LANGEN KULTURGESCHICHTE
Wein wird bereits in Vorderasien angebaut. Armenien sowie das heutige Georgien gelten jedoch als die Ursprungsländer des Weines.
700 N. CHR. – NOCH EIN LANGER WEG ZUM CHAMPAGNER
Die ersten Weinbauern in der Champagne waren, wie auch im heutigen
Österreich (den damalige Provinzen Noricum und Pannonien), die Römer.
Der Wein, den sie herstellten, war still, der Konsum mäßig. Trotzdem
blieb der Weinbau aufgrund der geografischen Nähe zu Paris und der
Aktivitäten der Klöster in Reims und Châlons-en-Champagne erhalten,
ohne jedoch große Popularität zu erreichen. Erst im 17. Jhdt. wird die
eigentliche Geschichte des prickelnden Getränks ihren Anfang nehmen.
DER HEURIGE - EINE IDENTITÄTSSTIFTENDE ERFINDUNG
Im späten Mittelalter war der Weinbau in und um Wien so erfolgreich,
dass er zum Haupterwerb der Wiener wurde. Im 15. Jahrhundert wuchsen
die Weingärten in Wien jedoch derart, dass sie den Ackerbau fast
vollständig verdrängten, worauf Herzog Albrecht V. das Anlegen neuer
Weingärten verbot. Es sollte trotzdem nicht an Wein mangeln, verkauft
wurde allerdings ab Hof oder in Gaststätten. Erst 1784 legte Kaiser
Joseph II. den Grundstein für die bis heute so beliebte Buschenschank:
Er erlaubte den Weinbauern, Lebensmittel aus eigener Erzeugung
gemeinsam mit ihrem Wein anzubieten, und das ohne besondere Lizenz -
der Heurige war geboren!
1662 - DIE DOSAGE, EIN QUANTENSPRUNG
Christopher Merret beschreibt in einem bei der Royal Society
eingereichten Schreiben, „Some observations concerning the ordering of
wines", den fein dosierten Zuckerzusatz, der zum Ziel hat, den Weinen
Frische und Perlage zu verleihen. Damit hat er die Herstellung des
Champagner erstmals glaubwürdig dokumentiert. Wesentlich
weiterentwickelt wird die Methode vom Benediktinermönch Dom Pérignon,
damals Cellarius der Benediktinerabtei Hautvillers. Dennoch bleibt der
Champagner bis ins 19. Jahrhundert trübe. Erst seit der Erfindung des
Rüttelns und Degorgierens ähnelt er dem heute so beliebten Getränk auch
optisch. Zeitgleich entwickelt sich der Champagner zu einem weltweit
verbreiteten Luxusgetränk.
1670 - ES SPRUDELT! ΕΙΝΕ NEBENERSCHEINUNG DER FLASCHENGÄRUNG
Die Weichen für den prickelnden Champagner sind gestellt: aus dem
ursprünglich stillen Weißwein wird Schaumwein. Im 17. Jahrhundert hatte
man begonnen, den Wein schon im Anbaugebiet in Flaschen zu füllen, um
seine Frische zu erhalten, da der Wein den Transport im Fass nicht gut
überstand.
1728 - CHAMPAGNER WIRD ZUM HANDELSGUT
Ein königlicher Erlass erlaubt nun offiziell den Flaschentransport und
schafft so die Grundlage sowohl für das edle Getränk selbst, als auch
für den Handel damit.
1729 - DAS ÄLTESTE HEUTE NOCH AKTIVE CHAMPAGNERGUT WIRD GEGRÜNDET:
Maison Ruinart -Dom Ruinart Pere & Fils. Hundert Jahre später wird
Robert Schlumberger dort sein Handwerk bis zur Perfektion erlernen.
1830 - ZUR MARKENBILDUNG ALLER CHAMPAGNER TRAGEN DIE FLASCHENETIKETTEN BEI, DIE AB NUN AUFKOMMEN.
Heute erinnert die Vielzahl an historischen Schlumberger-Etiketten an die Namenswandlung im Rahmen der Markenentwicklung.
1857 BIS 1859 - „ERSTES PRODUKT-SPONSORING":
Schlumberger an Bord der Fregatte Novara während der Weltumseglung: Der
Qualitätstest auf Tropenhaltbarkeit wird eindrucksvoll bestanden. In
Briefen der Crew wird der Schlumberger „Äquatorwein" nicht nur einmal
erwähnt.
Auszug aus dem Bericht des Linien-Fähnrichs Ernst Jacoby, Sr. Majestät Fregatte Novara, in See, den 17. September 1857:
„Der weisse Vöslauer hat nicht
gelitten und ist nach wie vor ein brillanter Tischwein. Die Mousseux
sind selbstverständlich gut geblieben.... Sie können mir glauben, dass
Ihr Name oft mit großem Vergnügen genannt worden ist. Bei verschiedenen
Gelegenheiten, Diners etc., wurde von den Herren in Rio de Janeiro Ihr
Wein köstlich gefunden und Viele wunderten sich am Morgen des folgenden
Tages kein Kopfweh zu verspüren."
Den Schlumberger Weinen und dem Schlumberger Champagner war damit der Weltmarkt eröffnet.
1862 - WELTAUSSTELLUNG IN LONDON.
Erklärtes Ziel war, die Weltausstellung von 1851 bei weitem zu
übertreffen. Besonders ausländische Aussteller und die Kolonien sollten
stärker vertreten sein. Der Ausstellungsumfang wurde thematisch
vergrößert und reichte von Kunst über Handwerk bis hin zu den neuesten
technischen Errungenschaften. Schlumberger Sparkling steht auf der
Weinkarte der Königin Victoria. Auch in Wien wird Schlumberger 1895 zum
k.u. k. Hoflieferanten ernannt.
1870 - IN FRANKREICH WERDEN DIE ERSTEN JAHRGANGS-CHAMPAGNER ABGEFÜLLT.
Zeitgleich beschäftigt die Firma Schlumberger bereits „Weinreisende" -
der Erfolg der Kellerei Schlumberger reicht längst über Österreichs
Grenzen hinaus.
1919 - DER CHAMPAGNERPARAGRAPH:
Im Friedensvertrag von Versailles wird dem besiegten Deutschland der
Schutz der Herkunftsbezeichnung Champagner auferlegt: Die Artikel 274
und 275 verbieten, Produkte mit fremder Herkunftsbezeichnungen zu
führen. Dies betrifft „Champagner" aber auch „Cognac" aus deutscher
Herstellung, die aus französischer Sicht irreführend nach französischen
Gegenden benannt waren. „Schlumberger Champagner" wird umbenannt in
„Schlumberger", hergestellt nach der „Méthode traditionnelle" -
selbstverständlich tut dies seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Nicht
nur der Schlumberger Heurige in Vöslau findet großen Zuspruch, auch
Schlumberger-Werbung ist gern gesehen und ihrer Zeit voraus.
1955 - UNTERZEICHNUNG DES STAATSVERTRAGS.
Mit dabei: Sparkling von Schlumberger.
1973 - BEGINN DER WEISSEN FORMFLASCHE
Nach dem Vorbild von Roederer Cristall ist Schlumberger als Marke
wieder seiner Zeit weit voraus: Eine weiße Flasche mit neuer
markengeschützter Form wird Teil der neuen Identität. Die prickelnde
Klarheit des Produkts und seine golden-schimmernden Farbe will man dem
Konsumenten nicht vorenthalten.

Histamin ist neben Sulfiten einer der Hauptverursacher der typischen
„Katererscheinungen". Es ist ein biogenenes Histamin und entsteht durch
bakteriellen Abbau von Histidin, einer Aminosäure, und ist in vielen
gereiften Nahrungsmitteln wie Käse, Rohschinken, aber auch Sauerkraut
enthalten. Bei gleichzeitiger Aufnahme von Alkohol und biogenen Aminen
genießt der Alkoholabbau höhere Priorität - das Histamin kann sich im
Körper anreichern. Die Folgen sind zumeist Kopfschmerzen, Hautrötungen
oder eine rinnende Nase, bis hin zu Verdauungsbeschwerden und niedrigem
Blutdruck. Der Histamingehalt eines Produkts hat somit einen starken
Einfluss auf seine Bekömmlichkeit. Die unterschiedlichen Gehalte an
biogenen Aminen in Weinen ergeben sich aus Unterschieden in der
Verarbeitung und Lagerungszeit der Trauben, sowie aus einer eventuellen
mikrobiologischen Kontamination während des Herstellungsprozesses. Das
Haus Schlumberger arbeitet seit jeher daran, ideale Voraussetzungen im
Herstellungsprozess zu schaffen und so den Histamingehalt der Produkte
möglichst gering zu halten.

Wie kam Sekt nach Österreich?
Die Geschichte der Schaumweinherstellung nach der Méthode
Traditionnelle in Österreich hingegen begann mit Robert Alwin
Schlumberger, dem Gründer von Schlumberger Sekt. Er hat im ältesten,
noch heute aktiven Champagnergut Maison Ruinart – Dom Ruinart Pere
& Fils das Handwerk zur Schaumweinherstellung gelernt und dieses
1842 nach Österreich gebracht.
Woher kommt der Begriff „Sekt“?
Der Begriff stammt vom Wort „Seckt“ und geht der Geschichte nach auf
das Jahr 1825 zurück. Der Hofschauspieler Ludwig Devrient spielte
damals den Falstaff in Shakespeares „Heinrich IV“ und war Stammgast in
der Berliner Weinstube Luttner & Wegner. Nach jeder Vorstellung
stürzte er – noch ganz in seiner Rolle - in die Weinstube und rief:
„Bring er mir Seckt, Schurke! Ist denn keine Tugend mehr auf Erden?“
Der Kellner wusste damit nichts anzufangen und servierte Devrients
Lieblingsgetränk, Champagner. In Shakespeares Stück hieß es eigentlich
Sack [Saek], was die damalige Bezeichnung für einen Sherry war. Durch
diesen Übersetzungsfehler wurde somit der Begriff „Sekt“ geboren. Nach
dem Friedensvertrag von St. Germain 1919 durfte kein Schaumwein
außerhalb der Champagne mehr als Champagner bezeichnet werden. Daher
gibt es auch keinen aus Österreich oder Deutschland. Im deutschen
Sprachraum setzte sich der Begriff „Sekt“ stattdessen immer weiter
durch.

Woraus besteht Sekt?
Sekt besteht aus einem Grundwein, dem Hefe und eine Zuckerlösung zugesetzt wird: Hauptbestandteil Grundwein:
Dieser kann entweder reinsortig, d.h. nur aus einer Rebsorte bestehen
(beispielsweise Chardonnay), oder eine Cuvée (beispielsweise Sparkling
Brut) sein. Letztere ist eine Assemblage (Vereinigung) mehrerer
reinsortig ausgebauter Weine. Dadurch kann der Kellermeister die
Eigenarten der Grundweine zu einem gewünschten Optimum zu vereinen.
Tiragelikör
(Fülldosage): Dem Grundwein werden Hefe und Zucker in Form eines
Tiragelikörs hinzugefügt. Der Zucker bildet die Nahrung der Hefe,
wodurch die Gärung beginnt und der Qualitätsschaumwein
Warum perlt Schaumwein?
Das feine Prickeln in jeder Flasche entsteht während der zweiten
Gärung. Bei der Methode Traditionelle geschieht das direkt in der
Flasche: Nach der ersten Gärung wird der Wein mit Hefe und einer
Zuckerlösung, dem sogenannten Tiragelikör oder auch Fülldosage genannt,
versetzt und in Flaschen gefüllt. In der verschlossenen Flasche
wandelt die Hefe den Zucker in Alkohol um, wobei Kohlenstoffdioxid
entsteht, das sich mit dem Wein verbindet. Durch das Öffnen der Flasche
entweicht der Druck und das Kohlendioxid wandelt sich zu Gas um und
entweicht als Kohlensäure. So kommen die Perlen, das sogenannte
Mousseux, in den Sekt. Je länger er auf der Hefe liegt, desto
fein-perliger und besser eingebunden ist die Perlage. Damit der
Schaumwein schön gleichmäßig perlt, haben Sektgläser oft einen
Moussierpunkt in der Mitte des Glasbodens. Dies ist entweder ein
hervorstehender Punkt im Glas oder eine aufgeraute Stelle an der dann
die Perlen nach oben steigen.

VERSCHLIESSEN UND AGRAFFIEREN
Nach der Zugabe der Dosage wird die Flasche bis zum Nennvolumen mit
Rohsekt befüllt und mit einem Sektkorken verschlossen. Der Naturkork
stammt von der Korkeiche (Portugal, Spanien, Sardinien). Dabei werden
zwei Naturkorkscheiben mit einem gepressten Korkkonglomerat verbunden.
Dieser luftdichte Verschluss wird mit einem Drahtkörbchen gesichert,
der Agraffe. Bei sachgerechter Ausführung hat der fertige Sekt jetzt
noch einen Druck von 400 bis 450 kPa (4,5 bis 5 bar).

Was bedeutet die Bezeichnung „Österreichischer Sekt“?
Als „österreichischen Sekt“ darf sich nur dann ein Schaumwein
bezeichnen, wenn es ein rein österreichisches Produkt ist. Die
Bezeichnung ist auf allen Etiketten von Schlumberger zu finden. Das
bedeutet: Sowohl die Trauben als auch der Wein stammen aus
Österreich - durch die Zusammenarbeit mit heimischen
Partnerwinzern. Die Verarbeitung findet in Österreich statt in
den Produktionsstandorten Bad Vöslau und Wien. Die diversen
Bestandteile des Produkts kommen auch aus Österreich: Glas, Karton,
Etiketten etc. Einzige Ausnahme sind die Naturkorken, die aus
Spanien und Portugal stammen. In Österreich gibt es keine Korkeichen.
Die Logistikpartner stammen auch aus Österreich.

KULTURGENUSS
Kultur ist individueller Genuss - dafür stehen unter anderem die
Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele und der Wiener
Opernball – und das nicht nur mit erstklassigen Veranstaltungen sondern
auch mit hochwertigen kulinarischen Angeboten. Das Haus Schlumberger,
als Parnter österreichischer Hochkultur kreierte seit jeher
Sondercuvees in themenbezogenem Design.

Sektflaschen-Größen: Piccolo, Magnum & Co
Wer nach dem perfekten Schaumwein für einen besonderen Anlass sucht,
muss sich nicht nur zwischen verschiedenen Trauben bzw. Cuvées, sondern
auch zwischen einer Vielzahl von Flaschengrößen entscheiden. Von 0,2
Liter bis 30 Liter stehen insgesamt 14 EU-weit genormte zur Wahl. Jede
hat dabe eine eigene Namensbezeichnung.

Wie heißen die verschiedenen Flaschengrößen?
Namensbezeichnung für Flasche - In Liter
Piccolo (Babyflasche) - 0,2 l
Demi oder Fillette (halbe Flasche) - 0,375 l
Imperial (Standardflasche) - 0,75 l
Magnum - 1,5 l
Jeroboam (Doppelmagnum) - 3 l
Rehoboam - 4,5 l
Methusalem - 6 l
Salmanassar - 9 l
Balthasar - 12 l
Nebukadnezar - 15 l
Melchior oder Goliath - 18 l
Sovereign oder Souverain - 25,5 l
Primat - 27 l
Melchisedech- 30 l

Welche Flasche eignen sich für welchen Anlass?
Für jede Gelegenheit gibt es die passende Größe: Zum Genießen
allein eignet sich eine Piccolo-Flasche. Als Speisebegleiter für zwei
bis vier Personen eignet sich eine gebräuchliche Imperial
Flasche. Möchte man bei Festen einen besonderen Eindruck
hinterlassen, kann man zu einer Magnum, Doppelmagnum oder zu einer noch
größeren Flasche greifen. Sondergrößen ab 3 Liter können im Fachhandel
oder direkt beim Hersteller bezogen werden. Mit einer Methusalem
Flasche kann eine Runde von 30 bis 50 Gästen z.B. im Rahmen eines
Sektempfangs versorgt werden. Allgemein gilt: Je größer die Flasche,
desto besser sollte die Kühlung geplant sein. Im Regelfall gestaltet
sie sich ab einer Methusalem schwieriger.

Schmeckt Sekt aus einer Magnumflasche wirklich besser?
Sekt aus einer 1,5-Liter-Flasche schmeckt oft besser, weil der
Luftanteil im Flaschenhals im Vergleich zur Flüssigkeitsmenge geringer
ist als in einer normalen 0,75-Liter-Flasche. Das bedeutet, dass beide
zwar die idente Luftmenge haben, eine Magnumflasche aber doppelt so
viel Flüssigkeit enthält. Ein geringerer Luftanteil führt zu einer
langsameren Reifung. Deshalb kann sich der Sekt in der größeren Größe
harmonischer und komplexer in der Struktur sowie in den Geschmacksnoten
entwickeln. Zudem verlangsamt der geringere Luftanteil die Oxidation.
Damit ist der Prozess gemeint, bei dem Sauerstoff mit den
Inhaltsstoffen des Sekts reagiert und dadurch den Geschmack verändert.
Schaumwein lässt sich daher in größeren Flaschen besser lagern als in
kleineren.

Von Brut bis Süß: So finden Sie die passende Geschmacksrichtung beim Sekt
Für den Geschmack von Sekt ist neben der Rebsorte die Süße
ausschlaggebend. Sie wird durch den vorhandenen Restzucker bestimmt.
Europaweit unterscheidet man so acht verschiedene Geschmacksrichtungen,
die von brut nature über halbtrocken bis hin zu süß reichen. Ein Blick
aufs Flaschenetikett reicht im Regelfall aus, um die Kategorie zu
erkennen. Wie wählen Sie aber die richtige aus? Wie unterschieden sie
sich? Und warum sollten Sie niemals trockenen Wein mit trockenem
Schaumwein gleichsetzen?
Geschmack wird in Süße gemessen
Die Süße von Wein und Schaumwein wird europaweit in bestimmte
Kategorien eingeteilt, die durch weinrechtliche Vorgaben festgelegt
sind. Sie basieren auf dem Restzuckergehalt in Gramm pro Liter.
Die Wein- und Sektkategorien entsprechen aber nicht den gleichen Werten
und somit nicht der gleichen Süße. So liegt beispielsweise der
Restzucker bei trockenem Wein bei etwa 4 g/l, während er bei Schaumwein
zwischen 17 und 32 g/l sein muss. Wer von einem ähnlichen Geschmack
ausgeht, wird vom hohen Zuckergehalt eines „trockenen“ Sekts oder
Champagners negativ überrascht sein.

DAS PORTAL
Karl Ritter von Ghega, ein Freund der Familie Schlumberger und späterer
Erbauer der berühmten Semmeringbahn, erweiterte im 19. Jahrhundert den
Keller zu seinem gegenwärtigen Umfang.
Noch heute ist ein baupolizeilicher Akt aus dem Jahr 1853 erhalten, der
den „Herrn Baumeister Khegar" als Erbauer des Portals ausweist.
Wolfgang Straub, der 2004 eine Biografie über Ghega herausbrachte,
erklärt die eigenwillige Schreibweise des Namens mit der
„orthografischen Freizügigkeit der Zeit".

Unterschiedliche Geschmacksangaben bei Wein & Schaumwein
Die Geschmacksangaben unterscheiden sich aus den folgenden zwei
Gründen: Der Säuregehalt beeinflusst die empfundene Süße, weshalb
Wein mit mehr Säure bei gleichem Restzucker auch in eine weniger süße
bzw. trockene Kategorie fallen kann. Bei Sekt, Champagner und
Prosecco spielt auch die Kohlensäure eine entscheidende Rolle, da sie
die Süße mildert. Daher entspricht ein trockener Wein eher einem
Schaumwein der Kategorie "Brut".
Geschmacksrichtungen von Wein - Für Wein gibt es vier
Geschmackskategorien, die sich auf den vorhandenen Restzucker- und
Säuregehalt beziehen:
Trocken: 4 g/l bis maximal 9 g/l, wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 2g/l niedriger ist als der Restzucker
Halbtrocken: Bis zu 18 g/l, wobei die Gesamtsäure maximal 10g/l niedriger sein darf als der Restzucker.
Lieblich: Bis zu 45 g/l. Die Säure tritt in den Hintergrund.
Süß: Mehr als 45 g/l.

Geschmacksrichtungen von Sekt
Bei Sekt, Champagner und Prosecco wird der Geschmack in acht Kategorien
unterschieden. Auch sie werden anhand des Restzuckerwertes (gemessen in
Gramm Zucker pro Liter) untergliedert:
• Kein Zuckerzusatz (<3 g/l): zero dosage, brut nature
• 0-6 g/l: Extra herb (extra brut, extra)
• Bis 12 g/l: Herb (brut, bruto)
• 12 bis 17 g/l: Extra trocken (extra dry oder extra secco)
• 17 bis 32 g/l: Trocken (sec, secco, asciutto, dry, secco)
• 32 bis 50 g/l: Halbtrocken (demi sec, abboccato, medium dry, semi sec)
• > 50 g/l: Mild (doux, dolce, sweet, dulce)
Je nach Herstellungsland kann es zu kleinen Abweichungen bezüglich der
Kategorien und des Restzuckergehalts kommen. In anderen Sprachen sind
auch andere Bezeichnungen geläufig. Die obigen Angaben beziehen sich
vor allem auf Österreich.

Was bedeutet brut?
Brut (ausgesprochen „brütt“) ist Französisch für „herb“. Herber Sekt
muss weniger als 12 Gramm Restzucker je Liter haben. Geschmacklich kann
man ihn am ehesten mit trockenem Wein vergleichen.
Was bedeutet trocken oder secco?
Sekt ist trocken (auf Italienisch „secco“), wenn er ein
Restzuckergehalt von 17 bis 32 Gramm je Liter hat. Daher lässt er sich
eher mit einem halbtrockenen bzw. lieblichen Wein vergleichen.
Sekt trocken oder halbtrocken: Was schmeckt besser?
Welcher Sekt besser schmeckt, ist pauschal nicht zu beantworten. In
erster Linie hängt es davon ab, wie süß man ihn trinken will: Der
halbtrockene Schaumwein schmeckt süßer, der trockene ist allgemein
verbreiteter. Beide Geschmacksrichtungen eignen sich hervorragend als
Aperitif und werden daher gern zu Süßspeisen gereicht. Der höhere
Restzuckeranteil ermöglicht es, diesen Sekt auf Eiswürfel zu servieren,
ohne dass der Geschmack dadurch sofort verwässert wird. Dies ist ebenso
eine Empfehlung für die Schlumberger Ice Seccos – auf Eis serviert sind
sie der ideale fruchtig-prickelnde Sommerdrink.

DER SEKTBRUNNEN
Eine Besonderheit im Domkeller ist der für die Wiener Weltausstellung
des Jahres 1873 geschaffene Sektbrunnen. Die Weltausstellung, die
fünfte im deutschsprachigen Raum, sollte das gewachsene
Selbstbewusstsein Österreichs nach den verlorenen Kriegen gegen
Frankreich und Preußen präsentieren. Etwa 53000 Unternehmer beteiligten
sich insgesamt an der Ausstellung, davon stammten etwa 9000 aus
Österreich-Ungarn. Unter den österreichischen Unternehmen befanden sich
neben Schlumberger auch heute noch bekannte Firmen wie z.B. Lobmeyr,
Franz Wertheim oder Thonet. Der hierher übersiedelte Brunnen steht in
einer Jahrhunderte alten Tradition von Weinbrunnen, welche die
Herrschenden zum Wohl des Volkes anlässlich von Kaiserkrönungen,
Geburten von Thronfolgern oder bei sonstigen Festivitäten sprudeln
ließen.

Welcher Sekt schmeckt lieblich?
Ab der Geschmacksrichtung „trocken“ wird Sekt in der Regel als süß
empfunden. Laut weinrechtlicher Vorgaben ist er das aber erst mit mehr
als 50 Gramm Restzucker je Liter. In dieser Kategorie wird er aber
weniger nachgefragt. Große Produzenten in Österreich und Deutschland
haben ihn daher nur sehr selten im Sortiment.
Als Speisebegleiter empfiehlt sich süßer Schaumwein zu intensiven Käsen, säuerlichen Desserts oder Wildgerichten.
Wie kommt der Zucker in den Wein oder Sekt?
Bei der Weinproduktion stoppt man die Gärung, um einen höheren
Restzuckergehalt beizubehalten, bevor die Hefen den Zucker vollständig
in Alkohol umgewandelt hat. Bei der Gärung
von Sekt hingegen verwandelt die Hefe den gesamten Zucker in Alkohol.
Danach ist der Restzuckergehalt im niedrigen einstelligen Bereich. Um
jedoch den Schaumwein seine feine Note bzw. den endgültigen Geschmack
zu verleihen, wird er nach dem Degorgieren mit einer sogenannten
Versanddosage aufgefüllt. Mit diesem Dosagelikör, ein
Wein-Zucker-Gemisch, wird die Geschmacksrichtung des finalen Produkts
bestimmt.
Fazit: trocken ist nicht gleich trocken
Bei Schaumwein unterscheidet man acht verschiedene Geschmacksangaben
(brut nature, extra brut, brut, extra trocken, trocken, halbtrocken,
mild). In anderen Sprachen haben sie andere Bezeichnungen (z.B. secco
für trocken), europaweit ist diese Kategorisierung aber weinrechtlich
festgelegt. Die geltenden Bezeichnungen für Schaumwein stimmen nicht
mit denen von Wein überein. Denn mit „trocken“ bei Wein ist nicht
dasselbe wie „trocken“ bei Sekt gemeint. Wer auf der Suche nach einer
ähnlichen Süße ist, sollte lieber auf eine Flasche brut, extra brut
oder brut nature zurückgreifen.

Eine messianische Bedeutung kommt dem Wein in der jüdischen und
christlichen Religion zu. Die Bibel - wo Noah als der erste Winzer gilt
- macht vom Wein reichen symbolischen Gebrauch. Der Wein symbolisiert
in der Bibel (Ps 104,15) das Fest und die Lebensfreude. Er gehört zum
Ritual des Sabbat, zu Pessach wie auch zu jeder Hochzeit.
Die Hochzeit zu Kana ist eine Wundererzählung aus der Bibel, die davon
berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser
in Wein verwandelte (Joh. 2,1-12).

Der Schlumberger ART FLOOR bietet seit seiner Entstehung im Jahr 2016
aufstrebenden, zeitgenössischen Künstler:innen die Möglichkeit Ihre
Werke auf 160m² Galeriefläche auszustellen. Zugleich können
Besucher:innen das perfekte Zusammenspiel aus Kulturgenuss und
Genusskultur in den Schlumberger Kellerwelten erleben. Schlumberger
steht seit 180 Jahren als verlässlicher Partner der heimischen Kunst-
und Kulturszene für das gemeinsame Erleben besonderer Momente.
Schlumberger Art Floor: Andreas Mathes - be.inspired

Jimi, Portrait of Jimi Hendrix (Rotbuche geflämmt, geölt)

Cardia, mein feuriges Herz (Eibe geölt)

Clavia II/Violinschlüssel (Jap. Schnurbaum geölt)

Der Künstler Andreas Mathes
Andreas Mathes ist seit zehn Jahren freischaffender Holzbildhauer. Er
studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien Bühnen- und
Filmgestaltung und arbeitete als Bühnenbildner an renommierten
österreichischen und deutschen Bühnen. In seinen Werken setzt er sich
mit der Natur, dem Menschsein und den Werten, die ein gelingendes
Miteinander ermöglichen, auseinander. Ein Beispiel sind die Inspiration
Helferleins, an den Händen ineinander „fließende" Figuren, die sich
gegenseitig helfen. Mathes findet überall Inspiration in der Natur, in
Gesprächen, in den Medien, beim Spazierengehen oder beim Betrachten
eines Stücks Holz. Er glaubt an die verbindende Kraft der Kunst, dass
sie dazu beitragen kann, die Gemeinschaft unter uns Menschen zu
stärken. Daher hat er während der Pandemie begonnen, seine Werke nicht
nur in der Galerie, sondern auch an öffentlichen Plätzen zugänglich zu
machen. Andreas Mathes lebt und arbeitet in Bisamberg,
Niederösterreich.

Arschgeweih (Walnuß geölt, Laser)

be.inspired - wie Kunst zum Miteinander inspiriert
In seiner bisher größten Einzelausstellung be.inspired tauchen die
Besucher ein in Andreas Mathes' vielfältigen Kunst-Kosmos, der von
abstrakten Skulpturen bis hin zu figuralen Arbeiten reicht und auch
Abstufungen dazwischen umfasst. Jedes Kunstwerk ist das Ergebnis einer
künstlerischen Entdeckungsreise: Am Beginn steht eine Inspiration, die
dann aus dem Holz herausgearbeitet wird - mit der Kettensäge, der
Hobelmaschine oder dem klassischen Schnitzmesser bis hin zum Feuer.
Stets lässt er sich dabei von den Eigenschaften des Holzes leiten,
seinem Eigenleben, seiner Maserung und Form. Dabei entstehen trotz
brachialer Werkzeuge fließende, haptische Formen. Sie sprechen unsere
Emotionen und Sinne an, indem sie uns inspirieren, also „berühren" und
von uns berührt werden wollen: von den Helferleins über die
lebensgroßen und lebendig wirkenden Neubrettler, bis hin zum Gesicht
einer Soulsängerin und abstrakten Skulpturen mit weichen, fließenden
Formen.

2015 - Geprüfte Qualität. Geschützter Ursprung.
Anlässlich der Einführung der Qualitätspyramide für Österreichischen
Sekt mit geschützter Ursprungsbezeichnung (Sekt g.U.) stellt
Schlumberger drei neue Produkte in der Kategorie »Klassik« und fünf
neue Produkte in der Kategorie »Reserve« vor. Schlumberger setzt damit
einen neuen Maßstab für die Qualität österreichischen Sekts. Die
Herstellung erfolgt entsprechend der strengen Kriterien der
Qualitätspyramide, unter anderem 100% Trauben aus einem einzigen
Bundesland, hergestellt ausschließlich nach der Méthode Traditionnelle.
2018 - Große Reserve
Schlumberger präsentiert die Große Reserve, eine Hommage an den Gründer
Robert Alwin Schlumberger. Das handgemachte Meisterwerk ist eine
reinsortige Chardonnay Spezialität des Jahrgangs 2015 und auf 5.000
Flaschen limitiert.
2020 - Die Ikone erstrahlt in neuem Glanz
Im Zuge eines umfassenden Redesigns der Schlumberger Spezialitäten
werden sämtliche Sorten in die Stufen der österreichischen
Qualitätspyramide für Sekt „Klassik, „Reserve“, und „Große Reserve“
eingeführt. Zeitgemäße, reduzierte Eleganz zeichnet die Schlumberger
Flaschen aus und unterstreicht die Leichtigkeit und Frische der
Produkte.
2021 - Erster Bio-Sekt im Sortiment
Mit dem Schlumberger Grüner Veltliner Bio Brut Klassik präsentiert die
Traditionskellerei erstmals einen bio-zertifizierten Sekt – hergestellt
aus besten österreichischen Trauben, rein biologisch angebaut. Das
Bio-Siegel auf dem Etikett steht für kompromisslose Qualität und
nachhaltige Produktion. Geschmacklich überzeugt der Jahrgangssekt mit
fruchtigem Duft, animierender Frische und einer würzigen Note – ideal
als Aperitif oder zu Fisch, Käse und leichten Speisen. Besonders
bekömmlich: Der Bio-Sekt ist histaminarm (< 0,1 mg/l). Mit dieser
Innovation reagiert Schlumberger auf die steigende Nachfrage nach
Bio-Genuss und setzt ein klares Zeichen für bewusste Qualität aus
Österreich.
2024 - Personalisiertes Etikett – und neu: mit Foto
Ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum – mit einer personalisierten
Flasche Schlumberger wird jeder Anlass zum Highlight. Seit 2024
erstrahlen die personalisierten Etiketten auf edlem Material mit
Perlmutschimmer, goldener Veredelung und exklusiver Haptik. Neu ist die
Möglichkeit, die Flasche zusätzlich mit einem eigenen Foto zu gestalten
– für ein Geschenk, das garantiert in Erinnerung bleibt. Zur Auswahl
stehen vier Flaschengrößen und drei Sorten. Das Etikett lässt sich in
wenigen Minuten online mit einem Wunschtext und Bild individualisieren.
Wer es besonders stilvoll mag, wählt die Variante im Geschenkkarton
oder in einer eleganten Holzkiste. So wird aus jeder Flasche ein echtes
Unikat – perfekt zum Feiern, Verschenken und Genießen.

„Vöslauer Goldeck“ ist das bekannteste Produkt von Schlumberger und die
älteste gesetzlich geschützte Weinmarke Österreichs. Der Schaumwein
fand Eingang in die Literatur: der norwegische Schriftsteller
Björnsterne Björnson schrieb 1894 an seine Tochter aus Schwaz in Tirol
„Wir tranken Vöslauer Schaumwein – und der beste Champagner behagt mir
nicht so wie dieser.“, John Galsworthy lobt in seinem 1926
uraufgeführten Theaterstück „Escape“ den Vöslauer, der Franzose Paul
Morand erwähnt ihn in seinem 1957 Essayband „Fin de Siecle“ als
typisches Getränk der Elite der Jahrhundertwende. Eine weitere bekannte
Marke ist Hochriegl, die Schlumberger im Jahr 2009 von Kattus erwarb.
Ab Mitte 2019 lässt das Unternehmen seine Produktion in
Wien-Heiligenstadt Schritt für Schritt auf und verlagert diese nach
Müllendorf im Burgenland.
