web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schrems
im Waldviertel, Oktober 2023
Schrems ist eine österreichische Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd und liegt im Waldviertel in Niederösterreich. Kunstmuseum Waldviertel, GEA – Waldviertler Schuhwerkstatt, Unterwasserreich und Naturpark Hochmoor mit Himmelsleiter kann dort besucht werden.
* * *
In dankbarer Erinnerung an die unter der glorreichen Regierung Sr. Majestät Franz Josef I.
Kaiser von Österreich König von Ungarn etc im Jahre 1850 erfolgte
Errichtung des kk Bezirksgerichtes Schrems Gewidmet im Jubeljahre 1898
Die Marktgemeinde Schrems

Die Stadtgemeinde Schrems liegt im Bezirk Gmünd und besteht aus zehn
Katastralgemeinden. Sie ist nicht nur eine der bedeutendsten
Wirtschaftsstandorte im Waldviertel, sie bietet auch Naturverbundenen
und Kulturintressierten zahlreiche Möglichkeiten. Schon seit langem hat
sich Schrems als Kunst- und Kulturstadt etabliert. Direkt neben dem
bekannten IDEA-Haus, das Produkte aus der ganzen Welt zeigt, liegt das
Kunstmuseum Waldviertel. Mit seinen wechselnden Ausstellungen,
Kreativkursen und dem Skulpturen-Erlebnispark ist es einzigartig in
Österreich und Europa. Das Wald4tler Hoftheater Pürbach hat sich als
nördlichstes Theater Österreichs mit Top-Produktionen weit über die
Grenzen des Waldviertels hinaus einen Namen gemacht.
Ein weiteres Highlight bildet das UnterWasserReich mit dem Naturpark
Hochmoor Schrems. Die Besucher erwarten wechselnde
Erlebnisausstellungen im Innenbereich und ein Wassergarten mit
Fischottergehege im Freien. Den Naturpark mit „Prügelsteg" und
„Moortretbecken" kann man auf drei Wanderwegen erkunden und von der 20
m hohen Himmelsleiter den Ausblick auf das größte Torfmoor
Niederösterreichs genießen. Ein Highlight im Sommer ist das Freibad
Moorbad, welches über Steg- und Sportanlagen, ausgedehnte Liegewiesen
sowie ein modernes Restaurant verfügt. Zahlreiche Wander- und Reitwege
sowie drei Mountainbike-Strecken laden die Gäste ein, die Gemeinde zu
erkunden, um anschließend in einem der hervorragenden Gastbetriebe ein
kühles Schremser Bier zu genießen. Bei einem Spaziergang im Stadtgebiet
können Sie einen Blick auf das denkmalgeschützte Schloss, die
Pfarrkirche oder die zahlreichen Denkmäler u. a. am Vereinsberg - eine
150 Jahre alte Parkanlage - werfen.

Schrems wurde um 1200 gegründet, der Name Schremelize für den
Braunaubach scheint 1179 erstmals auf. Er stammt wahrscheinlich vom
tschechischen Ausdruck für hartes Gestein („kremen“) ab, man weiß
jedoch nicht genau, ob der Ort nach dem Fluss oder umgekehrt benannt
worden ist.
Hartberger Granit, Schremser Granit, Herschenberger Granit gelb, Aalfanger Granit

Um 1410 wurde erstmals die Brauerei in Schrems erwähnt, auch ein
Landesgericht gab es damals bereits im Ort. Am 20. März 1582 wurde
durch Kaiser Rudolf II. zu Wien dem „Marckth Schrembß“ ein Wappen
verliehen. Es zeigt einen roten Schild, der von links oben nach rechts
unten durch einen breiten azurblauen Streifen geteilt wird, der mit
zwei weißen, gold gekrönten, in Form eines Zweifelsknopfes geflochtenen
Schlangen, mit ausgeschlagenen roten Zungen, mit voneinander gekehrten
Köpfen und Schwänzen belegt ist. Mit der Erhebung zur Stadt am 23.
Oktober 1936 wurde der Schild des Wappens mit einer fünfzinnigen weißen
Mauerkrone gekrönt. Als Stadtfarben von Schrems gelten die Farben
Rot-Blau-Rot. Im 17. Jahrhundert erhielt Schrems das Marktrecht von
Kaiser Leopold I. und es wurde mit dem Bau des Schlosses begonnen.

Im Westen des Hauptplatzes von Schrems steht der Stadtbrunnen des Ortes
aus 1848. Er hat eine polygone Form und ist aus Sandstein gemacht.
Zentral in der Mitte des Brunnens steht auf einem quadratischen Sockel
die Sandstein-Figur des Hl. Felix von Cantalice aus 1736. Die
Seitenwände des Brunnen zeigen Kartuschen mit diversen Symbolen. In der
Mitte ist die Jahreszahl 1848 eingraviert. Als Stifter des Brunnens mit der Hl. Felix-Figur wird die Familie Falkenhayn ausgewiesen.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schrems steht
westlich des Hauptplatzes auf einem eigenen Kirchenplatz. Die westlich
des Hauptplatzes an einer Geländestufe über dem Braunaubach gelegene
und bis 1811 von einem Friedhof umgebene Pfarrkirche ist von der
Verbauung des Kirchenplatzes halbrund umschlossen. Der Fassadenturm im
Westen hat rundbogige Schallfenster und ein Zeltdach.


Die neobarocke Kanzel ist aus dem 4. Viertel des 19. Jahrhunderts. Es
gibt eine Schnitzfigur Christus an der Geiselsäule aus dem 18.
Jahrhundert.

Der Hochaltar um 1720/1730 mit marmoriertem einachsigen Säulenaufbau
zeigt das Altarblatt am Hochaltar vom Maler Carlo Carlone und das
Aufsatzbild Dreifaltigkeit und trägt die Figuren Sebastian und Rochus.

Das Langhaus unter einem Platzlgewölbe über Doppelgurten auf
Wandpfeilern hat eine dreiachsige Orgelempore über Arkaden. Die
Deckenmalereien im Langhaus mit einem mariologischen Zyklus schuf der
Maler Franz Mayerhofer (1903/1905). Die Wandmalerei im Chor mit
Evangelisten und Lamm Gottes schuf die Malerin Maria Sturm (1951).


Die Orgel baute Matthäus Mauracher (1894).

In der ehemaligen Schule ist das Heimatmuseum untergebracht.

Pfarrkirche Schrems von der Braunaubrücke

Das Schloss Schrems steht zwischen der Braunbachbrücke und der
Budweiserstraße am Dr.-Theodor-Körner-Platz Nr. 1 in der Stadtgemeinde
Schrems im Bezirk Gmünd in Niederösterreich. Um 1635 hat sich Schrems
von Gmünd abgelöst. Nach 1635 wurde für die Herrschaft Schrems das
Schloss erbaut. Von 1777 bis 1781 erfolgten bauliche Veränderungen nach
einem Brand 1777. Die Hauptfassade wurde um 1890 gestalterisch
bereichert. Seit 1928 ist das Schloss im Besitz der Stadtgemeinde und
wurde 1990 als Schule und Postgarage genutzt.

Der frühbarocke später veränderte zweigeschoßige Vierflügelbau war
ursprünglich von einem Wassergraben umgeben. Die 16-achsige Westfassade
und die 12-achsige Südfassade sind die Schaufassaden. Im Westen und
Süden gibt es auch Eckerker mit gebauchten Anläufen. Die Südfront hat
zwei symmetrische frühbarocke Portale unter Sprenggiebeln mit
bekrönendem Doppelwappen Osy-Bartenstein (1790–1865). Im Dreieckgiebel
zeigt sich das Doppelwappen Thurn-Vrints (1896–1917) um 1890
zusammengefasst.

Hl. Nepomuk von 1737, Sandsteinfigur
Stifter: Ernst August Graf Falkenhaynn, Herr von Allentsteig und Schrems

Weltkriegedenkmal am Busbahnhof Schrems im Waldviertel

GEA Waldviertler Werkstätten Schrems

Das Kunstmuseum Waldviertel befindet sich in Schrems
(Niederösterreich). Erbaut und geplant wurde das Museum vom Ehepaar
Makis E. Warlamis und Heide Warlamis und wurde im Juni 2009 eröffnet.
Auf einer Gesamtfläche von 12.000 m² befindet sich das Museum mit
Galerie und Ateliers, sowie der „Park des Staunens“. Besonderer Wert
wurde dabei auf die Verbindung von internationaler Museumsarchitektur
mit der charakteristischen Waldviertler Natur- und Kulturlandschaft
gelegt.

MASTERpieces
Lehrende der Universität für Kunst und Design Cluj-Napoca
IOANA ANTONIU, LASZLO & MIKLOS BENCZE, MIHAI GULES, RADU HANDRU,
ANDREEA HOLOTA, ALICE ILIESCU, ISTVAN KUDOR, CRISTIAN LAPUSAN, FLORIN
MARIN, LILIANA MORARU, RADU MORARU, ALEXANDRA MURESAN, LIVIA PETRESCU,
RADU PULBERE, AXENIA ROSCA
MASTERpieces, 30 years of cooperation, University of Art and Design, Cluj-Napoca

IOANA ANTONIU - Dangerous Liaisons, 2021, embroidery and oil on canvas 100 x 90 cm


Die langjährige Zusammenarbeit des Kunstmuseum Waldviertel mit der
Universität für Kunst und Design, zwischen Rumänien und Österreich, ist
vor allem ein europäisches Projekt - beispielhaft für das was Europa
ausmacht: die Einheit von Vielfalt.
Die Werke der Künstler*innen der Ausstellung sind ein Spiegelbild
dieser Idealvorstellung, sind Bestandsaufnahme und Ausblick. Sie
versammelt Künstlerpersönlichkeiten aus mehreren Generationen
unterschiedlicher Stilrichtungen. Bernhard Antoni-Bubestinger

„Als Maler*innen, Grafiker*innen, Bildhauer*innen und
Textilkünstler*innen haben sie das öffentliche Interesse an
zeitgenössischer Kunst in Cluj-Napoca und darüber hinaus erheblich
gesteigert. Sie verleihen der Bewegung, die als Klausenburger Schule
bekannt geworden ist ein Alleinstellungsmerkmal und internationale
Anerkennung.
Das gemeinsame historische Kulturerbe unserer beiden Staaten, war nicht
nur in der Vergan-genheit, sondern ist auch gegenwärtig und in Zukunft
Nährboden eines kulturellen Dialoges, der für die europäische
Geisteswelt von hoher Relevanz ist...“ Christoph Thun-Hohenstein




FLORIN MARIN - DER RAUM DER MENINAS
IRON MENINAS entstand auf der Grundlage einer künstlerischen Recherche
über den Körper und die Körperlichkeit, die durch eine Reihe von
plastischen Prozessen und Arbeitstechniken für eine weibliche
Morphologie konkretisiert wurde. Die Struktur dieser Serie, gleich
einem Weg, der einer Art zeremonieller, knapper Dynamik folgt, sowie
die Architektur dieser Metallsilhouetten, verbinden uns direkt mit der
Ikonologie der Meninas. Die Serie integriert eine Reihe sehr
unterschiedlicher, dichotomischer Typologien der Meninas: vom Körper
einem Vogelkäfig, der uns auf eine Art innerer Analyse der Kind-Frau in
Bezug auf ihre Existenz aus sozialer Sicht verweist und auf die
Zwangsmechanismen der Folter, bis hin zu den imposanten, autoritären
Figuren, die eine hochrangige Nüchternheit vermitteln, hinweist. Die
Werke sollten durch diesen komplexen historischen, künstlerischen und
kulturellen Kontext wahrgenommen werden, der eine Erzählung des
gesamten Gruppenweges aufbaut, aber auch aus einer streng plastischen
Perspektive, ...
Iron Menina 10, Menina in expression - Velasquez, Cut/welded/patinated iron, 200 x 150 x 50 cm
Iron Menina 9, Madonna with the red umbrella, 2015, Cut/welded/patinated iron, 90 x 187 x 45 cm


TOUCH ME - Berührbilder von MAKIS WARLAMIS
Die reliefhaft gearbeiteten Bilder von Makis Warlamis sind tatsächlich
zum Berühren. Der Tastsinn ist genauso wichtig wie der Sehsinn. Für
viele Menschen, in manchen Situationen, ist er sogar noch
ausschlaggebender. Denn die Haut ist ein soziales Organ und die Hand
ein Ausdrucksmittel für Empathie. Auf jeden Fall ist es gut, den
Sehsinn ein wenig zu entlasten. Auch diese Ausstellung steht wie die
art vital - Ausstellung im Obergeschoss ganz im Zeichen eines
barrierefreien Kunsterlebnisses.

Warlamis' Bildkompositionen könnte man als Landschaftsansichten des
Garten Eden sehen. Wie einen Mikrokosmos aus elementaren Formen, die
wie Silben einer unentzifferten Schrift wirken, lange Zeit verschüttet
im Untergrund unserer Erinnerungen. Warlamis sucht unaufhörlich in den
Zwischenräumen, abseits herrschender Bildvorstellungen und präsentiert
diese Mitbringsel, die ein katalytisches Erwachen der Sinne bewirken.
Farben und Formen bilden ein Kraftnetz. Und bevor du dies erkennen
kannst, wirst du eingefarigen von seiner Wirkung. Die Gefühle und der
Tastsinn entmachten den Blick und verführen ihn in die versteckten
Räume des Traumes.
Jedoch nichts Mystisches, Unzugängliches ist an ihnen. Die Formen
erscheinen gleichzeitig intensiv und zurückhaltend. In den
Kompositionen seiner Bildflächen bildet das Licht ein Gefühlselement,
das sowohl das Auge als auch die Finger reizt. Der Farbsinn wird durch
den Tastsinn ergänzt, während die Hand über die reliefierte Oberfläche
gleitet. Unzählige kleine und kleinste Erhebungen werfen kaum sichtbare
Schatten, die das Bild unabhängig vom Motiv aufladen und verändern. Ein
Aufbrechen der Oberfläche in Millionen zierlicher Fühler, die den
Kontakt mit dem Raum, den Betrachtern suchen und das Bild zu einem
haptischen Erlebnis machen.
In manchen Bildern sind architektonische Strukturen sichtbar, vieles
erinnert an Oberflächen von Werken Paul Klee's, an Texturologien von
Dubuffet. Anderswo Bruchstücke von Gesichtern, von abstrakten Figuren
und Zeichen. Das Organische wird in das Schöne transformiert, leicht
lesbar und absolut künstlerisch. Eine Welt entsteht, ohne Belastung,
alles entstammt einer gelösten, poetischen Bildsprache, die zwischen
einer naiv-kindlichen und archaisch-symbolischen Ausdruckskraft pendelt.
Warlamis' Bildpoesie ist Dichtung einer neuen Wirklichkeit. Der
Betrachter kann im Freiraum der Elemente seine eigene Fantasie
entwickeln. Sie ist an keine bestimmte Dramaturgie gebunden, sondern
kann sich frei assoziierend an den schwebenden Symbolen festhalten, mit
ihnen fliegen, sie zu erfundenen Geschichten reihen...
Solange du diese Bilder anschaust, durchdringt dich eine einfache
Wahrheit: es gibt Erfahrungen, in der Materie und Geist keine zwei
getrennten Welten sind. Der fröhliche, reiche Glanz dieser Bilder
erfüllt unseren Alltag mit Freude.
Eurydike Trichon-Milsani, Kuratorin am Centre G. Pompidou, Paris

Der Museumsbau des Kunstmuseum Waldviertel ist eingebettet in den
weitläufigen „Park des Staunens“. Dieser Grünbereich umfasst eine
vielfältige Gartenarchitektur mit Steinskulpturen wie dem „schlafenden
Poeten“ oder den Himmelssäulen sowie einen Marientempel, ein
Amphitheater und den Makis-Miro Backofen. Im Sommer wird das Gelände
für Veranstaltungen genutzt. Ziel ist es durch Erlebnisführungen,
Familien-Festen, Brotbacken, Projekten, Workshops und Kreativwochen für
die Besucher ein ganzheitliches Erleben von Kunst, Natur und
Kreativität entstehen zu lassen.

Aktiv, innovativ, sympathisch und ungewöhnlich. An diesem besonderen
Ort können Kinder, Jugendliche, Familien, Kunstinteressierte und
Liebhaber schöner Produkte vieles entdecken. Auf 12.000m² verschmelzen
Architektur, Kunst und Design in Harmonie mit der Natur des
Waldviertels zu einem inspirierenden Gesamtkunstwerk.


DER PLATZ DER HIMMELSSÄULEN
Hier versammeln sich die großen Himmelssäulen. Mit Erdfarben bemalt,
richten sie sich nach oben und umkreisen eine unsichtbare Basilika. Die
„Menhire" des Waldviertels sind, wie die Bäume, eine Verbindung
zwischen Erde und Himmel. Von hier führt eine Säulenallee zum Plateau
des „Rosenhügels", dem kleinen, weichen Olymp, der eine Gesamtschau
über den Park ermöglicht. Das Auge schweift von den „Skulpturenhäusern"
über die „Großen Mutterskulpturen" und den „Schlafenden Poeten" bis zur
„Steinernen Kapelle".

Der sanfthügelig angelegte Skulpturenpark erzählt viele Geschichten und
regt die Fantasie an. Dieser Park des Staunens ist ein Ort der
Architekturmagie mit ungewöhnlichen Plätzen, Steinformationen und
rätselhaften farbigen Skulpturen: Das kleine Amphitheater, der Platz
der Backofenhäuschen und der Himmelssäulen, der schlafende Poet und die
Marienkapelle inmitten der unvergleichlichen Waldviertler Landschaft.
Plätze zum Verweilen und Energie tanken, für kreative und kulinarische
Feste. Ideal für Events, Hochzeiten und Fotoaufnahmen.

Im Rahmen des Bildhauersymposiums 2023 mit Studierenden und Lehrenden
der Universität für Kunst und Design Cluj-Napoca entstanden
großformatige Holzskulpturen, die nun den Skulpturenpark des
Kunstmuseums bereichern.

Pfarrgasse 9, 3943 Schrems

Der öffentlich zugängliche Bereich des Naturparks Schremser Hochmoor
ist ganzjährig geöffnet. Er besitzt drei verschieden lange Wanderwege
(von 4,5 km bis 13 km), wobei der kürzeste der „Hochmoor-Wanderweg“ ist
mit Ausgangs- und Endpunkt beim Moorbad Schrems. Hier befindet sich
auch der Eingang zum Unterwasserreich Schrems.

Das Hochmoor bietet verschiedene botanische und zoologische
Besonderheiten, die den Besuchern mit Schautafeln erläutert werden. Die
Wanderwege führen vorbei an der Himmelsleiter, einer 20 Meter hohen
Aussichtsplattform im Naturpark, sowie an den Wasserflächen der alten
Torfstiche. Zu bestimmten Zeiten im Jahr findet unweit davon ein
Schautorfstechen statt.

Der dringlichste Klimaschutzbeitrag des globalen Moorschutzes liegt in
der Verhinderung neuer Emissionen und in der Sicherung der
Kohlenstoffvorräte in gestörten Mooren durch Wiedervernässung. Dies
könnte viele Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wie bei vielen Mooren auf
der ganzen Welt wurde der ursprüngliche Zustand des Schremser Moores
durch Entwässerung, Torfabbau, forstliche und landwirtschaftliche
Nutzung stark beeinträchtigt. Um das Gebiet nutzen zu können, wurden
systematisch Gräben angelegt, die immer noch beträchtliche Wassermengen
aus dem Moor ableiten. Diese Entwässerung führt dazu, dass der
Torfkörper austrocknet. Dadurch beginnt ein Mineralisierungsprozess der
Torf wird zersetzt. Der gesamte Lebensraum verändert sich so stark,
dass die moortypische Pflanzenwelt verlorengeht. Die freien Moorflächen
verschwinden, das Gebiet verwaldet. Die Lebensgrundlage typischer
Tierarten schwindet.

Um einen moortypischen Wasserhaushalt wiederherzustellen ist es nötig,
die Entwässerungsgräben mit Hilfe von Dämmen aus witterungsbeständigem
Holz zu schließen. Der Wasserspiegel wird dabei so nahe wie möglich an
die Mooroberfläche gebracht. Man spricht von Renaturierung,
Restaurierung oder Sanierung des Moores.
Im Schremser Moor wurden bereits 2003-2006 einige Grabensperren
eingebaut und Moortümpel eingestaut. Durch die Entfernung aufkommender
Gehölze wurden waldfreie Moorbereiche offengehalten. Weitere
Schutzmaßnahmen sind aber notwendig. Dafür müssen Vermessungsarbeiten
geleistet und Daten über die Hydrologie und Torfmächtigkeit eingeholt
werden.

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Schrems
Was ist ein Moor? Ein Moor ist
ein Feuchtgebiet, in dessen nasser Bodenschicht Torf gebildet und
angereichert wird. Die Torfschicht ist mindestens 30 cm dick und
beinhaltet die subfossilen Rückstände der früheren Entwicklungsstadien
dieses Ökosystems. Kennzeichnend für Moore ist eine besondere, typische
Pflanzen- und Tierwelt. Moore findet man weltweit, wenngleich sie nur
etwa 3% der Landfläche auf der Erde einnehmen.
Niedermoore (Reichmoore):
Niedermoore entstehen in dauerhaft oder immer wieder vernässten
Gebieten. Man findet sie in Überflutungsbereichen von Flussauen und
Küstenlandschaften sowie in Verlandungszonen von Gewässern.
Zwischenmoore: In
niederschlagsreichen Gegenden können sich aus Niedermooren Hochmoore
entwickeln. Die Übergangsstadien sind fließend und werden als
Zwischenmoore bezeichnet.
Hochmoore (Armmoore,
Regenmoore): Dieser Moortyp wird ausschließlich durch Niederschläge
gespeist und ist deshalb extrem nährstoffarm. Bei uns sind Hochmoore
nach der letzten Eiszeit (vor etwa 10 000 Jahren) entstanden.
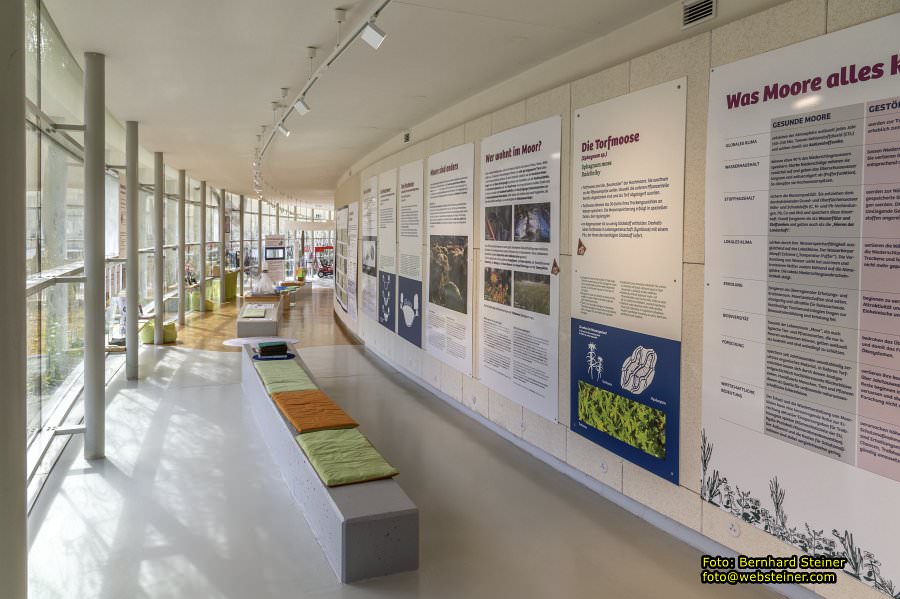
Unter widrigen Bedingungen, wie sie in Mooren üblich sind (saures
Milieu, Nässe, Nähr-stoffarmut, Temperaturschwankungen), können nur
sehr gut angepasste Tiere leben. Zu den Moorspezialisten gehören oft
stark bedrohte Libellen wie die Nordische Moosjungfer oder die Kleine
Binsenjungfer, genauso wie Amphibien wie die Knoblauchkröte, der
Nördliche Kammmolch oder der Moorfrosch. Auch spezialisierte Insekten
findet man in Mooren, darunter den Hochmoorlaufkäfer, die Kurzflügelige
Schwertschrecke oder die Schwarzglänzende Moorameise. Sehr selten sind
mittlerweile auch Vogelarten, die freie Moorflächen benötigen, wie zum
Beispiel der Waldwasserläufer.




In den meisten Ökosystemen besteht ein Gleichgewicht zwischen
aufgebauter und zersetzter Pflanzenmasse. In wachsenden Mooren ist die
Zersetzung abgestorbenen Pflanzenmaterials gehemmt, weil durch sauren
pH-Wert (Huminsäuren, teilweise etwa pH 2,5) und Luftabschluss
abbauende Bodenlebewesen nicht leben können. Das Fließgleichgewicht ist
damit zugunsten von Torfbildung verschoben, die sogenannte
„Stoffbilanz" ist positiv.
Was ist Torf? Alle Moore haben
eines gemeinsam: Sie enthalten unter ihrer Decke aus wachsenden
Moorpflanzen mehr oder weniger mächtige Schichten von Torf. Torf ist
aus den Resten dieser Moorpflanzen entstanden. Sie sind nach ihrem
Absterben nur unvollständig zersetzt worden. Diese toten Teile werden
am nassen Moorboden abgelagert und langsam in Torf umgewandelt. Sie
bleiben plattgedrückt als Torfschichten erhalten. Jedes Jahr „wächst"
der Torf um etwa einen Millimeter. Das Torflager wird dadurch im Lauf
von Jahrhunderten immer dicker.

Otter-Findelkind OTTO - Im
Oktober 2021 wurde in der Tierarztpraxis Steyregg (OÖ) ein
ungewöhnlicher Fund abgegeben. Ein verletztes Fischotter-Baby gehörte
zu den wenigen Wildtier-Arten, mit denen das Tierärzte-Ehepaar Daniela
und Stefan Wöckinger bisher keine Erfahrungen gemacht hatte. Schnell
war der Kontakt zum UnterWasserReich in Schrems hergestellt und der
Neuzugang wurde bei Familie Wöckinger per Fern-Coaching liebevoll
versorgt und betreut. Die Kopfwunde unbekannter Herkunft konnte
ausheilen und bald gehörte „Otto“ ebenso zur Familie Wöckinger wie
viele andere Pflegetiere und die hauseigenen Hunde. Auf der Suche nach
einem Platz zur Dauerhaltung wurde man beim UnterWasserReich fündig.

Eurasischer Fischotter (Lutra lutra)
Ordnung: Raubsäuger (Carnivora)
Familie: Marderartige (Mustelidae)
Lebensform: ganzjährig aktiv, Einzelgänger, Junge bis 14 Mon. bei Mutter
Lebenserwartung: 8-14 Jahre in der freien Wildbahn
Gewicht: 5-15 kg
Lautäußerungen: Keckern, Murren, Trillern, Pfeifen, Kreischen und Fauchen
Sinnesleistungen: Sehsinn, Geruchssinn und Gehör sehr scharf
Fell: 50.000 Haare pro cm², insges. 80-100 Millionen Haare am Körper
Ernährung: Stöberjäger, etwa 1 kg täglich; Fische, Frösche, Krebse,
Schnecken, Muscheln, Würmer, Insekten, Kleinsäuger (Mäuse oder
Bisam-ratten) und Wasservögel sowie deren Gelege
Revier: 15-40 km entlang Gewässern
Geschlechtsreife: ab 1,5-2 Jahren
Ranzzeit: ganzjährig; Hauptpaarungszeit Februar-April
Tragzeit: 55-65 Tage
Anzahl Junge: 1-4
Geburtsgewicht: 80-100 g
Gefahren: Straßenverkehr, Verhungern, Ertrinken, große Raubtiere
(Luchs, Wolf, Raubuögel) und streunende Hunde, Gewässerverschmutzung,
Fischreusen, Bejagung, Lebensraumzerstörung (Flussverbauungen und
-begradigungen), Nahrungsverknappung, Umweltgifte

Der Fischotter lebt in allen Feuchtlebensräumen. Seine Lebensweise ist
semiaquatisch, das heißt: an das Leben in der direkten Umgebung von
natürlichen oder naturnahen Gewässern angepasst. Er besiedelt Bäche,
Flüsse, Seen, Sümpfe und Teiche mit bewachsener Uferstruktur und
Küstengewässer. Bei der Nahrungssuche wandert er in seinem Revier umher
und versteckt sich in Bauen anderer Tiere, Gebüschen, Wurzeln alter
Bäume oder Uferunterspülungen. Für die Zeit der Jungenaufzucht werden
vom Weibchen, der Fähe, eigene Baue angelegt. Um ihr Revier zu
markieren, setzen Otter ihren Kot und Urin – die „Losung" - immer an
Land auf erhöhten Stellen wie Steinen ab.

Der Fischotter (Lutra lutra) lebt an sauberen Bächen, Flüssen oder
Teichen mit bewaldeten Ufern. Der Räuber aus der Marderfamilie ist mit
seinem dichten Fell und den Schwimmhäuten zwischen den Zehen gut an das
Leben im Wasser angepasst. Der Otter hat ca. 50 000 Haare pro cm²
(Mensch - ca. 120 Haare pro cm²).


Die Himmelsleiter ist eine
Aussichtsplattform im Naturpark Hochmoor in Schrems, Niederösterreich.
Die Holz-Stahl-Konstruktion besteht aus 58 paarweise angeordneten
Fichtenstämmen, die jeweils eine Länge von 19,4 m aufweisen. Zwischen
diesen Stämmen führt die 108-stufige Treppe aus Stahl mit einigen
Zwischengeschoßen hinauf zur 33 m langen Plattform in ca. 18,4 m Höhe.
Stahlzugstangen und Holzdruckriegel zwischen den Stämmen sowie eine
Stahlunterkonstruktion geben der Himmelsleiter Stabilität.

Moorblick - Das Moor erkennt
man an den niedrigen Laubbäumen. Der Nadelwald gehört nicht zum Moor.
Es ist etwa 300 ha groß. Bis 1980 wurde hier Torf abgebaut und das
ursprüngliche Hochmoor dabei zerstört. Die offenen Wasserflächen zeigen
noch heute die Stellen des besonders intensiven Torfabbaus. 2004 wurde
mit der Renaturierung des Moores begonnen.
Der Naturpark Schremser Hochmoor ist ein Naturpark und
Naturschutzgebiet und liegt etwas östlich von Schrems, im
nordwestlichen Teil Niederösterreichs, dem Waldviertel. Das Torfmoor,
das durch die Orte Langschwarza, Gebharts und Schrems begrenzt ist,
umfasst 300 ha und stellt damit das größte Moor Niederösterreichs dar.
Die ursprüngliche Moorlandschaft besteht aus mehreren benachbarten
Teilmooren wie dem Gebhartser Moorwald Nord und Süd, Moorwald St.
Ulrich, dem Schremser Torfstich und Schwarzinger Torfstich.

Die Himmelsleiter wurde von dem Wiener Architekten Manfred Rapf
entworfen und von der Horner Firma Graf-Holztechnik ausgeführt. Die im
Jahr 2002 fertiggestellte Aussichtswarte wurde mit dem
niederösterreichischen Holzbaupreis ausgezeichnet. Die Himmelsleiter
ist von April bis Oktober frei zugänglich.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Das Kunstmuseum Waldviertel, Schrems, Oktober 2023:
UnterWasserReich, Schrems, Oktober 2023: