web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Stift Heiligenkreuz
Zisterzienserabtei im Wienerwald, Mai 2023
Die fast 900 Jahre alte Zisterzienserabtei ist nicht
nur ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt, sondern auch ein
Ort der Kraft und spirituelles Zentrum im Herzen des Wienerwaldes.
Kultur, gregorianischer Choral und Genuss der heimischen
Wirtshauskultur im Stift Heiligenkreuz sind hier erlebbar.
Romanische Westfassade der Stiftskirche (1187), Dreifaltigkeitssäule (1729-1739), Josefsbrunnen (1739) mit Platanen (1848)

Das Stift Heiligenkreuz ist eine Zisterzienser-Abtei in Heiligenkreuz
im Wienerwald (Niederösterreich). Es besteht ohne Unterbrechung seit
seiner Gründung im Jahr 1133 und ist damit – nach dem Stift Rein – das
weltweit zweitälteste, seit der Gründung durchgehend bestehende
Zisterzienserkloster. Stand Mai 2024 gehören dem Stift fast 100 Mönche
an. Schwerpunkt ist die Pflege des klösterlichen Lebens, der Liturgie
und des gregorianischen Chorals in lateinischer Sprache. Ein Teil der
Mönche arbeitet in der Seelsorge in 18 inkorporierten Pfarren, andere
sind als Wissenschaftler und Professoren an der Hochschule tätig.
Westlich der mittelalterlichen Klostergebäude mit der Fassade der
Stiftskirche und den Eingängen zur Kirche und zum Klosterbereich
erstreckt sich der große polygonale Stiftshof. Neben den vorgenannten
zweigeschoßigen Gebäuden, ausgenommen der Fassade, wird er von jüngeren
zweigeschoßigen Klostergebäuden im Stil des Barock umschlossen, die
gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Benutzung freigegeben wurden. Auf
der kürzesten nördlichen Seite des Hofs befindet sich das große
rundbogige Eingangsportal, über dem ein fünf Geschoße hoher Turm
aufragt, mit einer aufwändig gestalteten Barockfassade aus Kaiserstein,
und der von einer Terrasse bekrönt wird, mit einer kunstvollen
Balustrade. Die äußeren Ecken des Gebäudes sind bestückt mit
kreisrunden Türmchen, die teilweise erst über dem Erdgeschoß beginnen
und mit den Spitzen ihrer zwiebelförmigen Barockdächer in Höhe der
Gebäudefirste enden. Sie gleichen den so genannten „Pfefferbüchsen“ in
der historischen Festungsarchitektur. Auf drei Hofinnenseiten sind im
Erdgeschoß und im Obergeschoß durchlaufende Arkadengänge mit
Kreuzgewölben angelegt.

Das Kloster wurde 1133 von Leopold III. aus der Dynastie der
Babenberger gestiftet und in der Folge von seinem Sohn und Nachfolger,
Leopold IV. von Österreich, großzügig bedacht. Es zählt zu den 300
Klöstern, die noch zu Lebzeiten des hl. Bernhard von Clairvaux
entstanden. Besiedelt wurde es vom Mutterkloster Morimond in Burgund,
sein erster Abt war Gottschalk. Das reguläre Klosterleben soll nach
traditioneller Überlieferung am 11. September 1133 begonnen haben. Das
Gründungsdatum ist allerdings nicht urkundlich belegt; die
Stiftungsurkunde wurde erst um 1230 geschrieben und mit 1136, nicht
1133, datiert.

Gut 100 Jahre wurde an den romanischen und gotischen Bauten der ersten
Klosteranlage gebaut. Die hochromanische Kirche mit Langhaus, Fassade,
Querhaus und dem Ursprungschor konnte bereits 1187, nach etwa 50 Jahren
Bautätigkeit, konsekriert werden, um am 31. Mai 1188 die wertvolle 23,5
cm große Kreuzreliquie zur Verehrung aufzunehmen, die an diesem Tag von
Leopold V. dem Stift geschenkt wurde, nachdem dieser von seiner
Jerusalem Pilgerreise zurückkam

Die große Kober-Orgel von Heiligenkreuz wurde 1804 von k.u.k.
Hoforgelbaumeister Ignaz Kober erbaut. Sie besitzt zwei Manuale, 55
Register und 2959 Pfeifen. Berühmte Komponisten, wie Franz Schubert und
Anton Bruckner haben auf ihr gespielt. Bis 1949 stand sie auf einer im
Barock eingezogenen Empore über dem Hauptportal des Langhauses. Diese
Empore verfälschte jedoch die Raumwirkung des romanischen Schiffs und
verdeckte den Lichteinfall durch die Fenster der Westwand. Abt Karl
Braunstorfer ließ sie deshalb abtragen und die Orgel in den nördlichen
Querhausarm versetzen.

Die spätromanische dreischiffige Basilika wurde gegen Ende des 12.
Jahrhunderts vollendet. Das Mittelschiff wird in der Höhe von
rundbogigen Obergadenfenstern reich belichtet. Die Spitzbogenportale
verweisen auf die andernorts schon begonnene Gotik. Im unteren Bereich
fällt das Licht der Fenster des nördlichen Seitenschiffs indirekt durch
die Scheidbögen der Arkadenzone ins Mittelschiff, hingegen ist es im
südlichen Seitenschiff relativ dunkel, da auf seiner Außenseite der
zweigeschoßige Kreuzgang anschließt.
Es dauerte ungefähr noch einmal so lange, bis 1240 die gotischen
Kloster- und Konventsgebäude, wie der Kapitelsaal, die Fraterie, das
Refektorium, das Dormitorium und vor allem der Kreuzgang im Süden der
Kirche zur Einweihung bereitstanden. Die längst eingezogene Gotik
führte zum Abbruch des verhältnismäßig kleinen romanischen
Ursprungschors und dessen Ersatz durch einen wesentlich größeren
hochgotischen Hallenchor, der zusammen mit dem Brunnenhaus im Kreuzgang
1295 zur Einweihung fertiggestellt war. Gleichzeitig war die
Bernardikapelle fertig.

Bis Ende des 13. Jahrhunderts war Stift Heiligenkreuz die Grablege
praktisch aller Mitglieder aus den Geschlechtern Wildegg und Altenburg.

Die Zisterzienser des 12. Jahrhunderts verwendeten manchmal den Begriff
„Paradies” als Bild für das Kloster. Wer nämlich im Kloster lebt, lebt
in Gottes Nähe und Gegenwart. Er liest und meditiert das Wort Gottes,
er versucht in Einheit mit der Liebe Gottes zu leben und davon den
Menschen weiterzugeben: seinen eigenen Mitbrüdern, den Gästen, die ins
Kloster kommen und den Gläubigen in den Pfarren des Klosters.

Die Babenberger haben dem Stift sowohl ein Stück des Kreuzholzes
Christi, als auch einen Dorn aus der Dornenkrone des Heilands geschenkt.

Das Stift Heiligenkreuz, auch „mystisches Herz des Wienerwalds" oder
„spirituelles Zentrum der Region" genannt, besteht seit dem Jahr 1133,
danach wurde rund 150 Jahre lang an der ersten Anlage gebaut. Die drei
gravierendsten Bedrohungen des Bauwerks fanden 1683 (Brandlegung durch
die Türken), 1770 (Aufhebung zahlreicher Klöster durch Joseph II.) und
1938 (Plan einer Autobahntrasse direkt über das Klosterareal nach dem
Anschluss an das sogenannte „Dritte Reich") statt. Die Zerstörungen
durch die Türken hatte einen raschen Wiederaufbau zur Folge, die
anderen beiden Pläne konnten rechtzeitig verhindert werden.

Vorgänger dieses neuen Chors war ein deutlich kleinerer romanischer
Chor, kaum breiter als das Mittelschiff und vermutlich ohne Umgang. Es
bestand damals aber hoher Platzbedarf im Chor und in dessen Umgebung,
vor allem für die zahlreichen Pilgerprozessionen zu den Reliquien, der
nur mit einem großflächigen Neubau gedeckt werden konnte. So entstand
der neue im Grundriss quadratische hochgotische Hallenchor aus neun
quadratischen, gleich hohen Jochen, jeweils in Dimension der älteren
Vierung. Die äußeren Joche wirken als Chorumgang bezeichnen. Es handelt
sich hier um den größten gotischen Hallenchor dieser Art in Österreich.
Zusammen mit dem Querhaus überschreitet die Grundfläche der Halle
diejenige des gesamten Langhauses. Eine direkte Nachfolge dieser
ungewöhnlichen Hallenform findet sich in der Heiligenkreuzer Filiation
Stift Neuberg, die sich dort aber über die ganze Kirche erstreckt.
Die Joche werden von steilen vierteiligen Kreuzrippengewölben
abgeschlossen, deren Rippen und Gurte auf Dienstbündeln aus „älteren
und jüngeren“ halb- und dreiviertelrunden Diensten aufstehen. Die
östliche und nördliche Außenwand sind großflächig und fast gewölbehoch
mit Spitzbogenfenstern und feingliedrigem gotischen Maßwerk geöffnet,
in jedem Joch ein Paar, im mittleren Joch der Ostwand ein einziges,
aber großes Fenster. Etwa die Hälfte der Verglasungen sind die
erhaltenen Originale der Zeit um 1290.

Sakristei (1667)

Die Sakristei wurde im 17. Jahrhundert an der südöstlichen Ecke des
gotischen Hallenchors angefügt. Der rechteckige Raum mit großen
Fenstern auf drei Seiten besitzt eine vielfach gegliederte Stuckdecke,
in Form eines Spiegelgewölbes. Vor den Fenstern unterbrechen kleine
Stichkappen die vorgenannten Wölbungen. Die Sakristei präsentiert
hochwertige Rokokofresken.

Intarsienkästen

Die ersten Zisterzienser kamen im 12. Jahrhundert aus dem Kloster
Morimond in Burgund nach Heiligenkreuz. Die Mönche brachten kräftige
Impulse für die Wirtschaft und die gesamte Entwicklung der Region und
verhalfen ihr durch umfassendes Wissen und Können im Handwerk sowie in
der Land- und Forstwirtschaft zu großem Aufschwung. Das weltweit
zweitälteste Zisterzienserkloster, das seit seiner Gründung durchgehend
besteht, beherbergt heute neben seinen rund 100 Mönchen auch die
Hochschule Heiligenkreuz und das Priesterseminar Leopoldinum.

Sakristei mit Deckenfresken von Carpoforo Tencalla

1642, bereits im Barock, waren die neuen Konventsgebäude im Süden an
den Kreuzgang und die Fraterie anschließend fertiggestellt. Das Datum
1667 steht für die Inbetriebnahme der Sakristei. Wenige Jahre danach
wurde 1674 der barocke Kirchturm abgeschlossen.
1683 überfielen Türken das Kloster und steckten es in Brand. Beim
Wiederaufbau unter Abt Clemens Scheffer wurde das Stift im Stil des
Barock erweitert. So entstanden bis 1691 westlich der bisherigen
Gebäude die „neuen“ Klostergebäude um den großen polygonalen Stiftshof.

1710 wurde der Ausbau der Annakapelle abgeschlossen, der man 1713 auf
der anderen Seite des Kapitelsaals die Totenkapelle anfügte. 1730 wurde
die Ausstattung der „alten Klosterpforte“ vollendet, der sich 1729 bis
1730 die Errichtung der Dreifaltigkeitssäule und 1739 des
Josefsbrunnens anschlossen.
Unter Joseph II. blieb das Stift 1783 von der Aufhebung verschont, weil
die Mönche seit der Gegenreformation mit Pfarrseelsorge und
Schulunterricht beschäftigt waren; diese Tätigkeitsfelder galten in der
Aufklärung als legitim.

Heilige Mutter Teresa
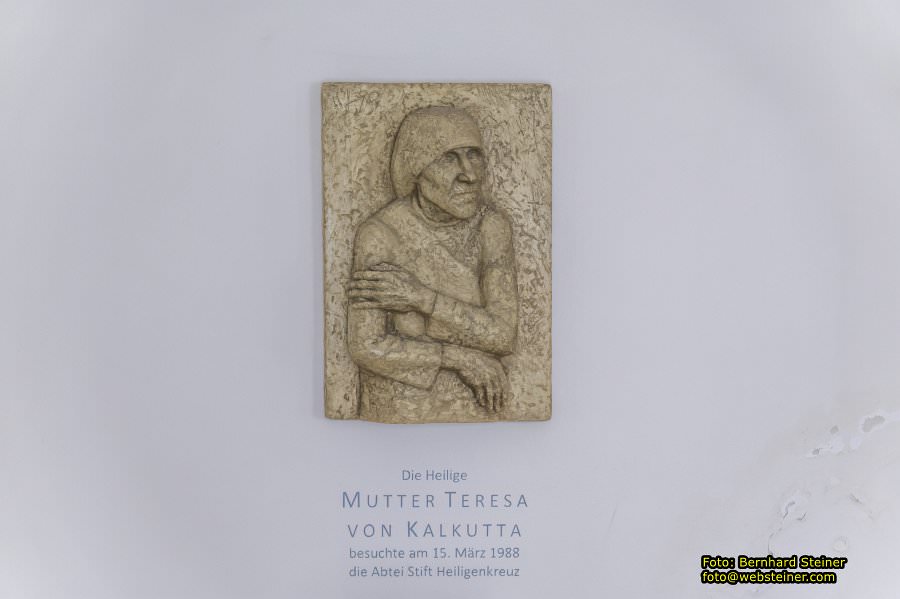
Die Fraterie war der Arbeitsraum der Fratres, der „Brüder“. Es gibt
einen Zugang vom Kreuzgang und zwei von anderen Bauteilen. Der Raum war
sicher ursprünglich für die unterschiedlichen Arten von Werkstätten
unterteilt, so zum Beispiel für die Schusterei, Schneiderei, Tischlerei
und andere. Neben der „Werkstatt“ lag das Skriptorium, die
Schreibstube. In diesem wichtigen Raum schrieben die Mönche Bücher von
Hand oder kopierten sie. Er war der einzige beheizte Raum des Klosters.
Erst 1992 entdeckte man das über eine Stiege begehbare Kalefaktorium,
den Heizraum.
Mittelalterliche Fraterie (1240) und Dormitorium

Die Fraterie umfasst immerhin 3 × 6, also achtzehn quadratische Joche,
die von breiten rechteckigen Gurten mit angespitzten Bögen in Längs-
und Querrichtung unterteilt sind. An den Wänden übertragen die fast
senkrechten Bogenenden die Lasten ohne Konsolvorsprünge in das
Mauerwerk. Insgesamt zehn Stützen, die meisten rund, tragen die übrigen
Bogenenden mit profilierten Kämpfern und Basen. Die Joche selbst werden
von Kreuzgratgewölben (ohne Rippen) überdeckt. Auch hier sind Bezüge
zur Romanik zu erkennen.
Fraterie Details

Nach dem Anschluss an das Dritte Reich (1938) war die indirekte
Zerstörung des monastischen Lebens durch den Bau einer Autobahntrasse
direkt über das Kloster geplant. Diese Pläne konnten nach dem Zweiten
Weltkrieg abgewendet werden und die Trasse der heutigen Wiener
Außenring Autobahn führt nördlicher am Ort Heiligenkreuz vorbei. Gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Glocken des Kirchturms als
Rohmaterial zur Herstellung von Waffen beschlagnahmt. Auch die
sowjetische Besatzung bedrohte das Klosterleben.

Der Kreuzgang, das Zentrum der Klosteranlage, schmiegt sich in den
rechten Winkel aus der südlichen Langhauswand und der westlichen Wand
des Kapitelsaals und der Fraterie. Er wird weiterhin im Westen begrenzt
von einem schlanken Gebäudeteil mit Klosternebenräumen und im Süden von
den jüngeren Konventsgebäuden. Der romanisch-gotische Kreuzgang
umschließt einen schlicht begrünten und liebevoll gepflegten Innenhof.
Die Nord- und Südgalerie sind je sieben Joche lang, die Ost- und
Westgalerie hingegen nur sechs Joche. Die Galerien werden außenseitig
unterteilt mit schlichten rechteckigen Strebepfeilern, die die
horizontalen Schubkräfte der Gewölbe abstützen, Kreuzrippengewölbe mit
zierlichen gotischen Profilen von Rippen und Gurtbögen.
Die Arkaden des Kreuzgangs sind in Biforien gegliedert, die ihrerseits
noch einmal in Biforien unterteilt sind. Die Bögen der Einzelöffnungen
sind spitz, ebenso die oberen Überfangbögen. Die mittleren
Überfangbogen sind hingegen rund. Die aufgelösten Bündelpfeiler in den
Arkaden weisen ebenso wie die Formen der Kapitelle in die Frühgotik. In
den Bogenfeldern sind kreisrunde „Ochsenaugen“ unterschiedlicher Größe
ausgespart, die ganz großen sind mit Maßwerk in Form von Vielpässen
ausgestattet.

Die Totenkapelle (1711) zwischen dem Kapitelsaal und der Fraterie war
im Mittelalter vermutlich das „Parlatorium“, der einzige Raum, in dem
die Mönche in einem Haus des allgemeinen Schweigens sprechen durften.
Seit 1713 ist der schmale Raum aus drei Jochen, mit Kreuzgratgewölben
überdeckt, als Totenkapelle in Verwendung. Die künstlerische Gestaltung
lag in der Verantwortung von Giovanni Giuliani. Tanzende Skelette
leuchten (als Kerzenträger) dem verstorbenen Mitbruder, der in der
Mitte der Kapelle aufgebahrt wird, den Weg in die Ewigkeit.

Kreuzgang (1240)

Kapitelsaal, die Grablege der Babenberger – unter anderem mit dem Hochgrab (Tumba) von Herzog Friedrich II.
Der Saal war auch Grablege der fürstlichen Förderer des Klosters aus
dem Geschlecht der Babenberger. Neun einfache Grabplatten sind noch im
Boden vorhanden. Für Herzog Friedrich II., den Streitbaren (1211–1246),
den letzten Babenberger, der Österreich regierte, ein großzügiger
Förderer des Stiftes, wurde ein Hochgrab geschaffen.
Friedrich II., auch Friedrich
der Streitbare, (* 1211 in Wiener Neustadt; † 15. Juni 1246 in der
Schlacht an der Leitha) stammt aus dem Geschlecht der Babenberger und
war von 1230 bis 1246 Herzog von Österreich und der Steiermark. Sein
Beiname der Streitbare wurde ihm nicht zu Unrecht gegeben – er war zeit
seiner Regierung ständig in Kämpfe mit allen Nachbarn verwickelt – vor
allem mit Ungarn, Bayern und Böhmen. Friedrich fiel 1246 in der
Schlacht an der Leitha gegen den Ungarnkönig Béla IV.; mit ihm starben
die Babenberger im Mannesstamm aus.
Friedrich der Streitbare bildet als letzter Babenberger einen
Epochenumbruch in der Geschichte Österreichs. In seinen hochfliegenden
Plänen seinem späteren Nachfolger Rudolf IV. nicht unähnlich, wurde er
immer wieder Opfer seines unsteten Charakters. Für Friedrich den
Streitbaren, der auch ein großzügiger Förderer des Stiftes
Heiligenkreuz war, wurde im Kapitelsaal des Klosters ein
eindrucksvolles Hochgrab geschaffen.
Hochgrab Friedrich II. im Kapitelsaal (1240)

Im Kapitelsaal befinden sich zahlreiche Gräber von Babenbergern,
darunter das Herzog Leopolds V. von Österreich, der 1192 den englischen
König Richard Löwenherz im heutigen Wiener Stadtteil Erdberg gefangen
genommen hat. Auf den barocken Fresken werden die im Kapitelsaal
begrabenen Personen dargestellt.

Das Kloster dient als Grablege des Herrschergeschlechtes der
Babenberger, der Markgrafen und Herzöge von Österreich im Mittelalter.
Eine Reihe von Landesherren und älteren Angehörigen dieses Hauses ist
im Stift bestattet, wobei sich die Gräber dieser fürstlichen Förderer
von Heiligenkreuz im Kapitelsaal befinden, dem Versammlungsraum der
Mönche.
Was die Kaisergruft in Wien für die Habsburger ist, das ist der
Kapitelsaal des Stiftes Heiligenkreuz für das Geschlecht der
Babenberger. Neben den Babenbergern sind hier auch zwei Enkel von
Rudolf von Habsburg begraben. Es scheint, dass die ersten Habsburger in
Österreich auf diese Weise an die Traditionen der Babenberger
anknüpften, um so ihre Nachfolge zu legitimieren.
Der Kapitelsaal war der Versammlungsraum der Mönche, in dem bei jeder
Zusammenkunft, zumindest ursprünglich, ein Kapitel der heiligen Schrift
vorgelesen wurde. Für die Mönche, die zur Teilnahme an diesen
Zusammenkünften berechtigt waren, galt die Bezeichnung „Kapitular“. Wie
bei fast allen Klöstern dieser Art öffnet sich der Kapitelsaal von der
östlichen Galerie des Kreuzgangs durch zwei Fenster und eine Tür, die
nicht verschlossen werden können, und drei Stufen führen zu ihm hinab.
Der Kapitelsaal ist untergliedert in neun quadratische Joche mit
vierteiligen Kreuzrippengewölben, deren Rippen und Gurte an den Wänden
von Kragkonsolen und im Raum von vier achteckigen Säulen getragen
werden. Die heutigen Rippen, Kämpfer und Kapitelle lassen eine barocke
Überarbeitung vermuten. In der Ostwand belichten drei große kreisrunde
bunt verglaste „Ochsenaugen“ den Raum direkt.

Brunnenhaus (1295)

In der gleichen Zeit wie die Totenkapelle wurde auch die Annakapelle
(1710), zwischen dem Hallenchor der Kirche und dem Kapitelsaal,
fertiggestellt. Dort war im Mittelalter die Büchersammlung des
Konventes, die geistliche Waffenkammer, daher Armarium genannt.

Fenster Kreuzgang


Der Lesegang ist mit Scheiben verglast, die
zum Teil aus dem 13. Jahrhundert stammen. Sie sind in unterschiedlichen
Grautönen mit Grisaille-Malerei geschmückt. Die Witterung hat den
wertvollen Scheiben zugesetzt.


Ein Teil des Kreuzgangs heißt „Lesegang“, weil sich hier die Mönche vor
der Komplet zu einer Lesung versammeln. Ein Vorleser trägt von einer
hölzernen Kanzel dem Konvent, der sich auf der gegenüber liegenden
Seite der Galerie auf hölzernen Sitzbänken versammelt hat, einen
Abschnitt aus der Benediktsregel vor. Die barocke Einrichtung hatte
Armlehnen an den Sitzplätzen des Abtes und seiner beiden Nachbarn
(Prior und Subprior), die ihm als Obere zur Seite stehen.


Das Brunnenhaus (1295) im Kreuzgang, unmittelbar neben der Südgalerie,
war im Mittelalter die einzige Trinkwasserquelle des Klosters. Der 1295
fertiggestellte hochgotische neuneckige Raum vermittelt den Eindruck
einer prächtigen Kapelle, mit den gotischen Fenstern aus
farbenprächtigen Glasscheiben, auf denen die Familie der Babenberger
dargestellt ist, mit dem Schlussstein des Rippengewölbes, der den
thronenden Christus präsentiert (das Original aus Eichenholz ist im
Museum ausgestellt), und letztlich mit dem pyramidenförmigen
Renaissancebrunnen aus Blei. Diese derart ästhetische Ausgestaltung
eines profanen Raums mit der Funktion als Wasserstelle und Waschküche,
verwundert zunächst. Dafür gibt es aber theologische Gründe. Die
prachtvolle sakrale Raumgestaltung sollte die Mönche daran erinnern,
dass auch gewöhnliche Alltagsbeschäftigungen im Angesicht Christi
(Schlussstein) geschehen und dass sie stets mit allem und überall Gott
dienen.

Schlussstein des Rippengewölbes, der den thronenden Christus präsentiert

Gotische Fenster aus farbenprächtigen Glasscheiben, auf denen die Familie der Babenberger dargestellt ist.
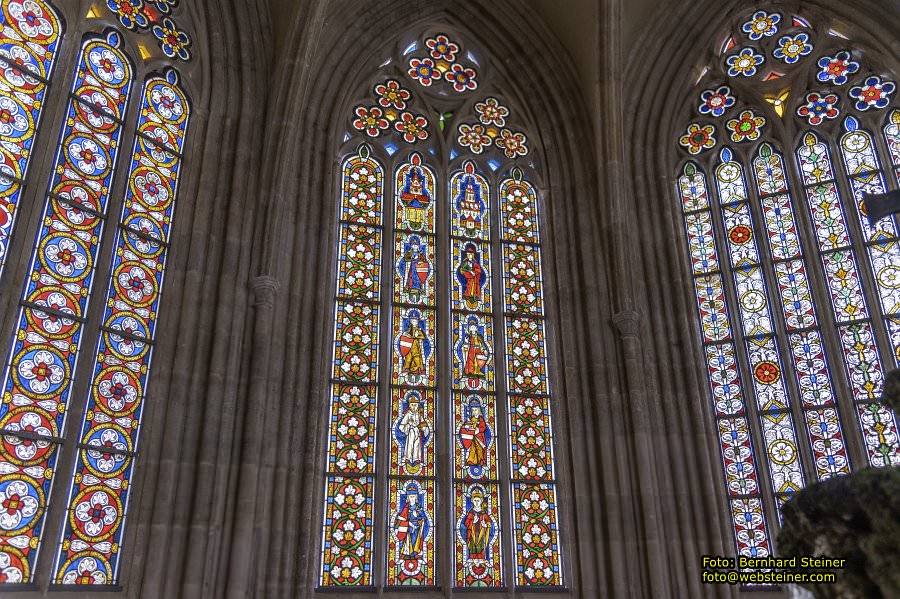
Die „Alte Pforte“ ist ein kleiner Raum über den im Mittelalter man
unmittelbar von draußen in die Südwestecke des Kreuzgangs gelangen
konnte. Ein Mönch ließ hier bis in die 1970er Jahre die Ankommenden in
das Kloster ein. Die barocken Fresken zeigen die Gottesmutter Maria,
den heiligen Benedikt (in schwarzer Kutte) und den heiligen Bernhard
(in weißer Kutte). Die Eintretenden stellen sich symbolisch unter den
Schutz dieser Heiligen.

Alte Pforte

Der Stiftshof beherbergt in seiner Mitte die Dreifaltigkeitssäule (eine
so genannte „Pestsäule“), geschaffen von Bildhauer Giovanni Giuliani,
von Hof-Steinmetzmeister Elias Hügel, aus Steinen von Kaisersteinbruch,
Eggenburg und von Meister Johann Georg Deprunner aus Loretto mit dem
Lorettokalk, sowie den Josefsbrunnen, Steinmetz Joseph Winkler, beide
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Der Brunnen im Klosterhof ist von fünf Platanen umgeben, die ein Pentagramm bilden und dessen Spitze nach Mariazell zeigt.

Hallenchor (1295)

Kirchenschiff (1187)

Chorgestühl



S. Bernardus

S. Benedictus

Klosterfriedhof

Kirchturm (1674) bei der Kreuzkirche (1982) mit Heiligtum der
Kreuzreliquie, welche in der Saison 2023 wegen Renovierung leider
geschlossen war.

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

III. Statio

S. Bernardus

Veronica reichet Jesus das Schweiß-Tuch

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

Kreuzweg des Stiftes Heiligenkreuz

VON DIESEM ERKER AUS GRÜSSTE UND SEGNETE PAPST BENEDIKT XVI.
AM 9.SEPTEMBER 2007 DIE GROSSE SCHAR DER PILGER

Cistercium Mater Nostra, Badener Tor des Stift Heiligenkreuz

Auf dem Platz vor dem Badener Tor des Stift Heiligenkreuz befindet sich die Sonnenreflexionsuhr
– das „Denkmal zur Gewissens- und Religionsfreiheit als Grundlage des
Friedens“. Sie wurde durch den Verein „Moderner Sakralbau“ errichtet
und im Jahr 2009 feierlich eröffnet. Seit der Auflösung des Vereins
2024 ist das Stift Heiligenkreuz mit der Verwaltung der
Sonnenreflexionsuhr betraut.
Lesen der Sonnenreflexionsuhr: Anders als bei klassischen Sonnenuhren
wird die Zeit nicht durch einen Schatten, sondern einen Lichtstreifen,
den ein Spiegel am Ende des Gnomons auf das Mosaik wirft, angezeigt.
Dieser schmale Lichtstreifen wandert im Gegensatz zu einem Schatten
nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Am oberen
und unteren Ende der Mosaikwand befinden sich Skalas die das Ablesen
der Zeit ermöglichen. Lediglich zu Mittag dient der Schatten des
Gnomons zur Anzeige der Zeit. Abhängig von der Tages- und Jahreszeit
und dem damit verbundenen Einstrahlungswinkel der Sonne, verlängert
oder verkürzt sich der reflektierte Lichtstreifen und ändert seine
Position. Unabhängig davon wird die Zeit auf der Skala aber immer
korrekt dargestellt.

Brücke über den Sattelbach
