web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Stift Klosterneuburg
der Augustiner-Chorherren, Februar 2023
Das Stift Klosterneuburg wurde vor über 900 Jahren
gegründet. Zahlreichen Geschichten rund um das Stift, den Babenberger Markgrafen Leopold III. der Heilige, Schatzkammer mit
Erzherzogshut und Marmorsaal, Stiftsmuseum, Stiftskirche, Kreuzgang,
Verduner Altar, Kaiserzimmer, Weinkeller des ältesten Weinguts
Österreichs sind besuchbar.

Binderstadl - Fassbinderwerkstatt um 1500 errichtet. Seit 1834
Aufstellungsort des Tausendeimerfasses, 1704 (Fasslrutschen).

Das Stift Klosterneuburg liegt nordwestlich von Wien in der Stadt
Klosterneuburg in Niederösterreich. Es gehört der Kongregation der
österreichischen Augustiner-Chorherren an. Der Komplex geht auf eine
Stiftung zu Beginn des 12. Jahrhunderts des österreichischen Markgrafen
Leopold III. dem Heiligen zusammen mit seiner Frau Markgräfin Agnes von
Waiblingen zurück.

Hochgotische Licht- bzw. Friedhofssäule und Pestsäule aus Zogelsdorfer
Sandstein
Tutzsäule, 14. Jahrhundert, 2. Hälfte
1381. Die Lichtsäule wurde von dem reichen Klosterneuburg Ritter
Michael Tutz nach einer in Klosterneuburg aufgetretenden Pest
gestiftet. Als Bildhauer wird der Baumeister Michael Knab (Chnab)
angenommen der auch die Spinnerin am Kreuz in Wien geschaffen hat. Die
Säule ist sogar mit Ablässen begabt, weil in ihr mehrere Reliquien
eingemauert sind.

Um die Gründung des Stiftes Klosterneuburg spinnt sich die
Schleier-Legende. Am Tag ihrer Vermählung sollen Markgraf Leopold III.
und seine Gemahlin Agnes von Waiblingen am Söller ihrer Burg am
Leopoldsberg gestanden haben, als ein plötzlicher Windstoß den
Brautschleier der Agnes erfasste und davontrug. Erst neun Jahre später
soll der fromme Markgraf den Schleier seiner Frau während einer Jagd in
den Wäldern Klosterneuburgs unerwartet wiedergefunden haben – in
unversehrtem Zustand auf einem blühenden Holunderbaum verfangen. Dies
soll als göttliches Zeichen verstanden worden sein, weshalb Leopold
III. an dieser Stelle ein Kloster errichten ließ. Zu einem späteren
Zeitpunkt wurde diese Legende noch zusätzlich durch eine
Marienerscheinung bereichert.

In Wirklichkeit aber stellte Klosterneuburg zu Beginn des 12.
Jahrhunderts keinen unberührten Urwald mehr dar, denn der Stiftshügel
war bereits seit urgeschichtlicher Zeit besiedelt und im 1. Jahrhundert
n. Chr. zu einem Kastell (vermutlich namens Arrianis) ausgebaut worden,
um den Limes Pannonicus zu schützen. Auf den Ruinen dieses Lagers
entstand wohl schon im 11. Jahrhundert eine kleinere Siedlung, die
Leopold III. schließlich als seine Residenz und 1114 für die Gründung
eines Säkularkanonikerstiftes erwählte.

1108 Urkundliche Erwähnung
eines Marienaltars in Neuburg im Zuge einer Schenkung Markgraf Leopolds
III.
1114 12. Juni Grundsteinlegung
für die Stiftskirche
1133 Leopold III. holt die
Augustiner Chorherren unter Propst Hartmann nach Klosterneuburg
1136 29. September Weihe der
Stiftskirche durch den Salzburger Erzbischof Konrad
1136 Siebenarmiger Leuchter,
Stiftung der Markgräfin Agnes in Verona aus Bronze gegossen, heute im
Brunnenhaus des Kreuzgangs
1136 15. November Leopold III.
stirbt (wahrscheinlich bei einem Jagdunfall)
1181 Fertigstellung des
Verduner Altars
1330 13. September großer
Stiftsbrand
1381 Errichtung der „Tutzsäule“
(Lichtsäule am Friedhof am Stiftsplatz)
1485 6. Jänner Heiligsprechung
Markgraf Leopolds III. durch Papst Innozenz VIII. in Rom
1489 Babenberger Stammbaum
(heute im Stiftsmuseum)
1506 15. Februar Erhebung
(Translatio) der Gebeine des hl. Leopold
1529 Erste Türkenbelagerung.
Die Chorherren flüchten nach Passau
1584 Prägung der ersten
Leopoldipfennige unter Propst Balthasar Polzmann
1616 15. November Erzherzog
Maximilian stiftet den Österreichischen Erzherzogshut und übergibt ihn
dem Stift Klosterneuburg
1634 Bis 1645. Erste Etappe der
Barockisierung der Stiftskirche
1642 Fertigstellung der
Barockorgel des Meisters Johannes Freundt
1663 Erhebung Leopolds zum
Landespatron
1680 Bis 1702. Zweite Etappe
der Barockisierung der Stiftskirche
1683 Zweite Türkenbelagerung.
Die Chorherren flüchten nach Ranshofen und Passau, nur Wilhelm Lebsafft
und Marzellin Ortner bleiben in Klosterneuburg.
1704 Errichtung des
Riesenfasses (heute im Binderstadl)
1714 Anschaffung der
Schleiermonstranz aus Anlass des 600 Jahr Jubiläums der
Grundsteinlegung der Kirche
1714 Die Chorherren tragen
statt eines weißen Talars einen schwarzen Talar
1723 Bis 1730. Dritte Etappe
der Barockisierung der Stiftskirche
1730 Bis 1740. Neubau des
Barockgebäudes unter Kaiser Karl VI. nach Plänen des Architekten Donato
Felice d’Allio nach dem Vorbild des spanischen Escorials
1774 Gründung des Stiftsmuseums
unter Propst Ambros Lorenz
1782 20. April Papst Pius VI.
besucht das Stift Klosterneuburg
1786 Entstehung des Ortes
Floridsdorf, benannt nach Propst Floridus Leeb
1796 Errichtung des
philosophisch-theologischen Hauslehranstalt
1799 Abbruch der Capella
speciosa am Stiftsplatz
1802 Der Albrechtsaltar kommt
in den Besitz des Stiftes Klosterneuburg (heute Sebastianikapelle)
1805 Bis 1806. Erste Besetzung
durch die Franzosen. 20. Dezember 1805 Besuch Napoleons
1809 Zweite Besetzung durch die
Franzosen
1813 Erste urkundliche
Erwähnung des Fasslrutschens
1819 Propst Gaudenzius schenkt
den Meidlingern Baugrund. Als Dank nannten sie es Gaudenzdorf. Später
wurde eine Straße in Dunklergasse umbenannt. Auch der Straßenzug
„Gaudenzdorfer Gürtel“ bewahrt seinen Namen.
1824 Propst Gaudenz Dunkler,
zählte zu den Gründungsvätern der „Wechselseitigen k.u.k.
privilegierten Brandschadenversicherung“, aus der der Wiener Städtische
Wechselseitige Versicherungsverein und in späterer Folge deren
Gesellschaften, die Wiener Städtische Versicherung bzw. die Vienna
Insurance Group hervorgegangen sind.
1860 Gründung der Weinbauschule
1908 Kunstausstellung, unter
anderem mit Beteiligung des bis dahin unbekannten Egon Schiele
1910 Errichtung der Abteilung
Kirchenmusik der k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst in
Klosterneuburg
1922 Gründung der
Volksliturgischen Bewegung durch Pius Parsch
1941 Bis 1945. Aufhebung des
Stiftes Klosterneuburg durch die Nationalsozialisten
2003 Inbetriebnahme des
Biomasse-Heizwerks
2006 Eröffnung der umgebauten
Sala terrena als neuer Besuchereingang
Die unvollendete Sala Terrena
in der Mitte des Osttraktes dient heute als Besucherempfang und bietet
einen interessanten Einblick in eine barocke Baustelle. Dieser Raum
sollte als eine Art Grotte oder Gartensaal ausgestaltet werden, für die
der kaiserliche Hofbildhauer Lorenzo Mattielli um 1735 die monumentalen
männlichen Trägerfiguren (Atlanten) schuf.

Das Stiftsmuseum zählt zu den ältesten Museen der Welt. Es wurde
bereits 1774 von Propst Ambros Lorenz (1772–1781) begründet und ist vor
allem für seine Sammlung mittelalterlicher Kunst bekannt. Zu den
wichtigsten Werken zählen der Verduner Altar, der sog. große
Albrechtsaltar (um 1438), Werke von Rueland Frueauf d. J. (um 1500),
sowie der Babenberger-Stammbaum (um 1490). Darüber hinaus beherbergt
das Museum bedeutende Beispiele gotischer Skulptur, etwa die berühmte
„Klosterneuburger Madonna“ (um 1300).
Totenkopfuhr - Paul Wahl, Augsburg, zwischen 1627 und 1639

Diptychon mit Szenen aus dem Leben Mariens, Paris, um 1320-1340

Anbetung der Könige, Niederlande (?), erstes Viertel 16. Jahrhundert

Reliquienmonstranz mit Partikel von der Dornenkrone Christi, Wien, um
1425/30

Die Legende berichtet, dass Markgraf Leopold III. das Stift
Klosterneuburg an jener Stelle gründete, an der er den bei der
Hochzeitsfeier durch einen Windstoß weggetragenen Schleier seiner Frau
Agnes wiederfand.
Der Babenberger Leopold errichtete Anfang des 12. Jahrhunderts seine
Residenz unweit der heutigen Stiftskirche in Klosterneuburg. Zu dieser
ließ er den Grundstein am 12. Juni 1114 legen. 1133 holte Leopold den
Orden der Augustiner Chorherren nach Klosterneuburg. Seitdem wirken die
Chorherren (mit Ausnahme weniger Jahre: 1941 bis 1945 war das Stift von
den Nationalsozialisten aufgehoben) hier und in den ihnen anvertrauten
Pfarren nach der Regel des heiligen Augustinus.
In einer bewegten Geschichte über neun Jahrhunderte entwickelte sich
das Stift Klosterneuburg zu einem religiösen, seelsorglichen,
wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum, das weit
über die Klostermauern in die ganze Welt zu strahlen vermag. Die fast
vierzig Chorherren, die heute zum Konvent zählen, und die vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarren und in den
Wirtschaftsbetrieben wollen dieses große Erbe gemeinsam in die Zukunft
tragen.

In der (seit 2011 zugänglich gemachten) Schatzkammer wird eine
besonders kostbare Auswahl an Elfenbeinarbeiten, Goldschmiedearbeiten
und Paramenten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert gesondert
präsentiert. Darunter befindet sich u. a. der Österreichische
Erzherzogshut, die sog. Schleiermonstranz (1714), sowie Objekte, die
mit dem heiligen Leopold in Verbindung gebracht werden. Eine
Besonderheit stellen auch die historischen Schatzkammerschränke dar,
die 1677 gefertigt wurden und in die Neugestaltung integriert wurden.
Kelch und Ziborium, Marek Hrbek, Prag, 1673

Sieg der Engel über die Teufel, Süditalien - Sizilien (Trapani?),
erstes Drittel 18. Jahrhundert
Das Jüngste Gericht, Süditalien - Sizilien (Trapani?), erstes Drittel
18. Jahrhundert

PASTORALE, Johann Caspar Holbein, 1723

Silberfiligranmodell der Alten Pestsäule am Graben in Wien, Wien, um
1679
Reliquienkapsel mit Porträt von Papst Innozenz XI., Römisch, 1680

Standkreuz und zwei Leuchter, Vermutlich Freiburg/Breisgau, 17.
Jahrhundert
Monstranz der Pfarre Korneuburg, Gerhard Cocksel, Wien 1759
Prunkmonstranz der Pfarre Langenzersdorf, Ludwig Schneider, Augsburg
1685-1687
Kelch, 1753
Kelch, 18. Jahrhundert
Pazifikalkreuz des Stiftsdechanten Leopold Hanauska, 1885
Erstkommunionkelch des Erzherzogs Wilhelm, Stefan Mayerhofer, Wien 1838
Kelch des Vicomte de Sartiges, 1898
Pazifikalkreuz des Propstes Gaudenz Dunkler, Josef Kern, Wien 1821
Kelch, 1730
Standkreuz, 17. Jahrhundert
Primizkelch des Chorherrn Ivo Langner, 1910
Rosenkranz mit Leopoldipfennigen, 18. Jahrhundert
Rosenkranz mit Bergkristall-Kreuz, 1592

Reliquiar des hl. Petrus Fourerius, Michael Gotthard Unterhueber, Wien
1735
Schleiermonstranz, Entwurf: Matthias Steinl (1644-1727), Ausführung:
Johann Baptist Känischbauer von Hohenried (1668-1739), 1710/15
Reliquiar der hl. Barbara, Michael Gotthard Unterhueber, Wien 1736

Der Österreichische Erzherzogshut
Dieser Schrank ist der historische Aufbewahrungsort des
Österreichischen Erzherzogshutes. Bis zur Gestaltung der neuen
Schatzkammer 2011 wurde der Tresor in seinem Inneren nur für besondere
Gäste geöffnet. Bis heute ist die Frage der Werkstatt, die den
Erzherzogshut hergestellt hat, nicht geklärt - nicht zuletzt deshalb,
weil es an geeigneten Vergleichsstücken fehlt. Maximilian berief
offensichtlich einen unbekannten Goldschmied an seinen Hof nach
Innsbruck, um das Kleinod unter seiner Aufsicht anzufertigen. Als
direktes Vorbild diente der ältere Tiroler Erzherzogshut, der in der
Wallfahrtskapelle Mariastein bei Kufstein verwahrt wird.

Sowohl die verarbeiteten Materialien als auch die Qualität der
Goldschmiedearbeit sind von allererstem Rang. Den Kern bildet eine
Samtkappe mit einer breiten, hochgeklappten Hermelin-Krempe. Die Bügel
besetzen zahlreiche Diamanten und genau 100 Perlen, an den Zacken
sitzen abwechselnd große Rubine und Smaragde. Den Hut bekrönt ein
ungewöhnlich großer und lupenreiner Saphir, der mit dem kleinen
Kreuzchen eine Art Reichsapfel bildet.

Pluviale und Infel vom Leopoldi-Ornat, Johann Jakob Ellmannsperger,
Wien 1729

Die Führung gibt einen einzigartigen Einblick in die über 900-jährige
Geschichte des Stiftes. Vom mittelalterlichen Teil des Hauses und dem
wohl wertvollsten Kunstschatz des Hauses, dem Verduner Altar, geht es
zur barocken Anlage mit den Kaiserzimmern und dem imposanten Marmorsaal.
Im ersten Obergeschoß des Osttraktes befinden sich die
Kaiserappartements, die über die gewaltige Kaiserstiege zugänglich
sind. Von hier aus gelangt man in den Marmorsaal, der im unteren
Bereich durch kolossale Säulen gegliedert wird. Das Deckenfresko die
Glorie des Hauses Österreich wurde 1749 von Daniel Gran gemalt. Es
verherrlicht die Majestät Österreichs und die einst in Österreich
regierenden Dynastien, d. h. Babenberger, Habsburger und das Haus
Habsburg-Lothringen. Der vollständige Titel lautet: Ehre, Ruhm und
Majestät des Hauses Österreich, im Babenbergischen Stamme angefangen,
im Habsburgischen Hause mehr erhöht und im Lotharingischen befestiget.

Die Große Stiftsführung führt über den mittelalterlichen Kreuzgang zum
Siebenarmigen Leuchter der Agnes aus dem 12. Jahrhundert und
anschließend in den Mittelalterschauraum mit herausragenden Kunstwerken
der österreichischen Hoch- und Spätgotik.
Deckenfresko im Marmorsaal von Daniel
Gran
Das Fresko zeigt mehrere Gruppen:
In der Mitte ein Obelisk mit der Darstellung des heiligen
Markgrafen Leopold III.
Allegorie die österreichische Majestät. Einer weiblichen Figur
als Allegorie der österreichischen Majestät (Maria Theresia
gleichzusetzen) werden die drei wichtigsten Kronen der Habsburger
präsentiert: die römisch-deutsche Kaiserkrone, die ungarische
Stephanskrone, und die böhmische Wenzelskrone.
Allegorie die österreichische Tapferkeit. Sie wird von Leopold V.
repräsentiert, der mit dem österreichischen Bindenschild über die
Türken triumphiert.
Allegorie die österreichische Klugheit und Standhaftigkeit. Die
Klugheit ist durch eine Frau mit der Schlange symbolisiert, während die
Standhaftigkeit mit einer Säule eine vielköpfige Hydra zerdrückt.
Die Vereinigung der Häuser Habsburg und Lothringen wird durch das
Herrscherpaar Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen
verkörpert.

NAPOLEONZIMMER (GROSSE
ANTECAMER)
Ein überraschender Besuch Napoleons im Stift fand am 20. Dezember 1805
statt, er dauerte aber nur eine halbe Stunde, der Grund dafür konnte
nie eruiert werden. Das gesamte Mobiliar ist im Empirestil gehalten,
auch der barocke Ofen wurde durch einen Empire-Kachelofen ersetzt, doch
das Zimmer wurde nicht für den Besuch Napoleons, sondern erst danach um
1810 eingerichtet. Einzig die Stuckdekoration der Decke stammt
unverändert aus der Zeit um 1735/40. An der Rückwand steht ein
vergoldeter Kinderschreibtisch, der aus dem Besitz des Herzogs von
Reichstadt, des Sohnes Napoleons, stammen soll.

In nördlicher Richtung schließen die Wohnräume Kaiser Karls VI. an, die
noch zu Lebzeiten des Kaisers fertiggestellt wurden. An der prunkvollen
Ausstattung waren neben d'Allio auch die Brüder Santino und Gaetano
Bussi beteiligt. Die Ikonografie der Ausstattung ist hierbei gänzlich
auf Karl VI. und sein Motto Constantia et Fortitudine („mit
Beständigkeit und Tapferkeit“) zugeschnitten. So stellen die
Kaminreliefs und der Deckenstuck verschiedene, dementsprechende
Allegorien und Tugenden dar. Im Tafelzimmer zeigt der Stuck
beispielsweise das „Gastmahl der Königin von Saba bei König Salomon“,
das neben der Raumfunktion auch auf die Klugheit des Kaisers anspielen
soll. Im selben Raum stechen darüber hinaus die Tapisserien aus der
Brüsseler Werkstatt des Urbain Leyniers heraus, die Szenen aus dem
Roman „Télémaque“ von François Fénelon zeigen. Allerdings verbrachte
Karl VI. in diesen Räumen nur eine einzige Nacht vom 14. auf den 15.
November 1739 – im nächsten Jahr war er bereits verstorben.

Das Audienzzimmer ist das
größte und offiziellste aller Kaiserzimmer. Der den Raum beherrschende
Thronbaldachin wurde, ebenso wie die Tapisserien im folgenden
Tafelzimmer 1736 aus dem Nachlass des Grafen Martinitz angekauft. Der
Baldachin besteht aus besonders kostbarem Seidenstoff mit Stickereien
im türkischen Stil und zeigt fantasievolle Fabelwesen und orientalisch
gekleidete Personen. Seine Datierung ist wie seine Herkunft umstritten.
Er wurde ursprünglich als Bettbaldachin verwendet und für die
Kaiserzimmer zum Thronbaldachin umgearbeitet. Als sich zeigte, dass die
Kaiserzimmer nicht mehr als Residenz verwendet werden würden, diente er
Jahrzehnte lang als Baldachin über dem Prälatensitz in der Stiftskirche.

Das gesamte Appartement weist zahlreiche Stuckreliefs auf, die Kaiser
Karl als Herrscher verherrlichen und seinen Anspruch auf Länder, die er
in Kriegen verloren hatte, darstellen sollen. Ein zentrales Element
dieses herrscherlichen Programms sind die beiden Tugenden aus dem
Wappenspruch der Kaisers CONSTANTIA ET FORTITUDINE. In diesem Raum
erscheinen die beiden als allegorische Figuren auf den Reliefs über den
Kaminen. Die Frau mit Schwert, die ihre Hand über eine Flammenschale
hält, gilt als Sinnbild für die „Beständigkeit" (Constantia), während
die gerüstete Dame als Zeichen für die „Tapferkeit" (Fortitudo) steht.
Zu ihren Füßen befinden sich Tiere, welche die Feinde des Kaiserreiches
symbolisieren.



DIE TAPISSERIEN DES TAFELZIMMERS
Das Tafelzimmer ist mit einer
Serie von Tapisserien aus der Werkstatt des Urbain Leyniers in Brüssel
ausgestattet. Sie zeigen Illustrationen zu dem Roman »Die Abenteuer des
Télémaque« von François Fénelon. Dass die Wandteppiche aus einem
Nachlass angekauft wurden und nicht ursprünglich für diesen Raum
bestimmt waren, erkennt man leicht daran, dass einer der Teppiche ums
Eck geschlagen werden musste und die Reihenfolge der einzelnen Szenen
nicht eingehalten werden konnte.

Wandteppiche gehörten zu den größten beweglichen Ausstattungsstücken in
Schlössern. Die Herstellung eines Quadratmeters dauerte drei bis vier
Monate und beschäftigte ein ganzes Heer von Handwerkern.





ECKZIMMER (Innerste Retirade)
Dies ist der innerste und privateste Raum des kaiserlichen Appartements
(Wohn- und Arbeitszimmer). Hinter einer Tapetentür ist eine kleine
Toilette versteckt. Der Stuckdekor dieses Raumes steckt voll
Anspielungen auf die angestrebte Weltherrschaft Karls VI. als König von
Spanien und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Im Deckenstuck erscheint sein Wahlspruch CONSTANTIA ET FORTITUDINE
sowie Putti mit zwei Säulen. Sie stehen für Beständigkeit (Constantia)
und Tapferkeit (Fortitudo), aber auch für die Säulen des Herkules, das
heißt die Strasse von Gibraltar - gleichgesetzt mit Spanien und den
Kolonien. Das Motiv der Säulen wurde bewusst von Karl V. übernommen, in
dessen Fußstapfen sich Karl VI. gerne gesehen hätte. In der Mitte der
Stuckdecke erblickt man die Weltkugel von Wolken umgeben, in den Ecken
vier Cäsarenbüsten, die vier Kontinente oder Weltreiche symbolisieren.
Auch über dem Kaminrelief befindet sich eine Cäsarenbüste. Unter den
Gemälden sticht ein großes repräsentatives Porträt Karls VI. in
spanischer Hoftracht hervor. Die weiteren Porträts stellen seine Frau
Elisabeth Christine, Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen
dar. An der Ostwand befindet sich ein Idealplan der gesamten Anlage des
Klosterpalastes von Josef Knapp, der erst 1779 nach Einstellung der
Bauarbeiten entstanden ist und wohl als Werbung für den Weiterbau
dienen sollte. Darüber hängt ein Porträt des italienischen Architekten
Donato Felice d'Allio (1677-1761), der für den gesamten barocken Bau
verantwortlich ist.



Idealansicht des barocken Stiftes von 1774, Stiftsmuseum Klosterneuburg



In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sollte die mittelalterliche
Klosteranlage des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg in einen
barocken österreichischen Escorial verwandelt werden. Die Idee für
diesen Sitz weltlicher und geistlicher Macht stammte von Kaiser Karl
VI, Vater Maria Theresias. Das Projekt konnte aber nicht zu Ende
geführt werden und blieb an vielen Stellen als einzigartige barocke
Baustelle erhalten.


Die Stiftskirche Mariä Geburt wurde 1114 vom Markgrafen Leopold III.
gestiftet und 1136 geweiht. Die ursprüngliche Kirche bildete eine
romanische dreischiffige Basilika mit Querhaus und unvollständigem
Westwerk. Im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert wurde die Kirche in
drei Etappen barock umgestaltet. Daran beteiligt waren hoch angesehene
Künstler wie Giovanni Battista Carlone, Pietro Maino Maderno, Peter
Strudel, Antonio Bellucci, Matthias Steinl, Johann Michael Rottmayr und
Santino Bussi. Berühmt ist auch die Orgel der Stiftskirche von 1642,
die von Johann Freundt aus Passau errichtet wurde und eines der
bedeutendsten Instrumente Österreichs ist.

Auf dem kunstvoll geschnitzte Chorgestühl, das nach Entwurf von
Matthias Steinl 1723/24 von mehreren Künstlern geschnitzt wurde, sind
auf den Rückenlehnen die Wappen aller habsburgischen Erblande
angebracht, als Symbol dafür, dass die Chorherren hier für alle Länder
beten. Über dem nördlichen Gestühl befindet sich das Kaiseroratorium,
der Platz für den Kaiser und seine Familie bei den alljährlichen
Feierlichkeiten zu Ehren des hl. Leopold am 15. November; ihm gegenüber
die Chororgel mit einem Prospekt aus dem Jahr 1780, in dessen Innerem
ein neues Werk steckt.

In der zweiten Barockisierungsphase von 1680 bis 1702 erhielt das
Langhaus eine hochbarocke Freskenausstattung von Johann Georg Greiner
und Stuckaturen von Domenico Piazzol.

Die Chororgel wurde ursprünglich vom Wiener Hoforgelbauer Anton
Pfliegler gebaut. Das Gehäuse gestaltete der Bildhauer Christoph
Helfer. Im Jahr 2005 wurde von der Firma Orgelbau Kuhn unter
Beibehaltung des Gehäuses eine neue Orgel installiert.

Die Stiftskirche Klosterneuburg des niederösterreichischen
Augustiner-Chorherren-Stiftes Klosterneuburg ist eine ehemalige
dreischiffige Basilika mit Querhaus und Vierungsturm. Im 17.
Jahrhundert wurde sie zu einer Abseiten-Saalkirche mit Seitenkapellen
umgebaut und erhielt um 1890 weitgehend ihr heutiges äußeres
Erscheinungsbild. Sie hat einen romanischen Ursprung mit gotischen
Ergänzungen und ist aufgrund einer barocken Innenausstattung, die
sämtliche Stilmerkmale von Früh- bis Spätbarock aufweist, von
besonderer kunsthistorischer Bedeutung.

Die Festorgel hat drei Manuale mit 35 Registern und 2179 Pfeifen.
Errichtet wurde sie in den Jahren 1636 bis 1642 und kam aus der
Werkstatt der Passauer Orgelbaufamilie Freundt. Das hohe dreiteilig
gestufte Gehäuse wurde von den Tischlern Jakob Kofler und Konrad
Schmidt angefertigt. Die Schnitzereien schufen Michael Schmidt, Georg
Gemelich und Max Preyer, wobei sie Verzierungen der Vorgängerorgel
wiederverwendeten. Das Instrument wurde 1984 und 1990 durch die
schweizerische Orgelbau Kuhn AG restauriert.
Die Festorgel ist die größte und bedeutendste Denkmalorgel des 17.
Jahrhunderts in Mitteleuropa. Das von internationalen Solisten gerne
bespielte Konzertinstrument zeichnet sich neben seinem hervorragenden
Klang unter anderem auch durch den Cornettton (a' = 476 Hz) und die
mitteltönige Stimmung aus.

In den sechs Seitenschiffkapellen befinden sich Marmorwandaltäre des
Linzer Bildhauer- und Brüderpaars Johann Baptist und Johann Peter Spaz,
hergestellt in den Jahren 1680–1702. Über diesen Altären verweisen
Altarbilder auf die entsprechende Altarwidmung.

Vom Kreuzgang geht die Führung in die Leopoldskapelle, der Grabstätte
des heiligen Leopold, in welcher der bedeutende Verduner Altar zu sehen
ist. Dieser gilt als ein Hauptwerk der mittelalterlichen Emailkunst.
1181 von Nikolaus von Verdun vollendet, gilt der Altar als ein weltweit
einzigartiges Werk in künstlerischer, technischer und inhaltlicher
Hinsicht. Die Führung endet in der Stiftskirche, welche besonders
durch die barocke Ausstattung, das Kaiseroratorium Karls VI. und die
original erhaltene Festorgel aus dem 17. Jahrhundert beeindruckt.

Der prunkvolle romanische Verduner Flügelaltar als Hochaltar wurde 1714 entfernt und
durch einen monumentalen, barocken, die Apsis einnehmenden, ersetzt.
Dieser wurde von dem Salzburger Steinmetz Sebastian Stumpfegger nach
einem Entwurf von Matthias Steinl aus verschiedenfarbigen Salzburger
Marmorarten um 1725 bis 1728 angefertigt. Das Altarbild von Johann
Georg Schmidt stellt die Marienverehrung dar, während die Figuren
linker und rechter Seite des Hochaltars, welche von dem Hofbildhauer
(Johann) Franz Caspar († 1728) angefertigt wurden, Bezug auf den
Stammbaum Jesu nehmen und somit gleichzeitig zum Evangelium des
Festtages von Mariä Geburt. Die figuralen biblischen Vorbilder sind:
König David mit der Harfe (Verweis Kirchenmusik)
Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern will (Sinnbild für das
Messopfer)
der mit einem Engel ringende Jakob (Verweis auf das Gebet) und
König Josaphat mit dem Gesetzbuch (Sinnbild für Regeltreue).
Weiters sind zwei Königsfiguren dargestellt, die im Evangelium des
Marien-Festtages vorkommen und als Vorbild für die Kaiser der Neuzeit
zu verstehen sind, da diese Figuren nur vom Kaiseroratorium aus zu
sehen sind: „Ezechias victoriosus“ (siegreicher Herrscher) und „Josias
zelosus“ (Eifer für das Gesetz Gottes).

Die romanische Grundstruktur der Stiftskirche ist trotz zahlreicher
Veränderungen bis heute erhalten geblieben. Die Kirche wurde 1114 bis
1136 als dreischiffige Basilika mit Querhaus und Vierungsturm
errichtet. Die Tatsache, dass es sich um den größten Kirchenbau im
damaligen Österreich handelte und die rasche Bauzeit, zeigen, wie
wichtig diese ehrgeizige Gründung für Leopold III. gewesen sein muss.

Das äußere Erscheinungsbild ist heute stark von der Restaurierung des
19. Jahrhunderts geprägt. Im Inneren ist der mittelalterliche Charakter
durch die durchgreifenden Barockisierungsmaßnahmen des 17. und 18.
Jahrhunderts gänzlich verloren gegangen. Aus der dreischiffigen
Basilika wurde eine Saalkirche mit Seitenkapellen.

Kunst des späten Mittelalters
Das Stift Klosterneuburg verfügt über eine der bedeutendsten
mitteleuropäischen Sammlungen gotischer Kunst des 14. und 15.
Jahrhunderts. Die Tafelbilder, Handschriften, Skulpturen und
Glasfenster gehörten zur ursprünglichen künstlerischen Ausstattung des
mittelalterlichen Stifts. Eine Blüte erlebte die Kunst im Stift vor
allem unter Propst Stefan von Sierndorf (1317-1335), in dessen Auftrag
unter anderem die Glasfenster des Kreuzgangs, der monumentale
Tafelaltar (Rückseite des Verduner Altars) sowie zahlreiche reich
geschmückte Handschriften entstanden. Der Propst ließ sich in vielen
dieser Kunstwerke als Stifter verewigen. Der Ausstellungsraum diente im
Mittelalter als Speisesaal der Chorherren, Refektorium genannt. Später
wurde er zum Versammlungsraum oder Kapitelsaal. Sein heutiges Aussehen
erhielt er im 17. Jahrhundert.


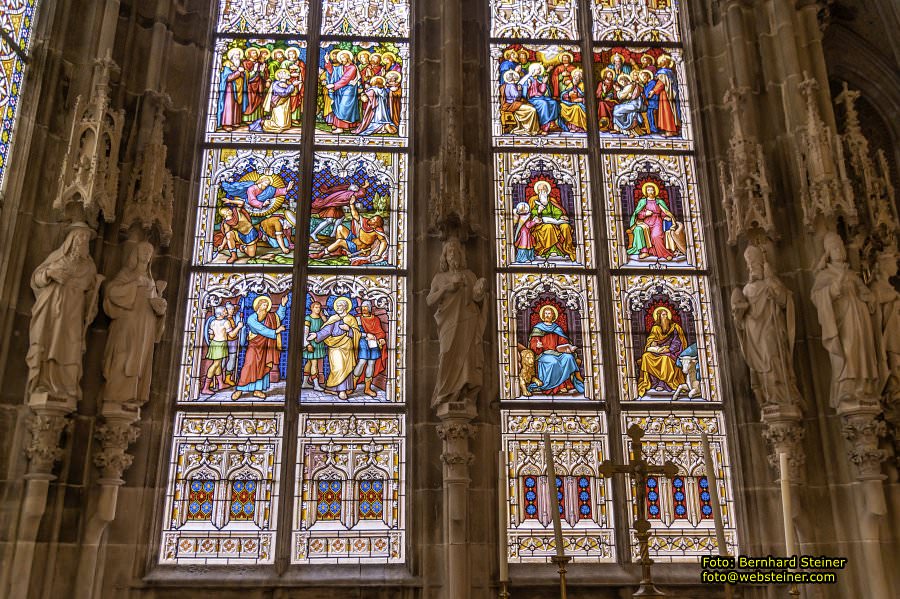

Das hochgotische Brunnenhaus
entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, nachdem ein
verheerender Brand die Erneuerung des Kreuzgangs notwendig gemacht
hatte. Der Brunnen stand in der Mitte des Raums und dürfte per Hand
befüllt worden sein, da weder Zu- noch Abfluss nachweisbar sind.
Vielleicht liegt darin der Grund, dass der Raum nur wenige Jahrzehnte
später als „Agneskapelle" eine neue Funktion erhalten hat. Heute werden
hier die verstorbenen Chorherren drei Tage lang aufgebahrt. Die
gotischen Glasfenster sind verloren gegangen. Die heutige Verglasung
des Brunnenhauses stammt aus dem späten 19. Jahrhundert.

Romanischer Leuchter
Der siebenarmige Bronzeleuchter stammt aus der romanischen
Stiftskirche, zu deren ursprünglicher Ausstattung er gehörte. Das
monumentale Werk entstand im frühen 12. Jahrhundert in Verona, in der
gleichen Gießerei, aus der auch die berühmten Bronzetüren der dortigen
Kirche S. Zeno kommen.
Die Form des Leuchters nimmt Bezug auf den biblischen Stammbaum
Christi, die so genannte Wurzel Jesse. Im Mittelalter setzte sich im
Volks-mund die Deutung als „Holunderbaum" durch. Das Innere des
„Stammes" barg Holzstücke, die von einem Holunderstrauch stammen
sollen. In ihm hatte sich laut Gründungslegende der Brautschleier von
Agnes, der Ehefrau Markgraf Leopolds III., verfangen. Tatsächlich
datieren die heute in der Schatzkammer des Stifts aufbewahrten
Holzstücke aus dem 17. Jahrhundert.
Der für derartige Leuchter übliche Bronzesockel mit reichem Schmuck ist
verloren gegangen.

Rückseiten des Verduner Altars,
Österreichischer Maler, Um 1330
Die vier gotischen Bilder gelten als das älteste monumentale Werk der
österreichischen Tafelmalerei. Die Szenen zeigen die Kreuzigung Jesu,
Ostermorgen und Noli me tangere sowie den Tod Mariens und ihre Krönung;
sie waren für die Rückseite des Verduner Altars bestimmt. Den Auftrag
für den Altar gab Propst Stefan von Sierndorf: 1330 beschädigte ein
Brand der Stiftskirche die aus vergoldeten Emailtafeln bestehende
Verkleidung der Kanzelbrüstung, die Nikolaus von Verdun 1181 für
Klosterneuburg angefertigt hatte. Auf Wunsch des Propstes sollte das
Emailkunstwerk in einen Flügelaltar umgeformt werden, der wohl vor dem
Triumphbogen der Kirche seinen Platz fand.
Ein als Meister der Rückseite des Verduner Altars bezeichneter
gotischer Maler hat um 1330/1331 die Bilder auf der Rückseite des
Altars geschaffen. Diese zählen zu den ältesten erhaltenen Beispielen
von Tafelmalerei nördlich der Alpen und wurden beim Umbau zu einem
Flügelaltar mit den Emailtafeln des Nikolaus von Verdun verbunden. Erst
im 20. Jahrhundert wurden sie aus konservatorischen Gründen wieder von
diesen getrennt. Auf dem Mittelteil ist links der Tod Mariens und
rechts die Krönung Mariens dargestellt. Auf dem linken Seitenflügel
findet sich die Darstellung der Kreuzigung Christi, auf welchem Propst
Stephan von Sierndorf auch sein Stifter-Porträt anbringen ließ. Der
rechte Seitenflügel zeigt die Auferstehung Christi, wobei die
Darstellungen der drei Marien am Grabe sowie die Noli me tangere-Szene
in ein Bild zusammengefasst wurden. Stilistisch sind die Malereien
sowohl französisch (Figurenkomposition, Faltenwurf) als auch
italienisch (architektonische Elemente, ikonografische Details)
beeinflusst.

Thronender Christus und Apostel
- Klosterneuburger Meister Ende 14. Jahrhundert, Holz, farbige Fassung
Diese ursprünglich dreizehnteilige Skulpturengruppe schmückte sehr
wahrscheinlich die Emporenbrüstung der Capella speciosa. Darauf
verweist die einzige erhaltene historische Innenansicht dieser
prachtvoll ausgestatteten Residenzkapelle Herzog Leopolds VI., die im
18. Jahrhundert abgebrochen wurde. Erst vor kurzem haben Restauratoren
den dicken weißen Anstrich des 19. Jahrhunderts entfernt und eine
mittelalterliche farbige Bemalung und Vergoldung zu Tage gebracht.

Mitteltafel eines Passionsaltars, Österreichischer Meister nach 1330
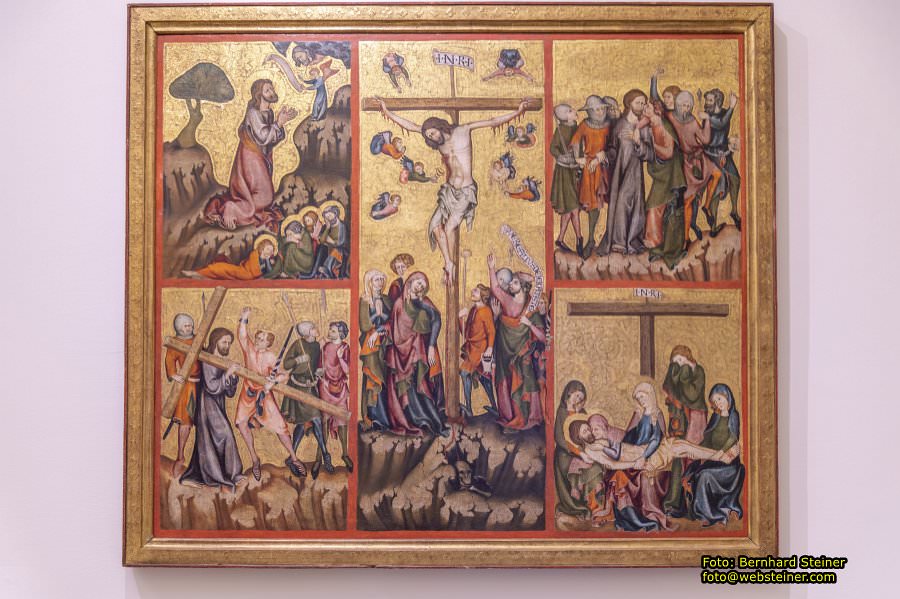
Große Klosterneuburger Madonna, Meister des Blanka-Grabes, Um 1300

Kaiser Maximilian I. Österreichischer Bildhauer (Hans Keb), datiert
1491, Vom Südturm der Stiftskirche

Im Zuge der Restaurierungsarbeiten 2005 wurden große Bereiche des
Kreuzgangs adaptiert, um die wertvollen Kunstschätze des Mittelalters
zeitgemäß zu präsentieren.



Leopoldskapelle
Markgraf Leopold III. bestimmte den Kapitelsaal des Stifts als
Grabstätte für sich und seine Familie, ein in dieser Zeit durchaus
übliches Vorgehen. Nach der Heiligsprechung Leopolds im Jahr 1485 wird
der Raum in eine Kapelle umgewidmet, die von 1677 bis 1680 ihre barocke
Ausstattung erhält. Die Grabstätte Leopolds und seiner Frau Agnes
befindet sich unterhalb des Altars, den Nikolaus von Verdun im 12.
Jahrhundert schuf und der 1833 seinen heutigen Platz erhielt. Die
Glaskuppel darüber errichtet wenige Jahre später Josef Kornhäusel. Nur
ein aus Schmiedeeisen gefertigtes Schutzgitter erinnert an den Ort, an
dem der silberne Reliquienschrein Leopolds ursprünglich präsentiert
wurde. 1810 wird dieser im Rahmen der Sanierung der stark zerrütteten
Staatsfinanzen eingeschmolzen.

Der Verduner Altar, auch
Klosterneuburger Altar genannt, wurde 1181 von Nikolaus von Verdun
gefertigt. Das Emailwerk, welches im Stift Klosterneuburg aufbewahrt
wird, stellt einen Höhepunkt der mittelalterlichen Goldschmiedekunst
dar, weist ein kompliziertes inhaltliches Programm auf und ist von
größter künstlerischer Bedeutung.

Bei dem ursprünglichen Werk des Nikolaus von Verdun handelte es sich
vermutlich um keinen Altar, sondern um eine Kanzelverkleidung in der
romanischen Stiftskirche von Klosterneuburg. Zu diesem Zweck wurden –
wohl über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren (1171–1181) – 45 Emailtafeln
(feuervergoldete Kupferplatten mit Grubenschmelz) angefertigt und auf
einem Holzträger befestigt. In Auftrag gegeben wurden die Tafeln durch
Propst Wernher (1168–1185), wie der Widmungsinschrift zu entnehmen ist.
Für das inhaltliche Konzept war aber wahrscheinlich sein Vorgänger,
Propst Rudiger (1167–1168) verantwortlich, welcher mit dem
Kirchenreformer Gerhoch von Reichersberg verwandt war und sich mit den
Schriften des Theologen Hugo von Saint-Victor beschäftigte.
Zu einem Altar wurden die Tafeln erst 1330/1331 zusammengesetzt. Nach
einem Brand 1330, welcher große Teile des Stiftes Klosterneuburg
zerstört hatte, ließ der damalige Propst, Stephan von Sierndorf
(1317–1335), die Tafeln nach Wien bringen, um sie zu einem Flügelaltar
umarbeiten zu lassen. Um das Schließen der Flügel zu ermöglichen, wurde
das Werk dabei durch sechs neue, stilistisch angeglichene Tafeln
ergänzt, so dass es nun insgesamt 51 Tafeln umfasst. Die Rückseiten des
Altars wurden indes mit vier großen Temperagemälden versehen.
Reliquienschrein mit den Gebeinen des heiligen Leopold

Das Programm ist in drei Reihen aufgebaut und zeigt Szenen aus dem
Alten Testament und Neuen Testament. Wie die Widmungsinschrift
erläutert, soll das Werk die große Bedeutung des Alten Testaments für
das Verständnis des Neuen Testaments verdeutlichen. Die Heilsgeschichte
wird hierbei in drei Zeitalter eingeteilt:
Ante legem – vor dem Gesetz (vor der Übergabe der 10 Gebote an
Mose)
Sub lege – unter dem Gesetz (nach der Übergabe der 10 Gebote an
Mose)
Sub gratia – unter der Gnade (Wirken Christi).
Das älteste Zeitalter vor dem Gesetz (d. h. Szenen aus dem Alten
Testament bis Mose), wird in der obersten Reihe gezeigt. Die Zeit unter
dem Gesetz (d. h. Szenen aus dem Alten Testament nach Mose) wird in der
untersten Reihe dargestellt. Dazwischen, in der mittleren Reihe, finden
sich schließlich Szenen aus dem Neuen Testament, also die Zeit unter
der Gnade.
Jeder Szene aus dem Neuen Testament werden darüber und darunter Szenen
aus dem Alten Testament gegenübergestellt, welche in gewisser Weise
bereits auf das Wirken Christi hinweisen. Die Annahme, dass die Szenen
aus dem Leben Jesu eine genaue Entsprechung in Ereignissen des Alten
Testaments finden, wird auch als Typologie bezeichnet. Daher gehören
immer drei Tafeln zusammen, wodurch eine Spalte gebildet wird.
Von den insgesamt 17 Spalten folgen 15 dieser Systematik – auch die im
14. Jahrhundert entstandenen Tafeln (8. und 10. Spalte). In den beiden
letzten Spalten des rechten Flügels (16. und 17. Spalte) wurde hingegen
noch im 12. Jahrhundert das typologische Programm verworfen.
Stattdessen kommt es zur Darstellung des Jüngsten Gerichts.
In künstlerischer und technischer Hinsicht stellt der Verduner Altar
ein absolutes Meisterstück dar. Stilistisch sind die Tafeln noch von
der byzantinischen Kunst beeinflusst, doch ist bei der Körperlichkeit
der Figuren ein starker Einfluss von antiken Vorbildern spürbar. Die
Figuren sind in Bewegung und anatomisch korrekt abgebildet. Zudem kommt
es zu einer für das 12. Jahrhundert ungewöhnlichen Andeutung von
emotionalen Regungen. Auch das sehr anspruchsvolle Verfahren der
Grubenschmelztechnik (Email champlevé) wurde hier von Nikolaus von
Verdun auf sehr hohem Niveau ausgeführt. Die Hintergründe sind zwar
überwiegend bläulich gehalten, dennoch nutzte der Künstler jede
Gelegenheit, um reizvolle Farbübergänge mit mehrfachen Schattierungen
zu schaffen. In der künstlerischen Qualität findet das Werk am ehesten
im Dreikönigenschrein in Köln eine Parallele.
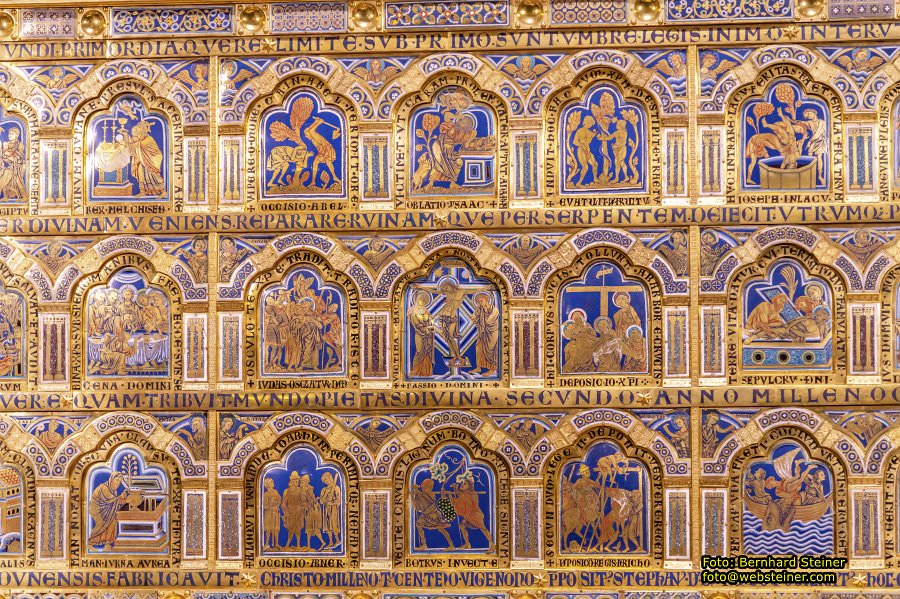
Glasfenster der Leopoldskapelle
In den Fenstern der Leopoldskapelle wurden 1836 die Reste der gotischen
Glasmalereien aus dem Kreuzgang (um 1330) und aus der Wehingerkapelle
(um 1400) zusammengefügt. Bemerkenswert sind die Rundscheiben mit
Porträts österreichischer Markgrafen bzw. Herzöge aus dem Geschlecht
der Babenberger. Eine der Glasscheiben zeigt die älteste bekannte
Darstellung des Fünf-Adler-Wappens, des heutigen Niederösterreichischen
Landeswappens. Auf ihr ist Herzog Heinrich II. Jasomirgott zu sehen,
der das Modell der Wiener Schottenkirche trägt.

Wandmalereien der Leopoldskapelle
Die Deckenfresken der Leopoldskapelle malte Johann Christoph Prandtl
von 1677 bis 1680. In den Feldern stellt er Tugenden und Wunder des
Heiligen Leopold so dar, wie sie Propst Adam Scharrer 1670 in seinem
Buch „Österreichische Marg-Graffen“ beschreibt. Scharrer bezieht sich
auf die Heiligsprechungsakten. An der Eingangswand konnten um 1980 zwei
große Freskenfelder aus dem 18. Jahrhundert freigelegt werden. Sie
zeigen den Aufbruch des hl. Leopold zur Jagd und den Bau der
Stiftskirche.
DECKENFRESKEN - Johann Christoph Prandtl, 1677 - 78
Die heute insgesamt 38 Felder füllen-den Fresken bestehen aus zwei
Zyklen, die sich auf den hl. Leopold beziehen. Die vier äußeren Joche
sind mit allegorischen Darstellungen gefüllt, die vier (heute nur mehr
drei) inneren Joche mit Darstellungen von Wundern, die auf Anrufung des
hl. Leopold geschahen. Die Themen schöpfte der Maler aus dem 1670
erschienenen Buch von Adam Scharrer.


Leopoldihof





AUGUSTINER-CHORHERREN HEUTE
Nach der Ordensregel des heiligen Augustinus führen die Chorherren ein
sowohl kontemplatives als auch aktives Leben. Das Klosterleben
manifestiert sich so in der gemeinsamen liturgischen Feier der hl.
Messe und dem Chorgebet (drei mal am Tag), und in den pastoralen
Tätigkeiten der Chorherren, hauptsächlich in der Seelsorge in über 20
Pfarren in Österreich, Norwegen und den USA. Die Ordenstracht (der
Habit) der Klosterneuburger Chorherren besteht aus einem schwarzen
Talar und einem weißen Leinenstreifen, dem so genannten Sarozium
(volkstümlich: Sarockel). Dieses hat sich aus dem weißen Chorhemd
entwickelt, das im Lauf der Jahrhunderte immer weiter reduziert wurde,
bis nur ein schmaler Streifen übrig blieb. Traditioneller Weise
erhalten die Novizen das Ordensgewand bei der Einkleidungszeremonie am
27. August, dem Tag vor dem Festtag des heiligen Ordensvaters
Augustinus. Bei gegebener Zustimmung durch das Plenarkapitel legen sie
ein Jahr darauf am 28. August die Einfachen Gelübde ab, nach drei
Jahren die Ewige Profess.

Das barocke Stift sollte ab 1730 nach Plänen von Donato Felice d’Allio
und Joseph Emanuel Fischer von Erlach als Klosterresidenz für Kaiser
Karl VI. monumental ausgebaut werden. Als der Kaiser jedoch 1740
unerwartet starb, kam es zu einem abrupten Baustopp. Zu diesem
Zeitpunkt war nur ein Achtel der geplanten Anlage errichtet worden.
Erst 1834–1842 konnte einer der begonnenen Höfe (sog. Kaiserhof) nach
Plänen von Joseph Kornhäusel fertiggestellt werden, wodurch zumindest
ein Viertel des geplanten „österreichischen Escorials“ fertig wurde.
Barocker Kaisertrakt

Die äußeren Fassaden haben typisch barocken Charakter und sind reich
gegliedert – besonders die Ostfassade. Deren ursprünglich als
Gebäudemitte geplanter Bereich schwingt sich konvex nach vorne und
nimmt einen vorgeblendeten Balkon, monumentale Säulen und eine riesige
Kuppel mit der Reichskrone auf. Die zweite, über dem nordöstlichen
Eckpavillon angebrachte Kuppel zeigt hingegen den Österreichischen
Erzherzogshut.
Stift Klosterneuburg, Detail der Ostfassade

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Mariensäule, 18. Jahrhundert, 2. Hälfte, Errichtet 1756 von Mathias
Kögler
Mariensäule aus Sandstein, Sockel gemauert, Teile vergoldet und mit
Marmorplatten verziert

Rathausplatz / Albrechtsbergergasse, 3400 Klosterneuburg

Hl. Nepomuk, 18. Jahrhundert, 1. Hälfte, Sandsteinfigur
1720 im Auftrag des Augustinerordens gefertigt.

Kierlingbach




Bahnstation Klosterneuburg-Kierling

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: