web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Sankt Veit an der Glan
ehem. Landeshauptstadt von Kärnten, November 2024
St. Veit an der Glan ist eine Stadtgemeinde mit über 12.000 Einwohnern und entstand am Schnittpunkt alter Verkehrswege. Die Stadt war bis 1518 Landeshauptstadt von Kärnten und ist Sitz der Bezirkshauptmannschaft des Politischen Bezirks St. Veit an der Glan.
Der Hauptbahnhof ist ein von Hans Granichstaedten in den Jahren 1911
bis 1913 errichtetes langgestrecktes, ein- bis zweigeschoßiges Bauwerk
im späthistorischen Stil. Das repräsentativ gestaltete
Abfertigungsgebäude weist ein steiles, zur Hauptschauseite ausgebautes
Dach mit Ziergiebel und vorspringendem Glockenturm mit Ziergesims und
oktogonalem Laternenaufsatz auf. Die Bahnsteige in Eisenkonstruktion
stammen aus der Bauzeit.

Friesacherstraße 16

Denkmal für Friedrich Schiller vor der Volksschule am Schillerplatz

Kunsthotel Fuchspalast

Der Ernst Fuchs-Palast ist ein von Ernst Fuchs gestaltetes, kontroversiell beurteiltes Hotelgebäude.

Die Altstadt mit Ausmaßen von etwa 380 × 200 m ist von der weitgehend
erhaltenen Stadtmauer umgeben. Die Häuser in der Altstadt haben nahezu
durchwegs mittelalterliche Baukerne; viele der Bürgerhäuser um die
beiden Stadtplätze weisen Arkadenhöfe auf.

Schüsselbrunnen

Pestsäule

Rathaus St. Veit/Glan

Auf dem etwa 200 auf 30 m großen Hauptplatz befinden sich das
spätgotische Rathaus (ein dreigeschoßiger, sechsachsiger, Bau mit
Kielbogenportal, aufwändig gestalteter Fassade und Arkadenhof), eine
Pestsäule (1715/16) und zwei Brunnen (Vogelweide-Brunnen und
Schüsselbrunnen).

Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)
Die katholische Pfarrkirche, erstmals 1131 urkundlich erwähnt, ist eine
große, in ihren Grundzügen spätromanische und in ihrer heutigen Gestalt
spätgotische Chorturmkirche. Die heutige Außenansicht geht auf eine
grundlegende Wiederherstellung nach einem Brand im Jahr 1829 zurück. An
der Westwand befinden sich mehrere Grabdenkmäler aus dem 15. bis 18.
Jahrhundert.

Die Kreuzrippen- bzw. Sterngewölbe des nördlichen Seitenschiffes ruhen
auf kräftigen halbrunden Wandvorlagen. Ein Schlussstein ist mit 1441
bezeichnet. Im südlichen Seitenschiff stammt das Kreuzgratgewölbe in
den beiden westlichen Jochen aus dem 15. Jahrhundert, das
Kreuzgratgewölbe in den drei östlichen Jochen musste nach dem Brand von
1829 neu errichtet werden. Wegen des Sakristeianbaus wurde schon vor
1406 die Apsis des südlichen Seitenschiffes abgetragen. 1959 wurden
hinter dem Florianialtar die Ansätze mit den Kelchkapitellen der aus
dem 12. Jahrhundert stammenden flankierenden Säulchen entdeckt. Unter
der spätgotischen Orgelempore von 1426 spannt sich ein
Kreuzrippengewölbe über gedrungenen halbrunden Diensten. Die
geschwungene Brüstung der Orgelempore wurde in der Barockzeit
hinzugefügt. Die Emporenöffnungen über den Seitenschiffen wurden mit
Ausnahme der beiden westlichen Joche bei der letzten Restaurierung
zugemauert.

Der heutige Hochaltar, der 1752
von Johann Pacher geschaffen wurde, stand vor seiner Restaurierung als
Frauenaltar in der nördlichen Seitenkapelle. Den Mittelpunkt des
Baldachinaltars mit Opfergangsportalen bildet eine Mutter Gottes mit
Jesuskind, das den knienden Heiligen Katharina von Siena und Dominikus
den Rosenkranz überreicht. Den bekrönenden Abschluss bildet ein
Marienmonogramm im Wolken- und Strahlenkranz.
Vom ursprünglichen Hochaltar, der 1769 auch von Johann Pacher
geschaffen wurde, sind nur mehr das Antependium und die Statue der
Schmerzensmutter in der Österreichischen Galerie vorhanden.

Die Kanzel stand ursprünglich
in der ehemaligen Klosterkirche und wurde erst 1959 hierher übertragen.
Auch die 1734 urkundlich erwähnte Kanzel wird Johann Pacher
zugeschrieben. Am Kanzelkorb sitzen die vier Evangelisten. Die Felder
zwischen den Nischen sind mit Gitter-, Laubwerk- und
Bandelwerkornamentik geschmückt. Im mittleren Feld ist ein IHS-Zeichen
zu finden. Die Volutenpilaster am Schalldeckel tragen als Bekrönung die
stehende Figur des Christus Salvator Mundi.
Das Orgelprospekt und das Rückpositiv in reich geschnitzter Brüstung
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden 1977 restauriert.

Das achteckige Taufbecken stammt aus dem 15., die Weihwasserbecken aus dem 16. und 18. Jahrhundert.

Fenster in der Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)
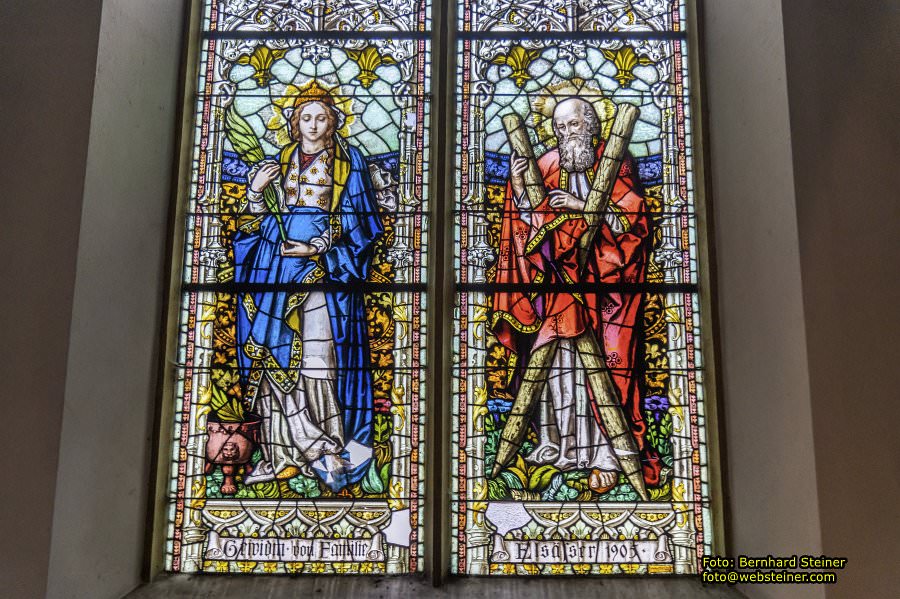
Der Florianialtar im südlichen
Seitenschiff wurde von Johann Pacher gefertigt und nach dem Brand von
1829 erneuert. Das Altarblatt von 1747 zeigt den heiligen Florian, der
die brennende Stadt Sankt Veit löscht. Kulturhistorisch interessant ist
die historische Ansicht der Stadtpfarrkirche, der Kirche zu den zwölf
Boten, der Vierzehn-Nothelfer-Kirche, die beide abgetragen wurden, und
der damals noch intakten Stadtmauer. Das Altarbild wird von den Statuen
der beiden Pestheiligen Sebastian und Rochus flankiert. Das Aufsatzbild
zeigt den heiligen Vitus mit Ölkessel und Märtyrerpalme, daneben stehen
die Skulpturen der Heiligen Barbara und Katharina.

Der Karner Hl. Michael südlich der Stadtpfarrkirche am ehemaligen
Friedhof ist im Kern ein romanischer Rundbau des 13. Jahrhunderts
(urkundlich 1275 und 1359 genannt) und wurde früher als Beinhaus
verwendet. Seit 1930 dient er als Kriegergedächtnisstätte.

Pfarrkirche Sankt Veit an der Glan (Hl. Vitus und Hl. Dreifaltigkeit)

Herzog Bernhard Platz in St. Veit an der Glan

Feuerwehrtor in der Stadtmauer

1131 Erste urkundliche Erwähnung von St. Veit
1981 Anlässlich des 850 Jahre-Jubiläums der Stadt
gewidmet vom Verschönerungsverein St. Veit a.d. Glan
Denkmal vor dem BÜM St Veit an der Glan - Betreuen Üben Miteinander

St.Veit/Glan Bahnhof
Die Trassenführung der Rudolfsbahn wurde 1912 im Raum St. Veit
geändert. Ab 1912 fuhren die Züge aus Richtung Friesach bzw. Hüttenberg
auf neuer Trasse von Nordosten her in den um diese Zeit errichteten
jetzigen St. Veiter Hauptbahnhof ein, danach teilte sich die Strecke:
einerseits in Richtung Süden über Glandorf nach Klagenfurt,
andererseits in Richtung Westen über den alten St. Veiter Bahnhof (nun
„Westbahnhof“ genannt) nach Feldkirchen. Die Bahnsteigüberdachungen
ruhen auf markanten gusseisernen Konstruktionen. Durch eine
Unterführung (Personentunnel) sind die Bahnsteige zu erreichen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: