web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Thonetschlössl
Museum Mödling, April 2023
Museum mit Mödling-Bezug: Von der Urzeit bis zur Neuzeit, Römer in der Thermenregion, Goten, Langobarden, Awaren, Mittelalter, Markterhebung Mödling, Biedermeier, Neuzeit, Stadterhebung, Stadtentwicklung. Zusätzlich Uhrensammlung, medizinhistorische Hyrtl-Bibliothek, Gräfin Mitsuko Coudenhove-Kalergi, geologische Abteilung.

Das Gebäude in dem sich das Museum Mödling befindet, geht im Kern auf
das 1631 vom damaligen Kanzler Österreichs unter der Enns, Johann
Baptist Verda von Verdenberg, gegründete Kapuzinerkloster zurück. 1785
wurde das Kloster unter Kaiser Joseph II. aufgehoben. Danach erlebte
das Haus vielfältige Nutzungen bis es 1965 zur Heimstätte des Museums
Mödling wurde. Das Haus wird auch „Thonetschlössl" genannt, dieser Name
geht auf den Umbau und die Nutzung des Hauses durch den
Großindustriellen Jakob Thonet Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Die
Geschichte des Hauses erzählt gleichzeitig die Geschichte des Marktes
Mödling: Die der Refomation, der Gegenreformation, der Türkennot 1683,
der ersten Industrialisierung oder die der Herrschaft Liechtenstein.
Auch das Leben der Juden in Mödling wird dokumentiert.

Das Museum dokumentiert die Entstehung der Mödlinger Landschaft, zeigt
Gesteine und Fossilien; Urgeschichte, weist auch eine der ersten
Awarensammlungen Österreichs auf. Historisches, wie das Schicksal
Mödlings in den Türkenkriegen, wird ebenso dokumentiert wie die
Biographien berühmter Bewohner der Stadt, etwa von Mitsuko
Coudenhove-Kalergi oder jene des Anatomen Josef Hyrtl.

Lithographiestein mit dem das Porträt Josef Schöffels gedruckt wurde.

Areal der Hyrtischen Waisenanstalt heute

Hyrtlbibliothek – Hyrtlarchiv – Hyrtlforschung
Eine eigenständige Sammlung stellt die historisch-medizinische
Privatbibliothek des berühmten Anatomen Professor Dr. Joseph Hyrtl
(1810–1894) dar. In einem schönen Raum im 1. Stock des Thonetschlössl
mit einem kunstvoll gearbeiteten Intarsien-Fußboden werden die
Bibliothek und das Lebenswerk des Anatomen Hyrtl gezeigt. Die
Bibliothek umspannt den Zeitraum vom Ende des 15. bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts. Die ältesten Werke stammen aus einer Zeit kurz nach
Erfindung des Buchdruckes. Viele der hauptsächlich anatomischen Werke
sind aus wissenschaftlicher und künstlerischer Sicht seltene
Kleinodien. Die hohe medizinische Wissenschaft bediente sich für die
Herausgabe solcher Prachtwerke schon immer der besten Künstler und
Kupferstecher, sodass jede einzelne Seite eine echte Kostbarkeit
darstellt.
Joseph Hyrtl, der 1810 in Eisenstadt geboren worden war, rückte nach
seinem Medizinstudium rasch an die Spitze der anatomischen
Wissenschaft. Als überaus beliebter Lehrer an der Prager und Wiener
Universität und als mitreißender Redner faszinierte er die Studenten.
Durch seine zahlreichen Publikationen und seine medizintechnischen
Entwicklungen wurde er weltbekannt. Hyrtl war der erste, der die
Bedeutung des Faches Anatomie für die medizinische Praxis erkannte und
dieses mit der Chirurgie verband. Eigene sensationelle operative
Eingriffe, wie etwa zur Beseitigung des Schielens, waren die Folge.
Sein "Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit Rücksicht auf
physiologische Begründung und praktische Anwendung" wurde in zahlreiche
Sprachen übersetzt und stellte mit zwanzig Auflagen (1847–1888) ein
Standardwerk des Faches Anatomie in der ganzen Welt dar. Seine
exzellenten makroskopischen und mikroskopischen Präparate menschlicher
oder tierischer Organe und Gewebe, die auf verschiedenen
Weltausstellungen gezeigt und in alle Welt verkauft wurden, machten ihn
zu einer Berühmtheit. Eine Spezialität Hyrtls waren sogenannte
Korrosionspräparate. Bei ihnen wurden in die Gefäße oder Hohlräume eine
aushärtende, gefärbte Masse eingespritzt, und nach dem Härten der
Füllung das organische Gewebe weggeätzt. Die fertigen Präparate zeigen
eine Ansicht der inneren Hohlraumstruktur, die sonst nicht in ihrer
Gesamtheit erkennbar ist. Einige dieser Präparate sind in der Hyrtl-
Bibliothek ausgestellt; sie stellen in unserem Land ausgesprochene
Raritäten dar.
Prof. Dr. Joseph Hyrtl (1810-1894)

Uhrensammlung
Zu sehen sind zahlreiche historische Uhren, aus der Zeit Anfang 18. bis
Anfang 20. Jahrhundert, fachgerecht restauriert von em.Univ.-Prof. Dr.
Ferdinand Stangler †
Weltuhr, Sonnenuhr, Empireuhr

ALABASTERUHR, ca. 1800
Das Holzgehäuse ist im Renaissancestil mit viel Alabaster geschmückt,
der vielfach gebrochen war und erst geklebt werden musste. Der oben
liegende Ritter besteht aus zehn Teilstücken, von denen zwei ergänzt
werden mussten. Hauptfundstelle von Alabaster ist die Toskana. Herzöge
aus dem Haus Habsburg haben durch Export von Alabasterartikeln viel für
das Land getan. Die Uhr besitzt ein federbetriebenes Ankerwerk mit
Pendel. Vierviertel-Schlag auf Klangfedern.

Teile des Museums stammen aus der paläontologische Privatsammlung des
Heimatforschers Oskar Spiegel. Sie wurde mit Unterstützung des Bundes
und des Landes Niederösterreich sowie der Stadt Mödling für das Museum
angeschafft.

Schwerpunkt der frühgeschichtlichen Abteilung ist das Fundgut des großen awarenzeitlichen Friedhofs.
Besonders wertvolle Grabbeigaben sind die awarischen Prunkgürtel. Diese
Würdezeichen ranghoher Männer waren mit kunstvollem Metallzierrat
geschmückt. In den Männergräbern fand man verschiedenste Waffen,
darunter auch Reste von awarischen Reflexbögen, den gefürchteten Waffen
des Reitervolkes der Awaren. In den Frauengräbern gab es Diademe,
Perlenketten, präzise gearbeitete Knochenkämme, Ohr- und Fingerringe
aus Bronze, Silber und Gold sowie Mantelverschlussscheiben. Ein
sensationeller Fund, der ein überaus wertvolles, einmaliges
historisches Dokument darstellt, ist ein Paar scheibenförmiger
Gewandschließen mit der einzigen authentischen Darstellung eines
awarischen Bogenschützen auf der vergoldeten Vorderseite.
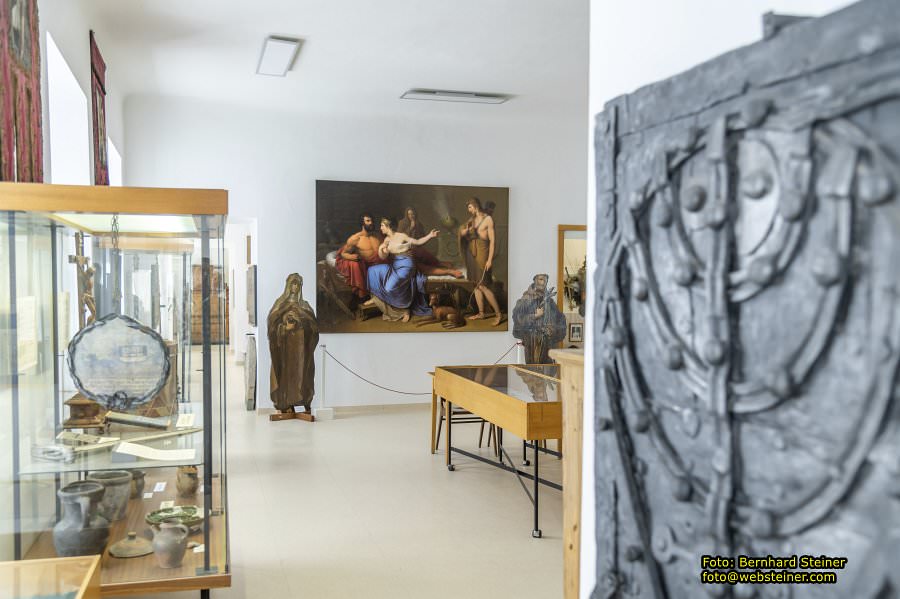
Römerzeit
In den Jahren 14. -12. v. Chr. unterwarfen die Römer Pannonien und
damit gelangte auch unser Gebiet unter die römische Herrschaft, die
erst im 5. Jahrhundert zu Ende ging. In diesem Gebiet sind Funde aus
römischer Zeit aufgetaucht. Man kann annehmen, dass den Römern die
warmen Quellen entlang der Thermenlinie bekannt waren. Im Museum
ausgestellt sind Grabsteine, Keramik und Münzen. Verschiedene
Öllämpchen von der einfachen römischen Grundform über eine Doppellampe
hin bis zu einer frühchristlichen Lampe mit dem Kreuz als
Christusmotiv. Nach der friedlichen Besetzungdes keltischen Noricum 15
v. Chr. folgte in den Jahren 14 –12 die Unterwerfung Pannoniens durch
die Römer. Es gehörte zuerst zu Noricum, dann zu Oberpannonien.
Vindobona und Carnuntum waren römische Veteranensiedlungen und
Ausgangspunkte weiterer Romanisierung.
Goten
Vom Ende des 4. Jahrhunderts bis zur Christianisierung durch Karl den
Großen um 800 n. Chr. reicht in unserem Gebiet die Zeit der
"Völkerwanderung". Aus dem Anfang des 5. Jhd. stammen zwei Gräber in
Mödling. Große Bernsteinperlen, Metallschmuck, ein gläserner Kumpf, ein
Glasbecher mit Fadenauflage und eine bauchige Flasche, sowie
verschiedene Tongefäße ermöglichen eine Zuordnung zum Volk der Goten
aus dem Schwarzmeergebiet.
Langobarden
Einige Jahrzehnte, nämlich 526 bis 586, hielten sich in unserem Gebiet
die Langobarden auf. Dieser germanische Volksstamm kam aus Skandinavien
und zog später nach Norditalien. Durch einen glücklichen Zufallsfund
wurden in der Nähe der Weißes-Kreuz-Gasse in Mödling sieben unversehrte
Langobardengräber entdeckt. In der Regel legten die Langobarden keine
größeren Friedhöfe an, sondern bevorzugten verstreut liegende
Bestattungen. Obwohl diese für Plünderer schwer auffindbar waren,
wurden sie wegen ihrer reichen Beigaben oft ausgeraubt. Die Mödlinger
Gräber enthielten aber zu Freude der Wissenschafter sehr gut erhaltene
Waffen und prächtigen Schmuck, darunter ein Langschwert, schöne
Perlenketten, Fibeln mit Glaseinlagen und vergoldete, niellierte
Bügelfibeln.
Awaren
Schwerpunkt der frühgeschichtlichen Abteilung ist das Fundgut des
großen awarenzeitlichen Friedhofs "An der goldenen Stiege" , das 1968 -
1975 aus rund 500 Körpergräbern geborgen werden konnte. Etwa 4000
Beigaben ermöglichen aufgrund ihrer typischen Verarbeitung und Form
eine Datierung von der Mitte des 7. bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts.
Bauarbeiter hatten beim Neubau von Einfamilienhäusern am Fuße des
Frauensteins menschliche Knochen gefunden und das Museum Mödling
verständigt. Vom Bundesdenkmalamt wurde dem Museum die
Bergungsgenehmigung erteilt. Besonders wertvolle Grabbeigaben sind die
rund 40 awarischen Prunkgürtel. Diese Würdezeichen ranghoher Männer
waren mit kunstvollem Metallzierrat geschmückt. Anfangs waren diese in
Presstechnik aus Blech hergestellt, später wurden sie aus massivem
Bronzeguss erzeugt. Unter den vielfältigen Verzierungen taucht häufig
die Gestalt des "Greifs" auf. Gegen Ende der awarischen
Kunstentwicklung erhielten die Gürtelbeschläge eine runde Form. In den
Männergräbern fand man verschiedenste Waffen, darunter auch Reste von
awarischen Reflexbögen, den gefürchteten Waffen des Reitervolkes der
Awaren. In den Frauengräbern gab es Diademe, Perlenketten, präzise
gearbeitete Knochenkämme, Ohr- und Fingerringe aus Bronze, Silber und
Gold sowie Mantelverschlussscheiben. Ein sensationeller Fund, der ein
überaus wertvolles, einmaliges historisches Dokument darstellt, ist ein
Paar scheibenförmiger Gewandschließen mit der authentischen Darstellung
eines awarischen Bogenschützen auf der vergoldeten Vorderseite. Diese
Darstellung war auch Leitbild der Awarenausstellung 1977, die mehr als
25.000 Besucher nach Mödling lockte und Mödling und das Museum Mödling
international bekannt machte.

Babenberger
Mit dem dritten Feldzug Karls des Großen, des Königs der Franken und
Langobarden, im Jahr 803 kam es zum endgültigen Sieg über die Awaren
und zum Einsetzen der bayrisch-fränkischen Besiedlung. Von der Existenz
Mödlings berichtet erstmals eine Urkunde aus den Jahr 903, in der ein
Besitz bei „medilihha” genannt wird. Sprachforscher haben in diesem
Namen eine slawische Wurzel gefunden: „medilihha” ist die Bezeichnung
für ein langsam rinnendes Gewässer. Der Name wurde später von Medelikch
und Medling zu Mödling abgewandelt. Nach mehreren magyarischen
Einfällen war Niederösterreich im 10. Jhd. jahrzehntelang in
ungarischem Besitz. Nach der Rückeroberung des Gebietes wurde unser
Land wieder Eigentum des Königs. Die Babenberger, ein ostfränkisches
Adelsgeschlecht hatten durch eine Schenkung aus dem Jahr 1002 ein
Gebiet in der Nähe von Mödling erhalten. Zu Beginn des 12. Jhd. kam die
Mödlinger Hausberganlage in den Besitz der babenbergischen
Landesfürsten. Das Angerdorf Mödling wurde auf das Doppelte vergrößert,
und die Hausberganlage wurde in eine Wehrkirchenanlage umgestaltet. Die
eigentliche Burg Mödling wurde auf einer Erhebung im Klausental neu
errichtet.
Besiedelung
Nach mehreren Jahrhunderten scheinbar ungerichteter Wanderbewegung
waren in Mitteleuropa "Völker" entstanden, die mehr oder weniger
deutlich begrenzte Gebiete besiedelt hatten. Es gab Bauern, Handwerker,
Adelige und Kaufleute. Zum Schutz der Siedlungen wurden Wehrkirchen und
Burgen errichtet, und die Klöster stellten Zentren der Kultur und
Zivilisation dar. Im 12. Jahrhundert wurde das Kloster Heiligenkreuz
gegründet, und Burgstädte wie Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha und
Eggenburg entstanden. Auf alte Dorfsiedlungen dagegen gehen heutige
Städte wie z. B. Baden und St. Pölten zurück. Für die Bauformen des
romanischen Stils sei als Beispiel der Mödlinger Karner genannt. Vor
1443 bauten die Mödlinger die spätgotische Spitalkirche vielleicht als
vorübergehenden Ersatz für den zum Abbruch bestimmten großen
frühgotischen Bau am Platz der Othmarkirche. Aus dem späten Mittelalter
stammt die St. Othmarkirche in Mödling, die ab 1454 im gotischen Stil
dort gebaut wurde, wo in neuerer Zeit Vorgängerbauten (romanisch,
frühgotisch) nachgewiesen werden konnten. Im 15. Jahrhundert wurden
auch zahlreiche Bürgerhäuser in Mödling errichtet.
Markt Mödling
Ab 1343 hatte der Ort Mödling nach und nach Gewerberechte erworben, die
sich auch auf Dörfer des Umlandes erstreckten. (Bau einer Schranne, d.
h. eines Markthauses), 1458 fand die Verleihung des Wappens durch den
Landesfürsten statt. Das Marktrecht ist erst ab 1643 schriftlich
überliefert. Im Jahre 1529 schloss der türkische Sultan Suleiman die
Stadt Wien ein. Ihm folgte irreguläre Reiterei, die nur um der Beute
willen das Land verheerte und auch den Markt Mödling niederbrannte.
Deshalb sind nur wenige gotische Altäre, Kunst- und
Einrichtungsgegenstände erhalten geblieben.
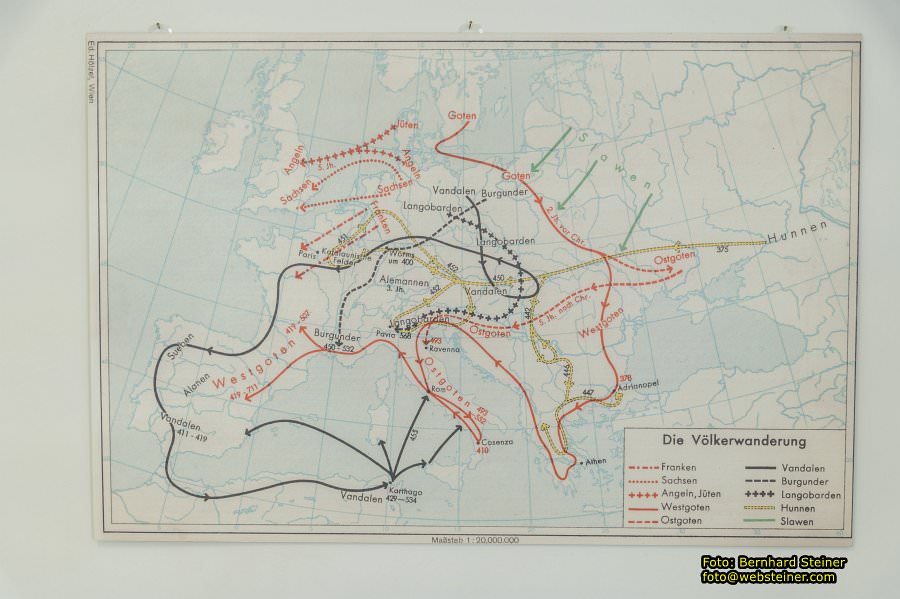
FRÜHGESCHICHTE - CHRONOLOGIETABELLE
15 v. Chr. Die Römer erobern das keltische Königreich Norikum.
9 v. Chr. Die Markomannen lassen sich in Böhmen nieder.
50 n. Chr. Ansiedlung der Quaden am Leithagebirge und um den Neusiedlersee.
92-310 Häufige Vorstöße über die Donau und Niederlagen von Markomannen und Quaden, zuletzt auch Sarmaten.
374 Einbruch von Quaden und Sarmaten in Pannonien. Verstärkung des Limes.
375 Die Hunnen unterwerfen die Goten an der Schwarzmeerküste.
378 Schlacht bei Adrianopel: Das oströmische Heer wird von Goten und Hunnen vernichtend geschlagen. Beginn der „Völkerwanderung".
451 Schlacht auf den katalaunischen Feldern: Die Hunnen werden geschlagen.
453 Tod Attilas.
455 Ansiedlung der Rugier im Weinviertel.
488 Zerschlagung des Rugierreichs. Die Romanen ziehen nach Italien.
567 Langobarden und Awaren schlagen die Gepiden vernichtend.
568 Abzug der Langobarden nach Italien.
623-626 Gründung des slawischen Samoreiches in Mähren.
626 Niederlage der Awaren und Perser bei Konstantinopel.
791-803 Awarenfeldzüge Karls des Großen. Die Awaren werden geschlagen.
900 Vorstoß der Ungarn über die Enns.
955 Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld geschlagen.
976 Leopold von Babenberg wird Markgraf des Ostlandes.
1041 Babenberger erobern den slawischen Burgwall von Thunau und damit das nördliche Niederösterreich.

Das Museum dokumentiert die erdgeschichtliche Entstehung der Mödlinger
Landschaft am Rande des Wiener Beckens. Die urgeschichtliche Sammlung
zeigt archäologische Objekte der Jungstein-, Bronze- und Eisenzeit.
Römische Objekte aus Stein, Metall und Bein dokumentieren den Übergang
zur Mödlinger Frühgeschichte in der Völkerwanderungszeit. Germanen,
Awaren und Slawen haben ihre Spuren hinterlassen, unter den Karolingern
erfolgte die Besiedlung Mödlings unter Einrichtung von Strukturen, die
bis heute nachwirken. Der Romanik und Gotik, dem Burgenbau, den
Babenbergern und den Herzögen von Mödling und der Verleihung des
Mödlinger Stadtwappens wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso
werden die Biographien bedeutender Bewohner der Stadt Mödling
vorgestellt, wie die von Joseph Schöffel, Joseph Hyrtl oder Mitsuko
Coudenhove-Kalergi.

Der symmetrische Bau mit überhöhtem dreigeschoßigem Mittelteil und
zweigeschoßigen Seitenflügeln unter Walmdächern zeigt platzseitig eine
strenghistoristische Fassade mit gequaderter Sockelzone und Lisenen und
gartenseitig am Mittelrisalit eine Portal-Balkon-Fenster-Gruppe und im
abgetreppten Giebel das Allianzwappen der Salm/Liechtenstein aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts. Das im Kern barocke Kirchenschiff des
Klosters ist im Mittelrisalit erhalten. Die ehemaligen
stichkappentonnenartigen Kirchengewölbe sind im Obergeschoß im Festsaal
erhalten. Die Gewölbe wurden im 3. Viertel des 19. Jahrhunderts mit
neobarockem Stuckdekor versehen.

Barock
Die Stilrichtung des Barock trat im 16. und 17. Jhd. auf.
Architektonische Elemente (Nischen, Kuppeln, Emporen) erzeugen mit
geschwungenen Linien, mit der Stuckdekoration und aufwendiger Malerei
eine dekorative Raumwirkung. Am Mödlinger Freiheitsplatz befindet sich
eine barocke Pestsäule aus dem Jahre 1714. Die Pfarrkirche St. Othmar
hat teilweise eine barocke Einrichtung, von der das Museum mehrere
Figuren beherbergt.
Türkennot und Pest - 16. und 17. Jahrhundert
Dem Türkensturm des Jahres 1529 fielen die Othmarkirche und viele
Mödlinger Häuser zum Opfer. Auch die Burg Mödling wurde zerstört. Da
der Markt wohlhabend war, konnten viele Bürgerhäuser bald wieder
aufgebaut werden. Die Schranne wurde 1548 als Gerichtsschranne
wiedererrichtet und erhielt fünf Renaissance-Arkadenbögen, von denen
beim heutigen Rathaus allerdings zwei zugemauert sind. Im Kellerbereich
befand sich in der damaligen Gerichtsschranne ein niedriges Verlies, in
dem die Häftlinge nicht einmal stehen konnten. Es ist heute durch ein
Glasfenster im Boden zu sehen. 1607 erhielt der Markt Mödling ein
eigenes Landgericht. Es wurden zahlreiche Grenzsteine gesetzt und der
erste Plan von Mödling gezeichnet, der Burgfriedensplan von 1610. In
das 17. Jahrhundert fällt auch die Gründung des Mödlinger
Kapuzinerklosters. 1631 entstanden die Kirche und der anschließende
Klosterbau. Das heutige Museumsgebäude zeigt noch die Gewölbe des alten
Kirchenschiffes, eine Seitenkapelle und die Sakristei. 1679 wütete in
Mödling die Pest und forderte unzählige Todesopfer. Die Leichen wurden
außerhalb des Ortes in der Nähe des Pestspitals (Eisentorgasse 12) in
Massengräbern mit Kalk übergossen und verscharrt. Vor dem verheerenden
Türkensturm von 1683 flohen die meisten Mödlinger rechtzeitig in die
Wälder. am 12. Juli 1683 dürfte es in Mödling zum Endkampf gekommen
sein. Das 17. Jahrhundert brachte durch die Auswirkungen des
30-jährigen Krieges auch für Mödling einen Niedergang. Zu Anfang des
Jahrhunderts wurden noch 274 Häuser gezählt, Mitte des Jahrhunderts nur
mehr 192, von denen aber der größte Teil baufällig war.

Zunftwesen
Aus der Hauswirtschaft des Einzelnen, die zunächst alle Bedürfnisse
deckte, ist durch die Mehrerzeugung über den Eigenbedarf das Handwerk
hervorgegangen. Die Loslösung des Vertriebes der Artikel von ihrer
Erzeugung als eigene Tätigkeit schafft neben dem Gewerbestand den
Handelsstand. Eines der am frühesten entwickelten Gewerbe ist das der
Müller. 1343 sind bereits zwei Mühlen belegt, im 15. Jahrhundert gab es
im Bereich Mödling sieben Mühlen. Müller, Bäcker und Fleischhauer und
später etliche andere Gewerbe haben sich zu Zünften (Zechen)
zusammengeschlossen. Von diesen wurden Zechordnungen aufgestellt, die
Vererbung des Handwerks, Gerichtsbarkeit und Bestellung des
Zechmeisters regelten. Das Mödlinger Museum beherbergt eine Menge von
Sammelobjekten, die sich auf das Handwerk und das Zunftwesen beziehen,
darunter reich verzierte Zunfttruhen, Fahnen und kunstvoll geschmiedete
Schlösser.
Joseph II.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es auch in Mödling bedeutsame
gesellschaftliche und soziale Veränderungen. 1785 erhielt Mödling
anstelle eines Marktrichters einen Bürgermeister (Theodor Vöckl). So
wurde die Ortsverwaltung von der Gerichtsbarkeit getrennt. In diesem
Jahr wurde auch durch Joseph II. das Mödlinger Kapuzinerkloster – das
heutige Museum Mödling – wegen der angeblichen Existenz eines
Klosterkerkers aufgehoben. Zwei Mönche sollen wegen geringer Vergehen
jahrelang in lichtlosen Kerkerzellen gelegen sein. 1786 fand das letzte
Begräbnis auf dem Friedhof bei der Othmarkirche statt. Von da an
benutzte man den Friedhof um die St. Martinskirche, bis 1876 am Fuß des
Eichkogels der neue Friedhof errichtet wurde. Im Jahre 1795 wurde wegen
der Unsicherheit in der Umgebung die erste Nachtbeleuchtung
installiert. Das Licht von den neuen Laternen sollte Gesindel
abschrecken.
Biedermeier
Nach dem Ende der napoleonischen Kriege und dem darauffolgenden Wiener
Kongress 1914/15 wuchs die allgemeine Tendenz zur Teilnahme des
Bürgertums an den Fragen des politischen Lebens. Frühe Industrien
entwickelten sich noch auf dem Boden der überlieferten Ständeordnung.
Die relative Ruhe nach dem Friedensschluss bewirkte, dass im
persönlichen häuslichen Kreis der Bürger das Bedürfnis nach Schönheit
und Behaglichkeit eine große Rolle zu spielen begann. Künstler
entdeckten die umgebende Natur als Objekt für stimmungsvolle Gemälde.
Man reiste auch wohl in die „Sommerfrische“ und genoss Wald- und
Wiesenlandschaft, als Ort seelischer Erholung. Der Begriff
„Biedermeier” bezeichnet die Stilrichtung, die besonders deutlich in
Bildern von nieder- österreichischen Städten und Landschaften zum
Ausdruck kommt. Bedeutsamere Künstler dieser Zeit waren: Friedrich
Gauermann, F. G. Waldmüller, Peter Fendi, L. F. Schnorr von Carolsfeld
und Vinzenz Reim. Es wurden Möbelstücke entworfen, die im Gegensatz zur
vergangenen Stilepoche des „Empire” dem Wunsch nach Schlichtheit und
Bequemlichkeit entsprachen. Zur gleicher Zeit begannen liberal denkende
Menschen Kritik an der Obrigkeit zu üben, die alte Ordnung in Frage zu
stellen. (1830 Revolution in Frankreich, 1848 Aufstand in Wien und
Berlin ). Der Aufbruch in die industrielle Revolution stand bevor.
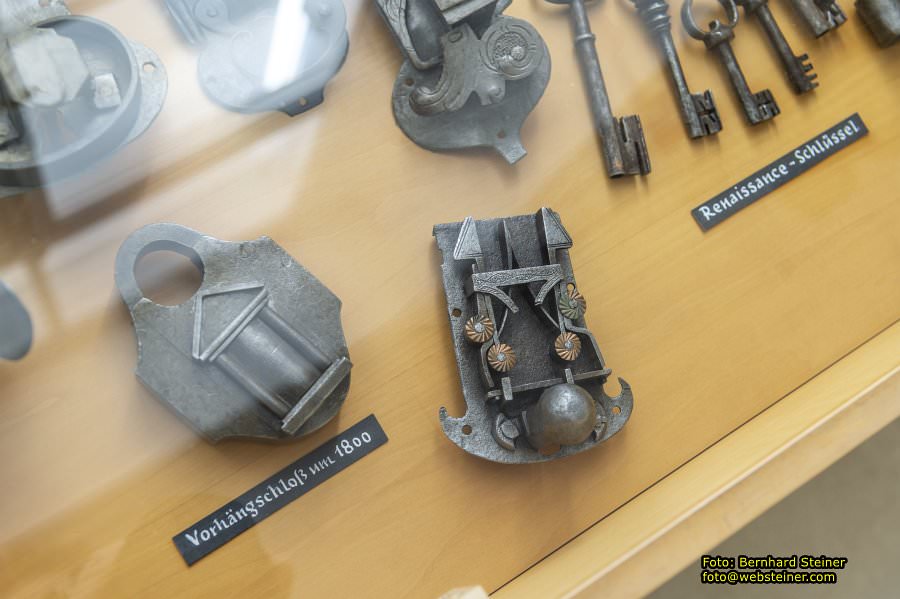
Die Epoche ab Ende des 18. Jahrhunderts ist von den hemmenden
Auswirkungen der Französischen Revolution, den napoleonischen Kriegen
und dem Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Reiche unter Kaiser
Franz II., seit 1804 Kaiser Franz I. von Österreich gekennzeichnet. Die
Siege der Franzosen in Italien und ihr Vordringen gegen die Steiermark
führten in Mödling 1797 zum allgemeinen Freiwilligen Aufgebot. Mödlings
Lasten durch französische Einquartierungen, Requisitionen und
Plünderungen im Jahre 1809 betrugen 409.953 Gulden.

An Stelle des schwungvoll belebten Barock tritt nunmehr der
Klassizismus mit seinen schlichten, kubischen Formen und seiner
monumentalen Einfachheit. Diese dem Palastbau eigene Stilrichtung
wandelt sich zum Biedermeier, der Ausdrucksform der bürgerlichen
Kultur. Es entstehen Wohnhäuser mit schönen Maßverhältnissen und
zierlichem Reliefschmuck. Für die Wohnkultur sind formschöne Möbel aus
edlen Hölzern entscheidend. Hausrat, selbst Grabsteine reden die eigene
Sprache des Bürgertums. Daneben geht in Ablehnung der einengenden
Formen des Klassizismus die Romantik unter Hinwendung vom
Verstandesmäßigen zum Gemüt- und Phantasievollen einher.

Die Naturschönheiten Mödlings, die Dolomitenklamm der Klausen, der
sanfte Talkessel der Brühl, der altertümliche Markt Mödling mit seinen
Legenden, die Babenbergerburg mit den Erinnerungen an die
Minnesängerzeit zogen viele Dichter, Musiker und Maler in ihren Bann.
Ludwig van Beethoven weilte die Sommer 1818 und 1819 in Mödling,
Hauptstraße 79 und 1820 im Christhof, Achsenaugasse 6, an der Missa
solemnis schaffend; auch seine Klaviersonate op. 106, B dur entstand
1818 in Mödling.


JOSEPH II.
römisch-deutscher Kaiser, 1765-1790
Erzherzog von Österreich, 1780-1790

Entwicklung des Ziegelstempels
Am Ende der Gotik bildete sich der Ziegelstempel aus. Zuerst kam der
Ritzstempel auf. Der Prägestempel folgte auf Ziegeln im Hochformat an
unterer oder oberer Ecke oder am Rande. Ende der Renaissance verlagert
sich der Stempel in die Mitte. Um 1620 findet ein jäher Wechsel in der
Stempellage vom Hoch- zum Querformat statt. Im Frühbarock wird der
Schriftstempel eingeführt, wobei die Stempelumrahmung neben der
Geschlossenheit des Schriftfeldes auch die richtige Leselage zu sichern
hat. Die Herzform als Umrandungslinie ist die älteste Form. In der 1.
Hälfte des 19.Jh. kommen die kraftigen Tiefdruckstempel auf. 1827 führt
Alois Miesbach an Stelle der Herzform den Wappenadler für seinen
Ziegelstempel ein.
Formatentwicklung
In der Gotik liegt die
Entwicklungsbewegung hauptsächlich in der Dicke. In der Hochgotik
wächst in geringem Maß die Länge und erst in der Spätgotik die Breite.
Der gotische Ziegel war wegen der geringen Bruchsicherheit für
Hochmauern ungeeignet. Die stürmische Entwicklung der Ziegelformate
spiegelt die geschichtlichen Ereignisse der auslaufenden Gotik. Der
notwendige Aufbau nach verschiedenen Kriegen, insbesonders den
Türkenkriegen, fűgte sich mit der Entwicklung der Ziegelbauweise
zusammen. Da nun die Ziegelmauern zu Hauptträgern wurden, mußten die
Ziegel, der Statik dienend, länger, breiter und dicker werden. Mit 1490
gedieh vorerst die Breite und nach 1500 die Länge. Das Schwellen der
Dicke machte sich zur Unterstutzung der Bruchsicherheit schon durch die
Jahrhunderte der Gotik bemerkbar. In der Renaissance diente der Ziegel im Format 2x6x12 Zoll bereits den vollen Anspruchen der Statik, um erst in der Zeit des Barocks mit 3x6x12 Zoll die Bruchsicherheit fűr Hochmauern zu gewährleisten. Im 19. Jahrhundert
wurden die Formate bis auf wenige Zweckformate nicht weiterentwickelt.
Nach der Einführung des metrischen Systems 1871 ging das
ősterreichische Format 2 2/3×5 1/4×11 Zoll = 70×138×288mm in das
Neuformat 70×140×290mm űber.
Maßgrundlagen
Die Tradition des Ziegelbaues und der Ziegelproduktion geht auf das
dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Damals entstanden in Sumer und
Ägypten die Maßgrundlagen für Elle,Fuß und Zoll. Diese beeinflußten die
Ziegelformate der europäischen Architektur bis zur Einfuhrung des
metrischen Systems im Jahre 1871.

Trommelrevolver Lefaucheux, Frankreich Zentralfeuerzuendung nach 1860
Schwert der Studentenlegion
Trommelrevolver Lefaucheux, Frankreich Stiftfeuerzuendung nach 1854

Tschako der Nationalgarde

Johann Baptist Verda von Verdenberg stiftete 1631 ein Kapuzinerkloster.
Das Kloster wurde im Türkenkrieg 1683 zerstört und 1684
wiederaufgebaut. Das Kloster wurde 1785 unter Joseph II. säkularisiert
und 1786 von Giacomo Caliano erworben und zur Erzeugung von Seide und
Tüchern genutzt. Um 1806 bestand die Nutzung des Gebäudes als chemische
Bleicherei, um 1821 als Theater. 1833 erwarb es der Entomologe Ernst
Heeger im Wege einer Auktion und es folgte die Nutzung als
Seidenfabrik. Die nächste Eigentümerin ab 1845, Altgräfin Elise von
Salm, eine geborene Liechtenstein ließ das Gebäude schlossähnlich
umbauen. Anderen Quellen zufolge war das Schlössel in den Jahren
1845–1862 im Besitz des Ehepaares Maria und Joseph von Demel, das auch
in der heutigen Demelgasse wohnte. Im Jahr 1889 erwarb die Familie
Thonet das Gebäude. 1931 von der Sparkasse der Stadt Mödling erworben,
wurde das seit 1904 bestehende Bezirksmuseums untergebracht.

Industriezeitalter
1883 erhielt Mödling eine in der ganzen Monarchie einmalige technische
Sensation: die erste elektrische Bahn der Welt. Sie fuhr vom Mödlinger
Bahnhof durch die Schillerstrasse durch das enge Klausental bis in die
Hinterbrühl. Die bayrische Gesellschaft Krauß die in der Umgebung von
Wien Dampftramwaylinien plante erhielt die Konzession zum Bau dieser
Bahnlinie, die bist 1885 fertig gestellt wurde. 1901 wurden bereits 40
Züge auf dieser Strecke benötigt. Mit 10 Triebwagen und 15 Beiwagen
schaffte man eine Zugfolge von 7½ Minuten. Die erforderliche
elektrische Energie erhielt die Bahn durch drei Lokomobile zu je 20 PS
und sechs Gleichstromgeneratoren zu je 20 KW bei 500 V. Die Fahrleitung
bestand aus geschlitzten Eisenrohren in denen Metallschiffchen glitten.
Als 1927 das Busunternehmen LOBEG in Konkurrenz zur Bahn trat, machte
ein gegenseitiges Unterbieten der Tarife eine Rentabilität der beiden
Verkehrsmittel unmöglich. Die ÖBB kaufte die Lobeg auf und stellte 1932
die Hinterbrühler Bahn ein. Einige Triebwagen fanden bei der Deutschen
Reichsbahn Verwendung, die anderen Beiwagen wurden verschrottet, bis
auf einen, der in Himberg als Bauhütte diente und 1982 durch einen
Zufall dort entdeckt und restauriert wurde. Ein Triebwagen, der in der
DDR verwendet wurde, wurde 1967 der Gemeinde Hinterbrühl geschenkt.
Eine Gruppe des Mödlinger Stadtverkehrsmuseums bemüht sich um die
Instandhaltung und Präsentation der Hinterbrühler Wägen. Mehr dazu:
Stadtverkehrsmuseum Mödling.
Ziegelsammlung
Die gestiegene Bautätigkeit, in deren Zuge im 19. Jahrhundert
Arbeitersiedlungen und Villenviertel entstanden, setzte eine
Massenproduktion von Ziegeln voraus. Eine eigene Ziegelsammlung mit den
verschiedensten Normformaten und Ziegelstempeln, die sogar eine
Datierung von Bauwerken ermöglichen, ist im Museum Mödling ausgestellt.
Durch einen Ziegelmodel und zugehörige Bilddokumente bekommt der
Besucher einen Eindruck von der schweren händischen Arbeit bei der
Ziegelherstellung.
Stadterhebung
Nach 1800 erwuchsen aus dem Lebensgefühl der Biedermeier neue Ideen zur
Gestaltung der Hausfassaden und Gegenstände des täglichen Lebens, und
Künstler entdeckten manche Naturschönheit in der Umgebung Mödlings. Im
19. Jahrhundert begannen sich Industriebetriebe anzusiedeln. 1841
erfolgte die Eröffnung der Südbahnstrecke. Mödling wurde 1875 unter
Bürgermeister Schöffel (bekannt als „Retter des Wienerwaldes“) zur
Stadt erhoben und entwickelte sich seitdem trotz mancher Notzeiten und
zwei Weltkriegen zu einem modernen und leistungsfähigen Gemeinwesen.
Kriegszeit
Auf Hitlers Druck trat der österreichische Bundeskanzler Schuschnigg am
11. März 1938 zurück. Die nationalsozialistische Machtübernahme war
perfekt vorbereitet worden. In der Nacht zum 12. März marschierte die
deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Der Mödlinger Bürgermeister Josef
Lowatschek und weitere Amtsträger wurden verhaftet. Am nächsten Morgen
führten der neue Bürgermeister Hartmann und sein Stellvertreter
Tamussino die Amtsgeschäfte. In der Pogromnacht („Reichskristallnacht“)
brannte die Mödlinger Synagoge in der Enzersdorferstraße nieder.
Uniformen beherrschten das Straßenbild. Das Panzerregiment 3 wurde am
22. März 1938 in Mödling und Umgebung stationiert. Am 15. Oktober 1938
wurde der politische Bezirk Mödling zum 24. Bezirk von Wien erklärt. Ab
Herbst 1943 flogen alliierte Flugzeuge 17 Angriffe mit über 600
Bombeneinschlägen auf das Stadtgebiet, die eigentlich den Ostmarkwerken
in Wr. Neudorf galten. Mit Beginn der Luftangriffe wurde am Eichkogel
eine Flak-Batterie installiert, die gegen Kriegsende mit Jugendlichen
besetzt wurde, Schuljungen wurden als Flakhelfer eingesetzt, die zum
„Volkssturm“ einberufen wurden. Am Ostermontag, dem 8. April 1945 stand
die Rote Armee bereits in Bruck an der Leitha. Flüchtende NS-
Funktionäre steckten die Parteihäuser in der Pfarrgasse und Goethegasse
in Brand. Am 5. April drangen die ersten Sowjetsoldaten in die Stadt
Mödling ein.
Nachkriegszeit
Am 5. April 1945 trafen die ersten sowjetische Truppen im Mödlinger
Stadtgebiet ein. Öffentliche Gebäude, Villen und Wohnungen wurden
besetzt, Fahrzeuge und Vieh requiriert, die Zivilbevölkerung zu
Hilfsdiensten gezwungen. Nach Berichten von Zeitzeugen kam es auch
mehrfach zu Plünderungen und Vergewaltigungen durch die Soldaten. Die
Sowjets setzten einen Bezirksvorsteher ein und die Vertreter der
Parteien wählten einen provisorischen Gemeindeausschuss der wiederum
den Bürgermeister (SPÖ) und die Vizebürgermeister (ÖVP, KPÖ) wählte. Im
Museum Mödling befindet sich die Niederschrift eines
Augenzeugenberichts, aufgenommen mit Altbürgermeister Karl Stingl. Als
Randgemeinde von Wien blieb Mödling ein wirtschaftliches Stiefkind. Mit
dem 1. September 1954 zählte nach 16 Jahren Unselbstständigkeit Mödling
wieder zu den unabhängigen Städten Niederösterreichs. Nach Abzug der
Besatzungssoldaten 1955 konnte an eine Renovierung der devastierten
Gebäude und an Neubauten gedacht werden. Die Motorisierung nahm zu und
man hatte im damaligen Fortschrittsglauben keine Hemmungen, desolate
Häuser dem Verkehr und neuen Bauten zu opfern. Am 30. November 1967
wurde auch die Straßenbahnlinie 360 von Wien-Rodaun nach Mödling
eingestellt. Trotz Verkehrs und vieler Neubauten konnte sich Mödling
doch vieles von seinen Reizen erhalten. Wegen ihrer privilegierten Lage
am Wienerwald und in direkter Nachbarschaft zur Bundeshauptstadt Wien
ist die Stadt Mödling heute eine gesuchte Wohngemeinde.

Geologie - Die geologische Abteilung
Die geologische Abteilung des Mödlinger Museums bietet dem Besucher die
Möglichkeit anhand seltener, in langen Jahren zusammengetragener
Sammlungsstücke einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit
unserer Landschaft zu werfen. Es werden Gesteinsproben gezeigt, die
Zeugen von Meeresablagerungen oder Gebirgsbildungsvorgängen vor vielen
Millionen Jahren sind. Manche dieser Proben enthalten Reste von Tieren
oder Pflanzen, deren späte Verwandte zu unserer heutigen Umwelt
gehören. Andere Lebewesen, wie z. B. Dinosaurier, sind völlig
ausgestorben, und man kann sich nur eine ungefähre Vorstellung von
ihrem Aussehen und ihren Fähigkeiten machen.
Die Ausstellung führt den Beschauer von uralten Zeiten der
Erdgeschichte (vor etwa 250 Millionen Jahren) bis zum Ende der letzten
Eiszeit (vor etwa zehntausend Jahren), als der Mensch in unserem Raum
zum ersten mal auftrat.
Neben den Bundes- und Landesmuseen gibt es nur wenige Museen, die eine
umfangreiche geologische oder paläontologische Sammlung aufweisen
können. Mit dem Eintritt des von der Geologie begeisterten
Hauptschuldirektors Franz Mariner (1889–1981) in den Museumsverein
wurde 1951 am Mödlinger Museum eine eigene geologische Abteilung
gegründet, in der nicht nur Gesteine und Fossilien, geologische Karten,
Profile und Bilder zu sehen sind, sondern dem Besucher auch
ausführliche Erläuterungen geboten werden. Die geologische Abteilung
fand nicht nur bei interessierten Laien und den Mödlinger Schulen,
sondern auch in Fachkreisen großen Anklang und wurde sogar regelmäßig
von Universitätsexkursionen besucht. Knapp vor seinem Tode konnte Dir.
Mariner seine Abteilung dem Studenten der Biologie und
Erdwissenschaften Peter Karanitsch in die Hände legen. 1986 gelang es
dem Bezirks-Museums-Verein Mödling, die geologisch- paläontologischen
Privatsammlung des Gießhüblers Oskar Spiegel zu übernehmen. Der
Chefgeologe der Geologischen Bundesanstalt i.R., Prof. Dr. Benno
Plöchinger erklärte sich bereit, ehrenamtlich die wissenschaftliche
Betreuung der geologischen Abteilung zu übernehmen.

Gräfin Mitsuko (Maria Thekla) Coudenhove-Kalergi
Am 27. August 1941 verstarb in Mödling, Kürnbergergasse 11, Gräfin
Mitsuko (Maria Thekla) Coudenhove-Kalergi, unbeachtet von der großen
Öffentlichkeit und doch eine Persönlichkeit von europäischem Rang.
Mitsuko Coudenhove-Kalergi, geb. Aoyama, wurde 1874 in Tokyo als
Tochter eines Antiquitäten- und Ölhändlers geboren. Sie war gerade 17
Jahre alt, als sie den österreichisch-ungarischen Gesandten Dr.
Heinrich Coudenhove-Kalergi kennen lernte. Am 16. März 1892 wurde in
Japan mit Einwilligung des österreichischen und japanischen
Außenministeriums geheiratet, die ersten beiden Kinder wurden in Tokio
geboren. Der erste Sohn hieß Hans (Johann-Koutaro, geb. 1893), der
zweite wurde Richard-Eitaro genannt (geb. 1894). Richard wurde später
als „Vater des Europagedankens“ Gründer der Paneuropa Bewegung. Nach
Ende von Heinrichs Tätigkeit als Gesandter verließ er Tokio und kehrte
mit seiner Familie nach Ronsperg (Poběžovice, Tschechien) zurück, wo er
sich um das etwas verwahrloste Familiengut kümmern musste. Dort wurden
fünf weitere Kinder geboren. Im Jahre 1906 verstarb Heinrich und
Mitsuko, die den christlichen Namen Maria Thekla angenommen hatte, war
mit den sieben Kindern auf sich alleine gestellt. Sie hatte nun
unzählige Probleme zu meistern, angefangen von rechtlichen
Schwierigkeiten mit den Verwandten Ihres Mannes, die sie unter Kuratel
stellen und die Verwaltung des Gutes übernehmen wollten, bis zu den
wirtschaftlichen Problemen des Gutes und der Erziehung ihrer Kinder.
1908 zog Mitsuko mit ihren Kindern nach Wien, um für die bestmögliche
Ausbildung zu sorgen. Im Herbst 1924 schließlich übersiedelte sie
zusammen mit ihrer Tochter Olga nach Mödling, einer Stadt mit Zuzug von
Künstlern und Musikern. Nach einem leichten Schlaganfall lebte sie
zurückgezogen und verließ nur selten das Haus, in dem sie 1941
verstarb. Etwa ab 1970 ist in Japan reges Interesse am Leben von
Mitsuko erwacht, der ersten Japanerin, die einen ranghohen Europäischen
Diplomaten geheiratet hatte.

Kaiser Franz Josef in Mödling, 1904
Besuch der Hyrtl' schen Waisenanstalt
Eröffnung der k.k. Technischen Militärakademie
Inbetriebnahme der Wasserleitung aus Moosbrunn
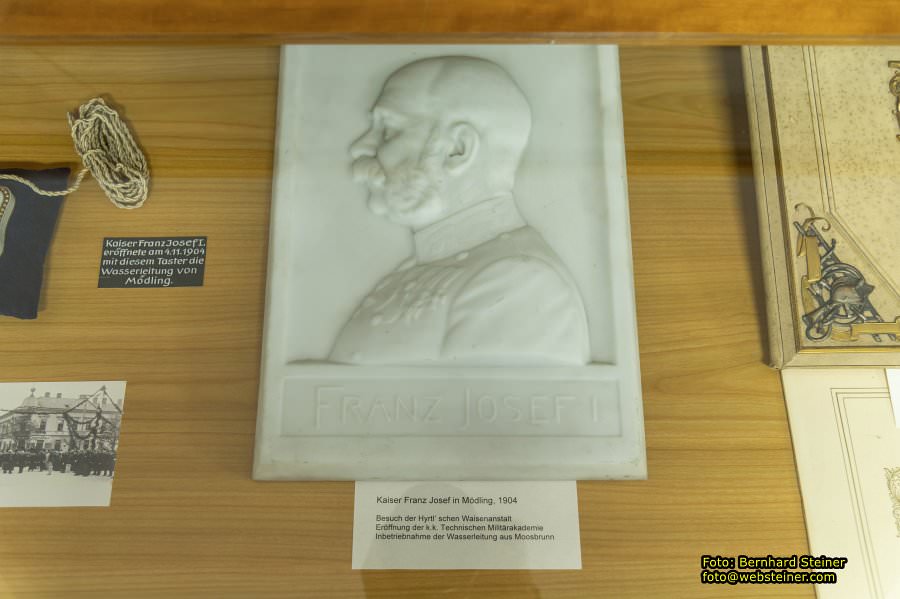
Stutzuhr ~1800

Das Morse Alphabet
Die Buchstaben werden aus 2 Zeichen zusammengesetzt: „Di" = (Punkt), „Doo" = (Stricht)
Jeder Buchstaben besteht aus höchstens 4 Zeichen! Zahlen bestehen aus 5
Zeichen und Satzzeichen aus 5-6 Zeichen. Das Morsealphabet kann man als
ersten Versuch einer binären Darstellung von Buchstaben und Zahlen
verstehen (./- entspricht 0/1). Eine Morseanlage besteht aus einem
Sender und einem Empfänger. Im Sender werden durch eine Morsetaste
kurze und lange elektrische Signale über eine Leitung, die im
Ruhezustand auf Null steht, gesendet. Im Empfänger erzeugen die
unterschiedlichen Impulse in einer Spule kurze und lange Stromstöße,
die über eine Nadel Papierstreifen punkt- oder strichförmig ritzen.
Diese Streifen können durch einen Morsekundigen entziffert werden.
Abhörsicher!
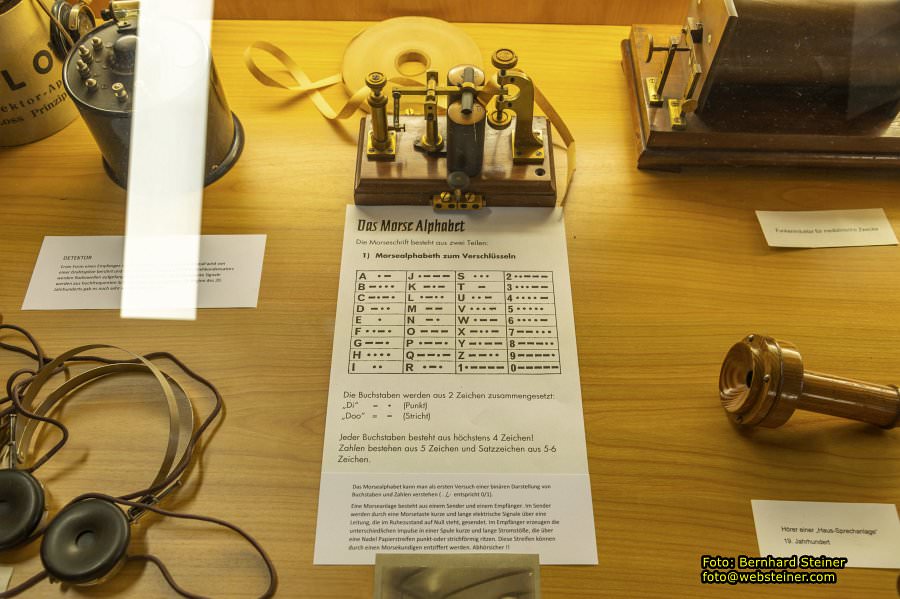
Mignon (Schreibmaschine)
Mignon ist der Name eines Schreibmaschinenmodells der Firma AEG. Diese
Schreibmaschine wurde 1903 von Friedrich von Hefner-Alteneck entwickelt
und in den Jahren 1904 bis 1934 von der AEG gebaut. Bei dieser
Schreibmaschine kam eine Typenwalze (Typenzylinder) als Träger der
darstellbaren Zeichen (Typen) zum Einsatz. Die Typenwalze war
austauschbar. Bei dem Modell 4, das ab 1924 angeboten wurde, waren über
36 verschiedene Typenwalzen erhältlich, u. a. auch zwei Typenwalzen mit
kyrillischen Buchstaben. Ab 1933 wurde eine verbesserte Version als
Olympia Plurotyp verkauft.
Zu jeder Typenwalze gehörte ein austauschbares Tableau (Buchstabenfeld)
mit den verfügbaren Zeichen, das unter einen Zeiger in die Mignon
Schreibmaschine eingespannt werden musste. Mit der linken Hand wurde
der Zeiger über das jeweils gewünschte Zeichen geführt. Durch
gekoppelte Mechanik stellte sich die Typenwalze mit dem entsprechenden
Zeichen über das Papier. Durch Betätigung der Abdrucktaste mit der
rechten Hand druckte die Typenwalze das Zeichen auf das Papier. Mit
einer zweiten Taste konnte ein Leerzeichen erzielt werden. Beim Modell
4, das ab 1924 gebaut wurde, kam noch eine Rücktaste hinzu. Beim
Betätigen der Rücktaste wurde der Wagen um einen Schreibschritt
zurücktransportiert, um korrigieren zu können.



Richard Harlfinger - Bürgermeister Jakob Thoma (Bürgermeister von Mödling 1890-1910), Öl auf Leinwand, 1906, 83x110

Thonetschlössl
Frühbarocke Gebäudereste des Kapuzinerklosters (1631 - 1785), streng gegliederte klassizistische Fassade.
1785 Seiden- und Tuchfabrik
1821 Theater
1833 Sammlung des Entomologen Ernst Heeger
1845 Wohnhaus der Gräfin Salm
1889 als Wohnsitz der Familie Thonet umgestaltet
Das Bezirksmuseum ist mit kriegsbedingten Unterbrechungen seit 1933 hier untergebracht.

Der gleichfalls denkmalgeschützte Museumpark wurde 1957 eröffnet und
beinhaltet ein barockes Brunnenbecken, eine Pietà-Gruppe auf einem
Sockel aus 1756, drei Inschriften-Grabsteine aus dem 16. und 17.
Jahrhundert, einen Protestantenstein mit 1581 Wolfgangus und Zezilia
Reitperger protestantischer Ratsherr und Marktrichter, ein Fragment
einer gotischen Säule 1529 und 1683 beschädigt von der Dombauhütte St.
Stephan.
Im Museumspark wurde von namhaften japanischen Spezialisten ein
Zen-Garten angelegt zum Gedächtnis an Gräfin Mitsuko
Coudenhove-Kalergi. Die Stadtgärtnerei der Stadtgemeinde Mödling hat
von der Innung der Gärtner und Floristen NÖ einen Sonderpreis für die
Gestaltung und Pflege des Museumsparks und des Coudenhove-Kalergi
Memorial-Zengartens erhalten.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: