web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Museum Traiskirchen
Möllersdorf, September 2023
Eine aufregende Zeitreise mit Objekten aus Alltag,
Handel, Mobilität, Verkehr und Technik. In der einzigartigen Ladenzeile
können die Alltags- und Lebensbedingungen früherer Generationen hautnah
erlebt werden. Eine Spielzeugsammlung und ein Feuerwehrbereich runden
die Vielfalt ab.
Die ehemalige Kammgarnspinnerei, die älteste Industrieanlage
Traiskirchens, ist heute Heimat des Museums. 150 Jahre lang - bis 1975
- wurden hier feine Garne und Zwirne produziert. Auch der Name des
Reifenproduzenten Semperit ist mit der Stadt eng verbunden. Darüber
hinaus boten sechs Ziegelwerke und viele andere Industriebetriebe
Arbeitsplätze. Eine im Museum ausgestellte typische Arbeiterwohnung aus
1930 zeigt die Lebens- und Wohnbedingungen der Arbeiterklasse.

Die zahlreichen Schauräume des Museums befinden sich in der ehemaligen
Kammgarnfabrik Möllersdorf, in der von 1824 bis 1975 feine Garne
produziert wurden. Das Flair des Industriezeitalters ist hier immer
noch all gegenwärtig. In der Ladenzeile reihen sich Geschäftslokale und
Werkstätten dicht aneinander, die Atmosphäre vergangener Zeiten ist
hautnah zu spüren. Themen wie Verkehr & Mobilität, Alltag &
Handel, Technik im Wandel, Spielzeug und Feuerwehr runden das Angebot
ab.
Das Museum Traiskirchen ist seit 1988 in den Gebäuden der ehemaligen
Kammgarnspinnerei Möllersdorf untergebracht. In drei Stockwerken und
einem Freigelände werden Objekte aus Alltag, Technik, Industrie,
Weinbau, Schulwesen, Natur und Archäologie gezeigt.

MATADOR - Technische Daten der Riesenradkonstruktion:
Gesamthöhe: 3,21 m
Raddurchmesser: 3 m
Achshöhe: 1,70 m
Gesamtgewicht: ca. 90 kg
9.000 Stück MATADOR Stäbchen
6.000 Stück MATADOR Holzteile
2.500 Stück MATADOR Kunststoffelemente
500 Stück Metallteile
550 Stück Seile aus Nylon (1,4mm stark)
1.100 Stück Seilknoten
600 Ifm Seil
200 Stunden Arbeitszeit

Die Ordnung der Zeit
In vorindustrieller Zeit gibt es eine Einheit von Lebens- und
Arbeitswelt. Der Bauer lebt auf seinem Hof mit Mägden und Knechten. Der
Handwerksmeister beherbergt in seinem Haus Lehrlinge, Gesellen und
Lohnarbeiter. Eine Anwesenheitskontrolle der Beschäftigten ist daher
nicht nötig. Das ändert sich mit der Industrialisierung. Einen Lohn
erhält nur, wer zu festgelegten Zeiten in der Fabrik anwesend ist.
Arbeitszeit, Arbeitsleistung und Arbeitsdisziplin werden zu messbaren
Größen. Ab 1900 werden dazu verstärkt sogenannte Kontrolluhren
eingesetzt. Dies sind Geräte, mit denen Arbeitsbeginn und Arbeitsende
für jeden Arbeitnehmer festgestellt und aufgezeichnet werden können.
Ursprünglich dienen sie den Unternehmern vor allem als
Erziehungsinstrument zur Erhöhung der Pünktlichkeit der Arbeitnehmer.
Denn speziell für den Schichtbetrieb müssen die Arbeiterinnen und
Arbeiter zeitgerecht verfügbar sein. Gleichzeitig bringen die
Kontrolluhren aber auch viele Vorteile für die Verwaltung und die
Lohnabrechnung. Kontrolluhren sind ein wichtiger Schritt zur
Optimierung der Arbeitsabläufe in der Industrie.
Am meisten verbreitet sind Stempeluhren. Jeder Arbeitnehmer verfügt
über eine eigene Zeitkarte, die beim Kommen und Gehen in den Apparat
gesteckt und gestempelt werden muss. Die Karten werden neben der Uhr
meist in zwei Fächerkästen aufbewahrt. Solche mechanischen Stempeluhren
werden bis in die 1980er Jahre sowohl in der Industrie als auch in
Dienstleistungsbetrieben verwendet. Heute erfolgt die Zeiterfassung in
digitaler Form mittels Chipkarten, Sensoren oder über Fingerprint. Sie
dienen gleichzeitig als Zutrittskontrolle. Die ausgestellte Stempeluhr
ist ein Fabrikat der Firma Bürk. Sie stammt aus der Zeit um 1920 und
kam im Elin Werk in Möllersdorf zum Einsatz.

Vom Mühlenland zum Industriestandort
Den Ursprung der Industriegeschichte der Stadtgemeinde Traiskirchen
bilden vom Wasser angetriebene Mühlen. Entlang des Mühlbachs, der sich
seit 900 Jahren durch das Gemeindegebiet schlängelt, gab es mindestens
zwölf Getreidemühlen. Die älteste Mühle stand in Tribuswinkel und wurde
bereits im 12. Jahrhundert erwähnt. Die Wasserkraft war also der Motor
für den Beginn der Industrialisierung. In Traiskirchen entstanden die
meisten Fabriken an Mühlenstandorten. Auch entlang des 1803 eröffneten
Wiener Neustädter Kanals begann die Ansiedlung von Gewerbebetrieben.
Sie nutzten das Wasser des Kanals als Transportweg und Antriebsquelle.
Die Erfindung der Dampfmaschine und der Eisenbahnbau ab Mitte des 19.
Jahrhunderts - hier vor allem die Aspangbahn und die Badner Bahn -
waren Voraussetzungen für größere Industrieansiedlungen.
Für die Menschen bedeutete die Industrialisierung eine dramatische
Änderung ihrer Lebensverhältnisse. Von der Feldarbeit im Freien kamen
sie in lärmende Fabrikshallen, von einem Arbeitstag, dessen Rhythmus
von Tageslicht und Wetter bestimmt war, zum durchgetakteten Alltag an
den Maschinen. „Das Diktat der Uhr ersetzte das Diktat der Natur." Mehr
als hundert Jahre dauerte der Kampf der Arbeiter für ihre Rechte, von
der Revolution 1848 über Aufstände und Streiks, immer wieder
unterbrochen und bestimmt von Wirtschaftskrisen und Kriegen. Im Ersten
Weltkrieg und verstärkt im Zweiten wurden Teile der Industrie in den
Dienst der Rüstungsproduktion gestellt. Während der
Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre mussten viele Betriebe schließen,
die Zahl der Arbeitslosen stieg massiv.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Industrie mit Rohstoffmangel und
zerstörten Anlagen zu kämpfen. Dem Wiederaufbau folgte ab Ende der
1950er-Jahre ein starker Wirtschaftsaufschwung, der bis in die
1970er-Jahre anhielt. Dann kam es zur Verlagerung vieler
Industriebetriebe in Länder mit niedrigerem Lohnniveau. Davon waren
auch einige Unternehmen in Traiskirchen betroffen, sie mussten
schließen. Heute hat sich Traiskirchen von einem Standort der
Großindustrie zu einer Stadtgemeinde mit einer breiten Palette an
Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen gewandelt. Die Sonderausstellung „Rauchende Schlote - Die Geschichte der Industrie in Traiskirchen" bietet einen Überblick über den Werdegang einiger ausgewählter Betriebe im Lauf der Zeit.

Traiskirchens Industriepionier - Kammgarnfabrik Möllersdorf
1824 wird der erste Industriebetrieb in Möllersdorf von Josef Mohr
gegründet: eine Baumwollspinnerei. Sie befindet sich an dem Standort,
an dem das heutige Museum Traiskirchen steht. 1877 übernimmt die in Bad
Vöslau beheimatete Vöslauer Kammgarn AG das auf Schafwollverarbeitung
umgestellte Werk. Aus Merinowolle werden feine Garne und Zwirne
hergestellt. Die Spinnerei Möllersdorf ist Ende des 19. Jahrhunderts
eine der größten Kammgarnspinnereien Europas. In Spitzenzeiten arbeiten
hier bis zu 1.400 Personen, vorwiegend Frauen, im Schichtbetrieb. Trotz
vieler Investitionen ist der Betrieb Anfang der 1970er-Jahre nicht mehr
gewinnbringend zu führen und wird 1976 stillgelegt. Danach erwirbt die
Semperit das Areal und lagert hier Reifen. 1987 kauft die Stadtgemeinde
Traiskirchen das Gelände und ab 1988 wird in den Gebäuden das
Stadtmuseum eingerichtet.

Vollmilch und Halbbitter - De Jong Schokoladefabrik
Hendrik De Jong, der seit 1790 im nordholländischen Wormerveer als
Gewürz-und Chemikalienhändler tätig ist, kauft 1809 eine
Muschelsandmühle. Ab 1843 beginnt man, in der Mühle Kakaobohnen zu
vermahlen - die Grundlage für die spätere Kakao- und Schokoladefabrik.
Das Unternehmen wird inzwischen von den Nachfahren von De Jongs Frau,
Trijntje Schoute, geführt und heißt nun Erve H. De Jong (H. De Jongs
Erben). 1891 wird die Marke mit dem königlich holländischen Wappen
ausgezeichnet. Erfolgreich exportiert man in alle Welt und wirbt mit
den Worten: „Bestes Fabrikat der Gegenwart, rein, leicht löslich,
nahrhaft und von köstlichem Geschmack, von vielen ärztlichen
Autoritäten empfohlen, ist in allen besseren Specereihandlungen,
Droguerien zu haben."
1905 gründet De Jong die einzige Zweigniederlassung in Europa, und zwar
in Tribuswinkel. Das Unternehmen erwirbt eine abgebrannte Mühle am
Mühlbach in der heutigen Sängerhofgasse. Eine Fabrik zur Herstellung
von Kakao, Kakaobutter und Schokoladeartikeln wird errichtet. Bald
erhält De Jong die Auszeichnung als k.u.k. Hoflieferant.
Die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit bringt auch die
Schokoladefabrik unter Druck, 1930 brennt zudem das Stammwerk in den
Niederlanden ab. Danach scheint es wieder bergauf zu gehen, immerhin
wird 1936 bei der Badener Behörde ein Ansuchen zwecks Genehmigung der
Aufstellung eines 50-PS-Dieselmotors in einem Zubau eingereicht. Im
Zweiten Weltkrieg gilt die Fabriksanlage als „feindliches Vermögen" und
wird 1941 unter nationalsozialistische Verwaltung gestellt. Nach
verfehlten Experimenten mit Ersatzprodukten für die teure Kakaobutter
muss die holländische De Jong 1957 schließen. Die Maschinen des Werks
in Tribuswinkel werden 1968 an die Wiener Firma Karl Knäbchen verkauft,
die hier bis zur Schließung 1978 Schokostreusel herstellt. Danach wird
der Gebäudekomplex an einen Kunststoffproduzenten vermietet. Heute
befindet sich hier das Veranstaltungs- und Seminarzentrum Lindenhof -
benannt nach einer Linde im Innenhof, die bereits bei der
Fabriksgründung gepflanzt wurde.
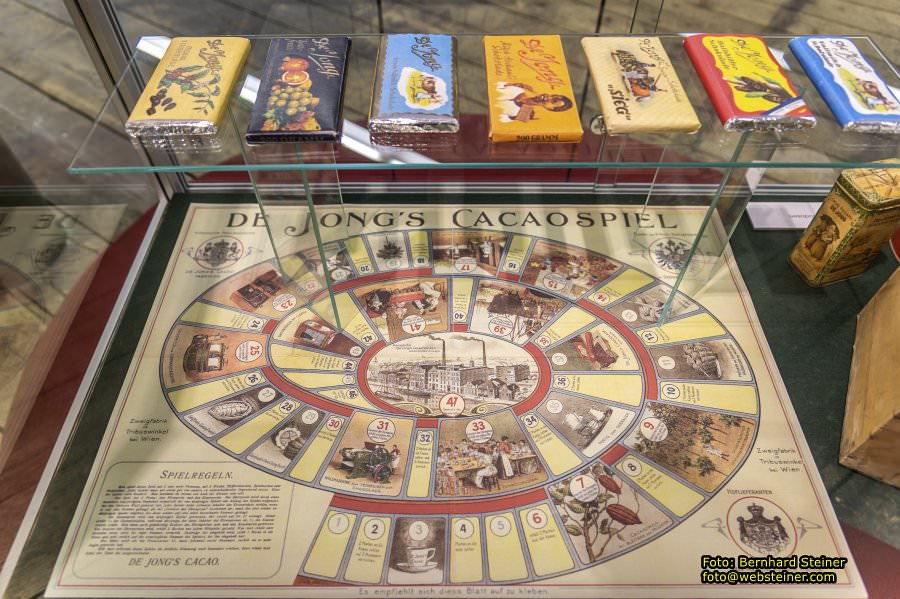
Menschlichkeit im Gepäck - Die Treff Kofferfabrik
Die Treff Kofferfabrik in Tribuswinkel, Josefsthalerstraße 26, wird
1935 von Felix Melchior auf dem Gelände der ehemaligen Tischlerei
Foissner gegründet. Zuerst stellt man Verpackungen für die Firma Oetker
her, später Kartonkoffer und Lederwaren. Der Gründer Felix Melchior war
ursprünglich Schlosser bei Oetker und verfügt über minimales
Startkapital. Bald führt er sein Unternehmen zum Erfolg, ohne seine
Herkunft als Arbeiter zu vergessen - er ist sehr sozial eingestellt und
bei seinen Mitarbeitern beliebt. Menschlich verhält er sich auch, als
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter im Unternehmen zum Einsatz kommen.
Nach Kriegsende wird die Fabrik geplündert. Mit viel Mühe kann der
Betrieb wieder aufgenommen werden, wobei es vor allem an Rohstoffen
mangelt. Während des Ungarn-Aufstands im Jahr 1956 spendet Melchior den
Flüchtlingen einen ganzen LKW voll Treff Koffer. Eine in den
1960er-Jahren geplante Modernisierung der Produktion kann nicht
finanziert werden. 1971 übernimmt dann der deutsche Schneider-Konzern
das Unternehmen und stellt unter dem Namen Bermas Kartonagen,
Reisegepäck, Schultaschen und Schulartikel her. 2010 wird die
Produktion in Tribuswinkel eingestellt und das Fabriksgelände verkauft.
Heute gehört das Areal der Evangelikalen Gemeinde Baden, die dort ein
Kultur- und Gebetszentrum errichtet hat.

Flammen aus Patronenhülsen - IMCO Feuerzeuge
1907 gründet Julius Meister in Wien die Österreichische Knopf- und
Metallwarenfabrik J. Meister & Co. Während des Ersten Weltkriegs
fertigt sie vor allem Knöpfe für Uniformen. Dieser Markt bricht 1918
ein, aber aus dem Krieg bleiben viele leere Patronenhülsen - sie bilden
die Grundlage für ein neues Produkt, nämlich Feuerzeuge. Mit der
US-amerikanischen Firma Ronson ist man damit einer der ältesten
Feuerzeug-Produzenten weltweit. Ab 1923 ersetzt das Kürzel IMCO (aus
den Initialen J(I)ulius Meister & Co) den Firmennamen. 1926
verlässt der Firmengründer die Geschäftsführung, Mitinhaber Bernhard
Silberknopf, seit 1911 dabei, holt seinen Sohn Hans ins Unternehmen.
Zahlreiche Feuerzeugmodelle werden entwickelt und im In- und Ausland
zum Patent angemeldet. 1936 entsteht der Klassiker IMCO Triplex Super,
ein Sturmfeuerzeug und gleichzeitig das erste halbautomatische
Benzinfeuerzeug, das mit nur einem Daumendruck zu entzünden ist.
Einen Tag nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich
nimmt sich Firmenchef Hans Silberknopf mit seiner Frau das Leben. In
seinem Testament vermacht Silberknopf das Unternehmen vier
„außergewöhnlich aufrechten" Mitarbeitern. Zwei von ihnen, Johann
Raganitsch und Alfred Racek, führen den Betrieb weiter. In den
1950er-Jahren kommt das Modell Streamline auf den Markt. 1967 wird ein
weiterer Standort für die Montage und das Abfüllen von Flüssiggastanks
für Feuerzeuge in Tribuswinkel eingerichtet. Dem Zeitgeschmack
entsprechend werden nun auch gasbetriebene Kunststofffeuerzeuge
hergestellt. Insgesamt kann IMCO in seiner langjährigen Geschichte auf
rund 70 Modelle verweisen, die weltweit verkauft wurden. 2012 schließen
sich die Tore der Fabrik, doch ein Jahr später erwirbt das japanische
Unternehmen Windmill die Patente. Vor allem das IMCO Triplex Super
wird, abgesehen von kleinen technischen Verbesserungen in den
1950er-Jahren, bis heute unverändert hergestellt.
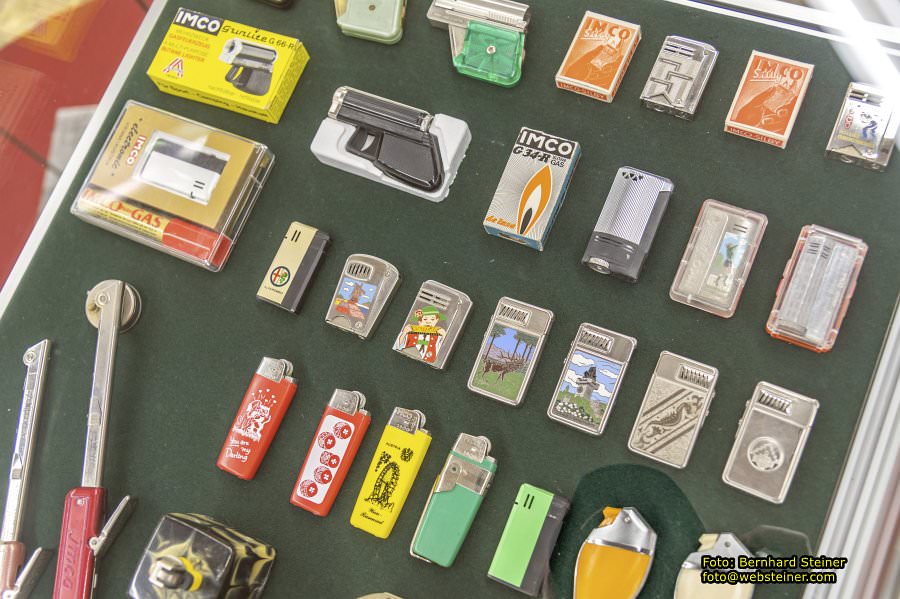
Der Duft der schwarzen Bohnen - Helmut Sachers Kaffee
Im Jahr 1929 eröffnet Karl Sachers eine kleine Greißlerei am Wiedner
Gürtel in Wien. Das Geschäft geht gut und Sachers kauft den
Hälfteanteil einer Lebensmittelgroßhandlung am Naschmarkt. Dort lernt
er das Kaffeerösten. In jeder Lebensmittelgroßhandlung röstete man
damals Kaffee und verkauft ihn in einfachen Papiersäcken zu zwei
Kilogramm an die einzelnen Kaufleute.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt Sachers nach einem Ausgleich wieder
von vorne - in derselben Greißlerei, in der jetzt auch Kaffee geröstet
wird. Im Jahr 1956 hebt er die Marke „Stambulia" aus der Taufe,
inspiriert von der türkischen Kaffeekultur und der Operette „Die Rose
von Stambul". 1970 übernimmt Helmut Sachers von seinem Vater das
Geschäft. Zwei Säcke Rohkaffee wurden damals pro Woche geröstet und an
verschiedene Kaffee- und Gasthäuser geliefert. In den folgenden Jahren
erwirbt man mehrere Kaffeefirmen und konzentriert sich auf das Rösten
der schwarzen Bohnen.
In den 1980er-Jahren wächst das Exportgeschäft stark. Sogar in der
Mongolei und in Nordkorea wird Helmut Sachers Kaffee getrunken. Der
Firmensitz in Wien wird bald zu klein, daher zieht man 1988 nach
Oeynhausen, 1991 wird weiter ausgebaut. Aus den zwei Säcken Rohkaffee
pro Woche sind inzwischen 700 Tonnen pro Jahr geworden. Nach „52 Jahren
Kaffee" zieht sich Helmut Sachers 2013 aus dem Unternehmen zurück und
verkauft es.

Weltmeister Fußbälle aus Traiskirchen - Österreichische Linoleum-, Wachstuch- und Kunstlederfabrik ÖLW
1873 erwirbt Leopold Ramminger, der Pächter des Möllersdorfer
Gemeindeziegelofens, ein Grundstück zwischen Wiener Neustädter Kanal
und Badener Straße. Hier eröffnet er 1876 ein Ziegelwerk mit einem
Ringofen, in dem Ziegel ohne Unterbrechung gebrannt werden konnten.
1912 verkauft Theresia Ramminger, die Schwiegertochter des Gründers,
das Ziegelwerk an Arthur Straetz, der das Werk auf maschinelle
Ziegelfertigung umstellt. Drei Jahre später wird der Betrieb
geschlossen. 1922 übernehmen Leopold Blum und Leopold Haas das
ehemalige Ziegelwerk und errichten eine modern ausgestattete
Fabriksanlage für ihr Unternehmen Österreichische Linoleum-,
Wachstuch-und Kunstlederfabriken AG, kurz ÖLW. Produziert werden
Kunststoffe für den Inlandsbedarf und den Export. 1938 wird das
Unternehmen „arisiert", von den Rheinischen Linoleumwerken Bedburg
übernommen und in Wiener Linoleum Wachstuchwerke umbenannt.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Fabrik als USIA-Betrieb unter
sowjetischer Verwaltung weitergeführt. 1955 kommt es zur Rückgabe an
die aus der Emigration in die USA zurückgekehrten Gründer, 1958 kauft
der Semperit-Konzern die Anlage. 1974 übernimmt die Firma JOVELD die
Aktienmehrheit an ÖLW. Im Zuge eines Ausgleichsverfahrens erwirbt 1986
die Schweizer Firma IKOTEX AG diesen Anteil. Die ÖLW produziert im Werk
Traiskirchen bis zur Betriebsschließung im Jahre 2008 neben Linoleum
auch Kunststoffbeschichtungen, Kunstleder, Folien sowie Fußbälle, die
bei den Europa- und Weltmeisterschaften eingesetzt werden. Darüber
hinaus wurden auch Textilien bedruckt, imprägniert und konfektioniert
(fertiggestellt). Im ehemaligen Firmengelände sind heute zahlreiche
Gewerbebetriebe untergebracht.

Matador ist ein Holzbaukasten.
Er wurde von Johann Korbuly um 1900 erfunden. Es war das erste
Baukastensystem mit dem man bewegliche Modelle bauen konnte. "Alles
dreht sich und bewegt sich" war der bekannte Werbeslogan. Lange Zeit
hatten die Korbuly's ihre Werkstätten in Pfaffstätten. 1978 verkaufen
sie die Firma an den Zeitungsverleger Kurt Falk. Dieser produzierte
noch bis 1987, dann wurde der Betrieb eingestellt. Die Familie Tobias
kaufe 1995 die Patente und jetzt wird Matador im Waldviertel erzeugt.
Mit Stäbchen können Klötze, Brettchen, Platten und Streben verbunden
werden. Die Räder, Zahnräder und Achsen machen die Modelle beweglich.
Das wichtigste Werkzeug ist der Hammer. Nach Vorlagenheften können
einfache, aber auch sehr schwierige Modelle gebaut werden.

1901 Johann Korbuly erhält das Patent für den Matador Holzbaukasten
1903 Beginn der Erzeugung und Vermarktung von Matador
1905 Die erste Matador Zeitung wird herausgegeben
1913 Eröffnung des Geschäftes in der Mariahilfer Straße
1915 Erwerb der Preiß Mühle am Wiener Neustädter Kanal in Pfaffstätten
1920 Verlagerung der Produktion in das neue Werk nach Pfaffstätten
1945 Werk abgebrannt, Neubau und Wiederaufnahme der Produktion
1978 Verkauf der Fabrik und der Markenrechte an Kurt Falk
1987 Einstellung der Produktion im Werk Pfaffstätten
1996 Erwerb der Markenrechte durch Michael Tobias
1997 Wiederentwicklung, Beginn der Produktion in Tschechien
1998 Verlagerung der Produktion nach Österreich (Waidhofen/Thaya)
2003 Werk in Pfaffstätten durch Brand beschädigt, später abgerissen

Am 10. April 1903 wurde Johann Korbuly vorn kaiserlichen Patentamt in
Wien das Privileg zur Erzeugung von Holzspielwaren erteilt. Bereits
1904 stellte Johann Korbuly seine Erfindung bei der Leipziger Messe
aus. 1909 wurde ein „Matador-Haus" in Berlin eröffnet und 1913 eines in
der Mariahilfer Straße in Wien. 1915 kaufte Johann Korbuly sen. die
ehemalige Preyssmühle am Wr. Neustädter Kanal in Pfaffstätten als
Produktionswerkstätte. Ca. 1920 verließ der erste Matadorbaukasten das
Werk in Pfaffstätten. Ab 1935 führte Johann Julius Korbuly als
Alleinbesitzer und Geschäftsinhaber bis 1978 den Betrieb.

Der Wiener Zeitungsverleger Kurt Falk kaufte dann die Fabrik und führte sie bis zur Schließung 1987.
Ing. Michael Tobias erwarb 1995 die Markenrechte und begann mit der
Neuproduktion des Baukastens. Durch einen Brand in der Fabriksruine in
Pfaffstätten im Jahr 2001 wurden die Mitarbeiter des Traiskirchner
Museums auf verbliebene Matadorteile aufmerksam und stellten sie für
das Museum sicher.

Der Neffe vom verstorbenen Johann Korbuly, Rudolf Korbuly, ein Freund
und Gönner des Museum Traiskirchen hatte die Idee, 2003 eine große 100
Jahr Ausstellung zu organisieren. Der große Erfolg dieser Schau
ermutigte die Museumsleitung, eine Dauerausstellung daraus zu machen.
Mittlerweile ist das „Matadormuseum" auf mehrere hundert Baukasten und
Ausstellungsobjekte angewachsen. Im Schauraum befinden sich bereits
Bauteile und „Schaufenstermodelle" aus ganz Österreich und Deutschland.
Im Laufe der Zeit ist das Museum Traiskirchen zur Anlaufstelle für
Matadorsammler und spielzeuginteressierte Besucher geworden.

Am 25. und 26. Dezember 1805 wurde zwischen Kaiser Napoleon u. Kaiser
Franz I. der sogenannte "Friede von Pressburg" geschlossen. Mit diesem
Vertrag endete der 3. Koalitionskrieg. Am 2. Dezember 1805 verloren die
vereinigten österreichisch-russischen Truppen die Schlacht bei
Austerlitz, genannt die "Dreikaiserschlacht" in Mähren, und Kaiser
Franz I. musste sehr harte Friedensbedingungen unterzeichnen. Diesem
Umstand ist es zu verdanken, dass Napoleon, der berühmte Feldherr, hier
bei uns in Möllersdorf und in anderen Gegenden um Wien eine Parade oder
Revue abhielt, um der Bevölkerung die Größe der französischen Nation
vorzuführen. Der Platz war gut gewählt, auf der sogenannten
"Reichlwiesn" zwischen der Margaretenkirche und dem ehemaligen
Jagdschlössel von Kaiserin Maria Theresia. Die Begeisterung der
Bevölkerung hat sich wohl in Grenzen gehalten, da es ja fast in jedem
Hause Einquartierungen gab. Die Bauern mussten gratis Vorspanndienste
leisten, sowie Hafer, Heu, Brot, Mehl, Wein und andere Lebensmittel an
die Besatzer abliefern. In Traiskirchen war 1805 die
Kreishauptmannschaft für das Viertel unter dem Wienerwald untergebracht
und diese hatte den Status einer Bezirksbehörde und das Kreisamt hatte
sich um die Sorgen und Nöten der Bevölkerung zu kümmern. Die
verkehrstechnisch günstige Lage von Traiskirchen hatte aber auch zur
Folge, dass sich hier viele neue Betriebe ansiedelten, wie Schmiede,
Wagner und Gasthöfe. Eine Reise mit einem schweren Pferdefuhrwerk von
Wien nach Wienerisch-Neustadt dauerte einen ganzen Tag, also mussten
Ross und Reiter und Kutscher in Traiskirchen einige Stunden Mittagsrast
halten.
Zinnfiguren 1805-1812
Die Figuren zeigen Soldaten aus der napoleonischen Zeit in bunten
Uniformen aus verschiedenen Ländern, Städten und Fürstentümern in 70
verschiedenen Waffengattungen. Soldaten von unterlegenen Gegnern
mussten zwangsweise militärische Dienste in den Uniformen des
Siegerlandes leisten. 1805 marschierten rund 30.000 Mann, mit Ross und
Reiter durch Baden, Traiskirchen und Pfaffstätten. Die Unterbringung
und Verpflegung war für die Bevölkerung und die Gemeinden eine
Herausforderung und mit hohen Kosten verbunden. Der Wein aus
Traiskirchen und Pfaffstätten war das beliebteste Zahlungsmittel. Höher
gestellte Offiziere logierten standesgemäß in Baden.

Das Stadtgebiet von Traiskirchen wurde erstmals von den Kelten im 4.
Jahrhundert v. C. besiedelt, später errichteten die Römer eine Straße
zwischen Baden und Carnuntum, die durch das Stadtgebiet führte.
Traiskirchen selbst entstand um ca. 1.000 n. Chr. Zur etwa gleichen
Zeit floss auch schon der Mühlbach, der für die Industrialisierung der
Gemeinde eine bedeutende Rolle spielen sollte durch den Ort.
Unterschiedliche politische Einflüsse – etwa die Habsburger oder das
Stift Melk – begleiteten Traiskirchen durch das Mittelalter bis in die
Neuzeit. 1514 erhielt die Gemeinde das Marktwappen. 1848 wurden
Möllersdorf und Wienersdorf eingemeindet. Die Stadterhebung erfolgte am
30. Juni 1927. Seit 1972 ist Traiskirchen mit Oeynhausen und
Tribuswinkel zur Großgemeinde geworden.

Der Schwerpunkt unserer Spielzeug-Sammlung liegt bei zwei
Baukasten-Systemen, die schon vor mehr als 100 Jahren Kinderherzen
erfreut haben. Dutzende Matador-Modelle etwa können im Museum in
Bewegung gesetzt werden, an einem Spieltisch können die Kinder (oder
auch ihre Eltern oder Großeltern) selbst Hand anlegen. Auch von den
erstmals 1880 produzierten Anker Steinbaukästen hat das Museum eine
umfangreiche Sammlung. Aber auch historische Puppen, Autos,
Blechspielzeug, Brettspiele, Papiertheater und Puppenküchen sind
ausgestellt.

Das Museum Traiskirchen zeigt die Entwicklung der Technik über einen
Zeitraum von mehr als 100 Jahren, beginnend mit einfachen Werkzeugen
für den alltäglichen Gebrauch in Handwerk und Landwirtschaft. Mit der
industriellen Revolution änderte sich neben den Werkzeugen auch der
Arbeitsalltag der Bevölkerung. Dampfmaschine, Druckerei und auch die
technische Entwicklung in der Textilindustrie belegen diesen Wandel.

Die 1824 gegründete Kammgarnspinnerei, die älteste Industrieanlage
Traiskirchens, ist heute Heimat des Museums. Traiskirchen und das Thema
Industrie waren jahrzehntelang eng verknüpft und sind bis heute ein
wichtiger Bestandteil der Stadtgeschichte und des
Sammlungsschwerpunktes des Museums. Der Reifenproduzent Semperit, die
Vereinigten Färbereien, die Kammgarnspinnerei, zahlreiche Ziegelwerke,
chemische Fabriken, die Österreichische Linoleum- und Wachstuchfabrik
und v. a. hatten ihre Standorte im Ortsgebiet von Traiskirchen.


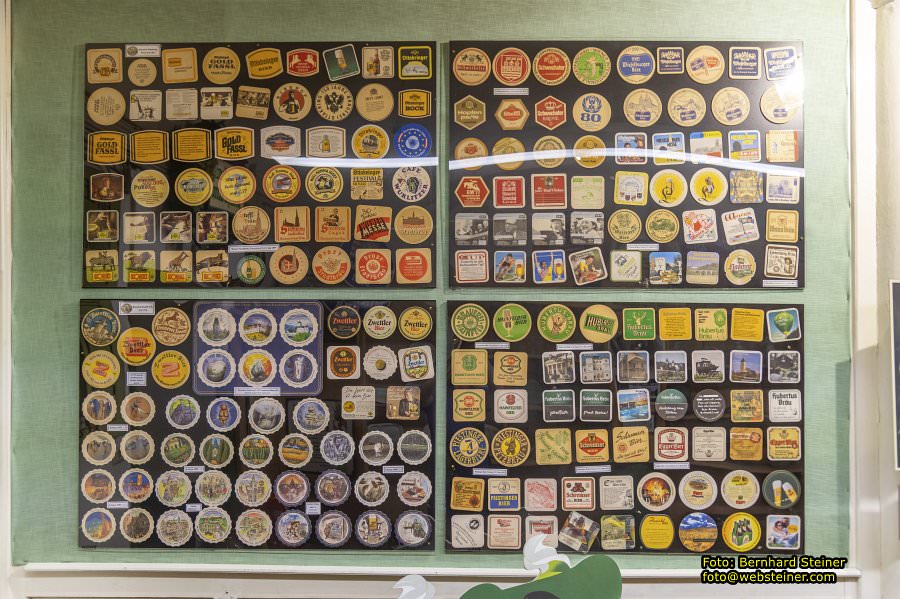

BAUMPRESSE - Diese Weinpresse aus dem Jahre 1803 stand bis 1993 im
Hause der Familie Hedwig u. Franz SIMONIC in der Wienersraße 65,
Traiskirchen. Dises Museumsstück wurde im Jahre 1942 von einem
Zimmermann überholt (siehe Eintragung auf Holzwinkel ) und stand bis
1975 in Verwendung.

Mineralien, auch Minerale genannt, sind chemisch und physikalisch
einheitlich strukturierte Bestandteile unserer Erdkruste. Sie sind fast
ausschließlich anorganische Verbindungen. Das Überleben der Menschheit
sowie die geistige und kulturelle Entwicklung sind ohne ihre Nutzung
nicht möglich. Wurden sie zu Beginn ihrer Entdeckung als Rohstoff für
Werkzeuge und andere Arbeitsbehelfe eingesetzt, gehören sie heute, dank
ihrer vielfältigen Verwendung, zum Alltag. So sind Mineralien für
verschiedene Industriezweige und Gewerbebetriebe nicht mehr weg zu
denken. Schließlich ist ihr Einsatz in der Schmuckindustrie besonders
beliebt.
Insgesamt sind derzeit über 2000 Minerale bekannt.

Immer wieder wecken Mineralien auch das Interesse von Sammlern. Dies
wurde auch für einen unserer Mitarbeiter zur Leidenschaft. Herr Rudolf
Seyf sammelte Zeit seines langen Lebens aktiv Mineralien.
Seine Exkursionen brachten ihn in viele entlegene Teile
Niederösterreichs. Immer wieder fand er hervorragende Schätze, die er
auf der Karte vermerkte. Er hat uns hiermit eine umfangreiche Sammlung
hinterlassen, die mit Exponaten aus anderen Teile der Erde ergänzt sind.


Streckwerk an einer Vorspinnmaschine

Eigentlich waren die Mühlen und die Wasserkraft des Mühlbaches und des
Wiener Neustädter Kanals der Motor für den Beginn der
Industrialisierung. Danach wurde die Geschichte Traiskirchens viele
Jahre von Schloten und Shed-Dächern geprägt. Die hier ansässigen
Industriebetriebe prägten das Stadtbild. Firmen wie ÖLW, Mully,
Kammgarn, Blaschke, IMCO und natürlich Semperit haben für weit mehr als
ein Jahrhundert das Leben in der Stadt wirtschaftlich und
gesellschaftlich beeinflusst.
Grund genug für das Museum Traiskirchen, in dieser Sonderausstellung
die Geschichte und den Werdegang einiger Betriebe zu erzählen und ihre
Bedeutung für die Stadt und die Region hervorzuheben. Gezeigt werden
etwa, was Adidas-Fußbälle mit Traiskirchen zu tun haben. Oder welche
Schokolade einst in Tribuswinkel erzeugt wurde. Oder wussten Sie, dass
in Möllersdorf jahrelang Mechaniken für bekannte Wiener Klavierfabriken
hergestellt wurden? Ab April 2022 ist diese Ausstellung, die in einer
Kooperation mit dem Masterlehrgang für Innen-architektur & visuelle
Kommunikation der New Design University St. Pölten entstanden ist, im
Museum Traiskirchen zu sehen.




Traiskirchen liegt an einer alten Handelsroute. Der Handel hat die
Menschen näher zusammen gebracht und hat den allgemeinen Wohlstand
vermehrt. Im Museum können Besucherinnen und Besucher heute in der
einzigartigen Ladenzeile in alte Geschäfte und Handwerksbetriebe
eintreten, die Zeugen einer vergangenen Epoche sind.

Bäckerei um 1920
Das erste Brot entstand wahrscheinlich vor 8.000 Jahren. Grassamen
wurden gesammelt, zu Mehl gemahlen und mit Wasser vermischt. Dieser
Brei wurde über heißer Asche auf einem Stein gebacken. Ungeachtet der
vielen verschiedenen Brotsorten und trotz moderner Herstellungsmethoden
ist das Brot seit dern Ende der Steinzeit in seinen Hauptbestandteilen
gleich geblieben: Der Teig wird aus Mehl, Wasser oder Milch unter
Zusatz von Hefe bzw. Sauerteig und einer Prise Salz eingerührt,
geknetet, geformt und dann im Ofen gebacken. Brotmehl kann aus Weizen,
Dinkel, Roggen, Gerste oder Hafer gemahlen werden. Diese Getreidearten
besitzen einen relativ hohen Anteil an Klebern (Gluten), durch die der
Teig zusammengehalten wird.

Die Geräte, vom Backtrog, der Teigschere bis zum Simperl, dem
geflochtenen Strohkorb, wurden in allen österreichischen Bundesländern
verwendet. Auch die Arbeitsweise, das Teig kneten bis zur Bestimmung
der Gewürzart und -menge wurde von Generation zu Generation
weitergegeben. Bis ins 18. Jahrhundert gab es nur Schwarzbäckereien, da das
Schwarzbrot ein Volksnahrungsmittel war. Weizen war zu teuer und wurde
nur in der gehobenen Klasse zum Kochen verwendet. Um 1900 wurden Weiß-
und Schwarzbrote hergestellt. Jedoch war das Weißbrot, in Form von
Brezen oder Kipferln weiterhin nur den reichen Leuten vorbehalten. Das
Schwarzbrot blieb den ärmeren Bevölkerungsschichten. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts kauften die Leute das Mehl und den Sauerteig selbst ein,
mischten und formten ihr Brot und ließen es beim Bäcker backen. Meist
war der eigene Küchenofen dafür nicht geeignet. Dieses Brot nannte man
„Störbrot", da man den Bäcker bei der Arbeite „störte".

Die meisten Bäckerbetriebe hatten einen Backofen aus Lehm, der mit Holz
und Reisig beheizt wurde. Die Bäckerlehrlinge spielten eine wichtige
Rolle, da sie doch billige Arbeitskräfte waren. Meist bekamen sie nur
„Kost und Quartier" als Bezahlung. Täglich, ab ca. 1 Uhr nachts, hatten
sie den Backofen zu heizen. Nach der Arbeit in der Backstube mussten
sie, meist mit dem Fahrrad, Körbe mit noch warmen Brot und Gebäck rasch
zu den Kunden „ins Gai" fahren. Ein 14-16 Stunden Arbeitstag war keine
Seltenheit.

Schuster
Fruher wurden alle Schuhe individuell für den Träger maßgefertigt. Der
Schuhmacher übte seine Tätigkeit in kleinen Werkstätten aus, die sich
meist im Kellergeschoss befanden. Der Verkaufsraum war entweder
gleichzeitig die Werkstätte oder ein kleiner Vorbau. Der Schuster
musste folgende Arbeitsschritte beherrschen: Anfertigen von
Fußumrisszeichnungen, Trittspuren und Abwicklungshilfen, Bearbeitung
von Bodenmaterial (Brandsohle, Laufsohle) und Absätzen, Wissen über
Werkzeuge und Maschinen, Kenntnisse der Lederarten, Kenntnisse der
Anatomie des Fußes und des Beines.

Der Beruf des Schusters erforderte keine hohen körperlichen
Anforderungen, doch eine volle Beweglichkeit der Finger und Arme.
Außerdem waren ausreichendes Tastvermögen und gutes räumliches Sehen
notwendig. Um das Lampenlicht auf die Arbeitsfläche zu konzentrieren,
verwendete der Schuster die so genannte „Schusterkugel" eine mit Wasser
gefüllte Glaskugel - als Linse.

Weitere Arbeitsbehelfe des Schusters waren: Modellfüße aus Holz
(„Last"), Reparaturmaschine, Ausputzmaschine, Eisenständer zum
Beschlagen der Schuhe, „Holzwaden", verschiedene Scheren, Holznägel,
Ösen, Sohlen und Schnittmuster. Nach dem 2. Weltkrieg hatten die
Schuster viel Arbeit, denn sie fertigten auf Bestellung auch Schuhe für
Gendarmerie und Gemeinde an. Damals wurden oft drei Gesellen und zwei
Lehrlinge beschäftigt. Um 1950 gab es In Möllersdorf noch zehn
Schuhmacher. Der letzte von ihnen schloss 1995 endgültig seine
Werkstatt.

Traiskirchen liegt an einer alten Handelsroute. Der Handel hat die
Menschen näher zusammengebracht und den allgemeinen Wohlstand vermehrt.
Im Museum können BesucherInnen heute in der einzigartigen Ladenzeile in
alte Geschäfte und Handwerksbetriebe eintreten, die Zeugen einer
vergangenen Epoche sind: Die Geschäftslokale Bäckerei, Greißler,
Eisenwarenhandlung, Apotheke, Modewarengeschäft, Fleischerei,
Milchgeschäft und die Trafik waren allesamt im Ort ansässig und wecken
bei älteren Personen Erinnerungen an die Kindheit.

Die Schusterwerkstatt, der Friseur, der Hutmacher, die Tischlerei, der
Fotograf sind originalgetreu nachgebaut und machen den Eindruck, als
hätte der Handwerker gerade die Werkstatt kurz verlassen. Zahlreiche
Alltagsgegenstände gehören zu dieser Sammlungsgruppe.


In der Tischlerei
Die Arbeit eines Tischlers war seit jeher hart und mühsam. Früher
musste alles mit der Hand hergestellt werden, vom Zuschneiden bis zum
Hobeln. Dazu wurden die primitivsten Arbeitsmittel verwendet. Zum
Zuschneiden verwendete man eine Säge, zum Hobeln einen Hobel und zum
Bohren benutzte man noch so genannte Handbohrer. Heutzutage gehen diese
Arbeiten schon wesentlich einfacher, da das Meiste mit Maschinen
gemacht wird. In den vergangenen Zeiten fertigte man zumeist
Einzelstücke an. Heute bieten große Möbelgeschäfte Serienmöbel jeder
Art an.

Ein Tischler vom „alten Schlag" war Karl Staska aus Wienersdorf. Seine
Werkstatt ist hier im Museum ausgestellt. Hier sind auch noch einige
seiner wichtigsten Werkzeuge und Maschinen, wie zum Beispiel eine
Hobelbank, eine Drechselbank, Handbohrer, ein alter Leimofen, Sägen,
Winkel, Wasserwaagen, Feilmaschinen, Laubsägen und natürlich viele
Hobel. In einer Tischlerei werden in der Regel Türen, Fenster und Möbel
hergestellt. Es gab und gibt aber auch Tischler, die sich auf die
Restaurierung alter Möbel spezialisiert haben.

Friseur
Schon die Ägypter, Griechen und Römer investierten viel Zeit in die
Körper- und Schönheitspflege. In den Pyramiden fand man Rezepte zur
Herstellung von Salben, Haarwuchsmitteln und Haarfarben. Weiters
verwendeten die Ägypter auch zahlreiche Mittel zur Schönheitspflege,
wie zum Beispiel Schminke, Lippen- und Augenbrauenstifte; Farben zum
Färben der Haare und Nägel sowie Bronzerasiermesser. Die Ägypter trugen
auch tressierte Perücken aus Seidenfäden. Irn Mittelalter wurde die
Körper- und Schönheitspflege von Badern und Barbieren in den
Badenstuben ausgeübt. Die Badestuben dienten der gesamten Haar- und
Gesundheitspflege. Obwohl die Handwerkszünfte im Spätmittelalter hohes
Ansehen genossen, waren die Bader- und Barbierzünfte nur sehr gering
geschätzt. Der Grund dafür war, dass die christliche Kirche, die auch
das öffentliche Leben beherrschte, mit dem lockeren, oft freizügigen
Treiben in den Badestuben nicht einverstanden war. Erst gegen Ende des
Mittelalters wurden die Bader-und Barbierzünfte vom Augsburger
Reichstag zu ordentlichen Zünften erklärt.
Zu Beginn der Neuzeit bestimmte vor allem das französische Hofleben die
Schönheitspflege. Dadurch erlangte der Frisörberuf enormes Ansehen. Den
Auftakt zu dieser Entwicklung gab die Perückenmode, die von den
französischen Königen Ludwig XIII. und Ludwig XIV. am Hof eingeführt
wurde. Aus diesem Grund entstand in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts das Perückenmachergewerbe. Am Anfang des 18. Jahrhunderts
entwickelte sich ein neuer, mächtiger Berufszweig, der Damenfrisör. Er
verstand es vor allem, sehr phantasievolle und künstlerische
Damenfrisuren herzustellen. Nach der Französischen Revolution kamen die
übertriebenen Damenfrisuren aus der Mode und wurden abgeschafft.
Dadurch wurde der Blütezeit der Perückenmacher und Damenfrisöre ein
Ende bereitet. Weiters wurden die Zünfte aufgelöst und die
Gewerbefreiheit eingeführt. Das Zeitalter der Erfindungen übte auch auf
den Frisörberuf erheblichen Einfluss aus. Denn die Erfindung der
Ondulation verschaffte derm Damenfrisör neue Kunden und Arbeit. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts führte die Erfindung der Dauerwelle und die
Verbesserung der Haarfärbe- und Blondiertechnik erneut zu einem
beruflichen Aufschwung. Nach dem 2. Weltkrieg kam zu diesen Erfindungen
und Entwicklungen noch die Kaltwelle hinzu.

Rudolf Seyf, Friseurmeister in Baden
Rudolf Seyf, geboren am 22. Jänner 1913 in Wien, ist in Günselsdorf
aufgewachsen. Er besuchte die dortige Volksschule und anschließend die
Bürgerschule (Hauptschule) in Baden. Damals war es möglich mit 14
Jahren die Schule zu verlassen und sich eine Lehre zu suchen. Herr Seyf
wollte Kaufmann werden, doch eine passende Lehrstelle war in Wr.
Neustadt, Mödling und Baden nicht zu finden. Bei dem Damen- und Herrenfriseur Winterstein in Baden wurde er
schließlich aufgenommen. Die Lehrzeit betrug 4 Jahre. Die
Öffnungszeiten des Salons waren täglich von 8 bis 19 Uhr und sonntags
von 8 bis 12 Uhr. Der Betrieb hatte 12 Damenkabinen und 4 Herrenplätze.
Es waren 5 Lehrlinge beschäftigt, die alle Putzarbeiten machen mussten.
An einem Tag in der Woche mussten sie nach Mödling in die Fachschule.
Jeder hatte einen freien Tag. Urlaub gab es nie und die Bezahlung war
minimal. Die Strapazen der Lehrzeit waren sehr groß. Herr Seyf, zum
Beispiel, musste täglich zu Fuß von Günselsdorf nach Leobersdorf gehen
und dann mit der Bahn nach Baden fahren und nach Arbeitsschluss wieder
retour. Im Jahre 1928 wurden in diesem Salon die ersten Dauerwellen
gemacht.

Vom Fotografen
Schon lange vor der ersten Kamera waren die Naturwissenschaftler von
der cámera obscura fasziniert. Sie hatten einen Lichtstrahl durch ein
kleines Loch in einen finsteren Raum geschickt und die dabei
entstehende seitenverkehrte und am Kopf stehende Abbildung zu ergründen
versucht. Die erste erhaltene Fotografie wurde 1826 oder 1827 nach
zahlreichen Versuchen von Joseph Nicéphore Niépce hergestellt. 1829
schloss er sich mit Louis-Jacques-Mandé Daguerre zusammen, der 1823
eine Kamera mit Jod-Silberplatten entwickelt hatte. Das Ergebnis ihrer
Zusammenarbeit war die 1837 erfundene Daguerreotypie. Die französische
Regierung kaufte das Verfahren und stellte es der Öffentlichkeit
kostenlos zur Verfügung. Da das Trägermaterial der Daguerreotypie eine
versilberte Kupferplatte war, konnten die Bilder nicht vervielfältigt
werden.
Dieses Problem löste die in England von Henry Fox Talbot erfundene
Kalotypie (auch Talbotypie genannt), patentiert 1841: Talbot verwendete
sensibilisiertes Papier für die Aufnahme. Das entstandene Negativ
konnte durch das durchscheinende Papier beliebig oft umkopiert werden,
wobei idente Papierpositive entstanden. 1851 entwickelte Frederick Scott Archer das
Kollodium-Naßplatten-Negativverfahren, das Glasträger verwendete und
durch eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit kürzere
Belichtungszeiten (unter einer Minute) erlaubte.
Ab 1879 eroberte das einfachere
Silberbromid-Gelatine-Trockenplattenverfahren (erfunden von Richard L.
Maddow 1871, von C. H. Bennett 1878 verbessert) den Markt. Erste Farbaufnahmen wurden mit aufwendigen Methoden zwischen 1903 und
1907 hergestellt, die Autochromeplatte von 1907 gilt als das erste
praktikable Farbverfahren.

Die Kleinbildfotografie basiert auf der Erfindung des Zelluloids (1887
von H. Goodwin entwickelt, ab 1889 von der Eastman Dry Plate and Film
Company als Trägermaterial eingesetzt) und der Kleinbildkamera Leica.
Die moderne naturfarbige Kleinbildfotografie beginnt 1936, den ersten
Farbnegativfilm präsentierte Kodak 1941 (Kodacolor).
Das erste Sofortbildsystem war Polaroid 1945.
Still Video war der Vorgänger der heutigen Digitalfotografie. Die
ersten Digital Still Video Kameras speicherten noch auf
3,5-Zoll-Disketten. Heutige Digitalkameras speichern auf
Speicherkarten, die die Flash-Technologie nutzen. Da die Bilddaten nun
schon digital vorliegen, entfällt der Arbeitsvorgang des Scannens, wenn
man ein Bild im Computer bearbeiten, in eine Publikation einbauen oder
im Internet veröffentlichen will. Der große Nachteil der digitalen
Fotos ist, daß niemand weiß, wie lange die Datenträger, auf denen sie
gespeichert sind, halten werden und ob es später noch Geräte geben
wird, die diese Datenträger lesen können (Obsoleszenz der Hardware).
Fotos auf Glas/Film oder Fotopapier hingegen können bei optimaler
Lagerung jedenfalls über 150 Jahre alt werden, wahrscheinlich auch noch
viel älter.
Die Ausstellungskoje
Gleich vor der Koje wird eine Plattenkamera ausgestellt. In ihr wurden
Glasnegative belichtet. Daneben ist ein schmaler grüner Kasten zu
sehen, in dem man die entwickelten Bilder zum Trocknen aufhängte. In
einer Glasvitrine vor dem Eingang befinden sich alte Blitzgeräte.
Früher entzündete man Blitzpulver, das mit einer kleinen Explosion das
gewünschte Motiv kurz aufhellte. Da das Fotomaterial noch relativ
lichtunempfindlich war, öffnete man zuerst das Objektiv, entzündete
dann das Blitzpulver und deckte das Objektiv anschließend mit dem
Objektivdeckel wieder zu. Da die Dosierung des Blitzpulvers eine heikle
und auch gefährliche Sache war, kamen als Abhilfe teebeutelartige
Beutelblitze auf, in denen sich eine angemessene Menge Blitzpulver
befand. Mittels eines Ringes konnte der Beutelblitz beispielsweise an
einem Besenstiel befestigt werden, zum Anzünden gab es eine Lunte. In
der Vitrine vor der Koje befinden sich einige Päckchen solcher
Beutelblitze.
In der Koje auf der rechten Seite steht ein Glaskasten, in dem
zahlreiche ältere Kameras gesammelt sind. Bis in die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts waren Boxkameras üblich. Daneben sind Kompaktkameras
und Spiegelreflexkameras für Kleinbildfilm (Negativ-format 24 x 36 mm)
zu sehen. Auch die kleinste je gebaute Fotokamera für Film, die Minox,
ist vertreten.

In der Nische (links) ist ein kleines Fotolabor eingerichtet. Man
benötigte einst viele Chemikalien, um Fotos herstellen zu können. In
der Frühzeit der Fotografie mußten die Glasplatten noch direkt vor der
Aufnahme händisch beschichtet und sofort nach dem Belichten entwickelt
werden, wodurch der Fotograf seine Dunkelkammer immer mitnehmen mußte.
Heutige analoge Filme sind sofort aufnahmebereit und können bei idealer
Lagerung noch Wochen nach der Aufnahme problemlos entwickelt werden.
Für die Entwicklung eines Negatives reichen heute Entwickler, Stoppbad,
Fixierer, Wässerung und ein Netzmittel. Das Negativ muß immer bei
absoluter Dunkelheit verarbeitet werden.
Gleich rechts neben dem Fenster sind alte Diaprojektoren und
Vergrößerungsapparate ausgestellt. In den Anfangszeiten der Fotografie
bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden recht große Negative eingesetzt,
da diese im Kontaktverfahren direkt auf Positivmaterial umkopiert
wurden. Erst die mit fortwährenden Verbesserungen möglich gewordenen
immer höher auflösenden Filmemulsionen erlaubten kleinere
Negativformate und machten damit Vergrößerungsapparate notwendig. Man
unterscheidet Vergrößerungsapparate für Klein-, Mittel- und
Großformatnegative und Schwarzweiß- von Farbvergrößerern. Beim
Vergrößern von Schwarzweißmaterial kann eine Dunkelkammer-Beleuchtung
verwendet werden, deren Farbe vom verwendeten Material abhängt; meist
ist sie rot oder rotorange, manchmal gelbgrün.

Analoge Fotografien werden bis heute von Amateuren wie Profis
hergestellt und vergrößert. Auch Sofortbildverfahren werden heute noch
von verschiedenen Herstellern angeboten (Fuji, Impossible als
Nachfolger von Polaroid). Zahlreiche Kameras können aber nicht mehr
genutzt werden, weil keine passenden Filme oder Filmkassetten mehr
erhältlich sind (z. B. Instanatic, Disc, APS, Polaroid i-zone).
Professionelle Kameras erlauben es, den hinteren Teil der Kamera, der
üblicherweise den Blattfilm (bei Fachkameras) oder den Rollfilm
(Mittelformatkameras, z. B. Hasselblad) enthält, gegen ein digitales
Rückteil auszutauschen und somit alle vorhandenen Objektive
weiterzuverwenden.

Über das Tabakrauchen
Franz Scholz aus Altruppersdorf schreibt 1984 im Mitteilungsblatt der
ARGE der Betreuer Volkskundlicher Sammlungen nachfolgenden Bericht:
PFEIEFENRAUCHEN
„Bis zum 1. Weltkrieg rauchten die Männer durchwegs Pfeifen und
verschmähten Zigaretten. An Zigarren wurden Virginia (Wetschina), Kuba,
Portoriko und die so gen. „Kurzen" geraucht.
Die Pfeife bestand aus Pfeifenkopf, Wassersack, Pfeifenrohr aus
Weichselholz und Pfeifenspitzel. Ein Paket Pfeifentabak kostete 4
Kreuzer 8 Heller. Soldaten fassten beim Militär große Pakete
Kommisstabak und brachten meist große, bebilderte Pozellanpfeifen mit,
die an Sonntagen mit oft 1 m langem Rohr geraucht wurden."
Auf einem bebilderten Pfeifenkopf steht geschrieben: Josef Eiböck,
M.G.Abt., Zugführer, K.u.k. Feldjäger Baon Nr. 21; auf dem Wassersack
Erinnerung an meine Dienstzeit und in Kurrentschrift der Spruch:
Ich rauche mein Pfeifchen mit kräftigen Zügen Und liebe die Mädchen zu meinem Vergnügen
Die Pfeifenrohre waren aus Weichselholz und wurden zum Teil in unserem
Gebiet erzeugt. Im Buch „Gebiet des Schwechatflusses in
Nieder-Österreich 1878" finden wir vermerkt: „Die Wurzeltriebe der
Mahaleb-Traubenkirsche, die auf dem Kalkgebirge des Wiener Beckens von
Mödling über Baden, Kottingbrunn und weiter südwärts gemein ist, werden
als Steinweichsel, Badner Weichsel oder „türkische Weichsel" zu
Pfeifenröhren und Cigarrenspitzen verarbeitet und erfreuen die Raucher
mit ihrem würzigen Geruch. In der Umgebung von Baden wird seit 55
Jahren die Zucht von Steinweichsel-Stämmchen für Tabakpfeifenrohre u.
dgl. in eigens hierzu angelegten Gärten betrieben. Gegenwärtig beträgt
die Gesamtfläche dieser Gärten ungefähr 70 Hektar. Es werden jährlich
im Durchschnitt 500.000 Stämmchen in langen Stöcken gewonnen. Um 1820
kam der Badener Drechslermeister Trenner auf die Idee aus den 2-3
jährigen Trieben der Steinweichsel Pfeifen und Gehstöcke herzustellen.
Diese Produkte wurder weltweit verkauft. Etliche Tribuswinkler Bauern
stellten ihre Gründe für die Kulturen zur Verfügung. Von der Weißen
Brücke bis zur Ötker am Kanal gab es Weichselgärten.

Maurerhölzel
Wir haben im Museumsgasthaus einen Aschenbecher aus Steingut mit einem
Aufsatz für Schwefelzündhölzer, der rund geformt und mit Abreibringen
versehen ist. An den Abreibringen konnte man die Schwefelhölzer, deren
geschwefeltes Ende einen Überzug von Phosphor und chlorsaurem Kalium
hatte, an jeder Reibfläche, wie an der Hose, an der trockenen
Schuhsohle, an der Wand usw. entzünden. Es dauerte ein Weilchen, bis
der Schwefel verbrannt war und man Feuer machen oder die Pfeife
anzünden konnte. Und weil es eine Weile dauerte, bis man eine schöne
Flamme hatte, war es für die Maurer, die ja damals (bis nach dem 1.
Weltkrieg) fast alle Pfeifenraucher waren, eine willkommene
Unterbrechung der Arbeitszeit, und sie mussten gar oft die Pfeife
anzünden. Deshalb nannte man diese Zünder Maurerhölzel. Zu kaufen bekam
man sie in Papierbehältern und die Leute hatten Metallbehälter, in
denen man sie mittrug. Seit 1907 ist die Verwendung von gelbem Phosphor
verboten. Seither sind die Sicherheitszünder eingebürgert, die um 1850
in Deutschland erfunden, von Schweden her aber in den Handel gebracht
wurden. Die Hölzchen sind mit Paraffin getränkt und tragen eine
sauerstoffreiche Zündmasse, die sich nur an einer Reibfläche entzündet.
Diese enthält Schwefelantimon, roten Phosphor, Leim und Glaspulver

Tabakschnupfen
Bis zum 1. Weltkrieg schnupften noch viele Männer. Bot man eine Prise
an, so ging dies nach bestimmten Regeln und eine Verweigerung war
gleichbedeutend mit Beleidigung und man musste eine Prise nehmen, auch
wenn es einen als Nichtschnupfer durch einen Niesanfall geradezu
zerriss. Wenn ein alter Mann einem jungen Menschen eine Prise anbot, so
war dies eine Auszeichnung. Während des 1. Weltkrieges bekam man schwer
den duftenden Schnupftabak und dann starben „die Schnupfer" aus.
Übrigens behaupteten geeichte Schnupfer, dass man durch Schnupfen einen
klaren Kopf bekäme.

Das Hutgeschäft
Das Gewerbe des Hutmachers oder der Modistin ist im Aussterben. Um das
Jahr 1900 war der „Florentinerhut" ein Renner, vor allem bei der
adeligen Gesellschaft. In Traiskirchen gab es ein Hutgeschäft auf dem
Hauptplatz. Heute werden sogenannte Rohlinge „Stumpen" fertig gekauft
und dann dem Hut die passende Form gegeben. Ein Zentrum der
Huterzeugung war Unterwaltersdorf. Die dortige Hutfabrik hatte sich auf
die Zylindererzeugung spezialisiert. Die Fabrik wurde nach dem 2.
Weltkrieg geschlossen. Übrigens wurden diese Hüte aus Hasenhaaren
erzeugt.
Die Erzeugung von Damenhüten kann als künstlerischer Beruf angesehen
werden. Man sieht es an den Hüten der englischen Königin Elisabeth II.
Ein guter Zusatzverdienst sind auch die diversen „Dienstkappeln", die
man neben Strohhüten, und Hochzeitshüten auch kaufen kann. Es gibt auch
noch Kinder- und Babyhüte, sowie Golf- und Reitkappen.

In unserem Museumsgeschäft, das übrigens aus Bad Vöslau stammt, konnte
man auch die ehemaligen schönen Dienstkappen der
Bestattungsangestellten im Volksmund auch „Pompfeneberer" genannt,
kaufen. Die darauf befindlichen schwarz gefärbten Marabu- oder
Straußenfedern musste man um 1900 aus Afrika importieren. Das führte
fast zur Ausrottung der Straußenvögel. In der gesamten Monarchie trugen
die höheren Beamten den berühmten Zweispitz als Kopfbedeckung. Der
Zweispitz samt Galauniform und Säbel musste selbst bezahlt werden.

Geschichte der Apotheke
Die Geschichte der Pharrnazie war immer abhängig vom jeweiligen
Menschenbild der Gesellschaft und ihrem kulturellen Niveau. Sie beginnt
mit den vorwiegend rituell motivierten Heilmethoden des Altertums. Es
folgte die Weiterentwicklung in Richtung einer naturwissenschaftlichen
Pharmazie mit Hippokrates Lehre von den Körpersäften und dem
systematischen Einordnen von Heilkräutern im antiken Griechenland sowie
im Römischen Reich. Zur Zeit des Hippokrates richtete man auf der Insel
Kos besondere Räume zur Aufbewahrung der Heilmittel ein. Das Wort
„Apotheke" lässt sich aus dem Lateinischen apotheca und aus dem
Altgriechischen ἀποθήκη apotheke ableiten. Es setzt sich aus apo-:,ab',
,weg' und théke:, Kasten, Abstellraum, Vorratskammer, Behältnis,
Ladentisch, zusammen.
Um 700/800 n. Chr. gab es in der arabischen Welt Drogen- und
Gewürzhändler, die mit heilkundlichen Mönchen als Vorläufer der
Apotheker bezeichnet werden könnten. In Europa befand sich im 12. Jh.
bereits der Berufstand Apotheker. Eine „Medizinalordnung" um 1241 von
Friedrich II. gilt als erste gesetzlich fixierte Trennung der Berufe
Arzt und Apotheker. Ärzte durften keine Apotheke besitzen und
Arzneimittelpreise wurden gesetzlich festgeschrieben, um Preistreiberei
zu verhindern. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wandelte sich das Bild des
Apothekers zu Personen der Oberschicht, die nicht nur Heilpflanzen,
Gewürze und Drogen verkauften, sondern auch selbst Arzneimittel
herstellten. Aus dieser Zeit stammen die ältesten Apotheken Europas,
die noch heute betrieben werden. (Löwen Apotheke in Trier 1241,
Apotheke im Franziskanerkloster in Dubrovnik 1317)

Um eine gute Versorgung der Bevölkerung zu erzielen, wurden im 15. Jh
z. B. in Niederösterreich durch die Landstände sogenannte
Landschafts-Apotheken errichtet. In die Epoche des 16. und 17.
Jahrhunderts fällt die erste Hochblüte der Apotheke. War sie bis dahin
nicht viel mehr als ein mäßig spezialisierter Laden, so entwickelte
sich nun das Selbstbewusstsein des Standes der Apotheker, die zwar vom
Arzt abhängig, für ihn aber ebenso unentbehrlich sind. Im 17. und 18.
Jahrhundert entwickelten sich die Apotheken vom Ort der
Arzneimittelherstellung bedingt durch das Wissen über die Chemie auch
zu einem Ort der Arzneimittelerforschung. Durch die Errungenschaften
der pharmazeutischen Industrie beginnt Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts eine Umstellung der Apotheken. Anstatt Arzneimittel selbst
herzustellen, beschäftigt sich die Apotheke zunehmend mit der Prüfung
der Qualität von Arzneimitteln und der Beratung. Im 21. Jahrhundert hat
sich die Apotheke vielerorts zu einem profitablen und modernen
Unternehmen gewandelt.



Tisch-Trichter Grammophon 1930
Koffer Gramophon engl. Erzeugung 1930

Sammlung Radio- und Phonogeräte - Diese umfangreiche Sammlung, einst
von Ing. Rudolf Schara begonnen, umfasst mechanische Musikinstrumente,
Diktaphone, Magnetophone, Schallplattenwiedergabegeräte,
Schneidegeräte, automatische Musikwiedergabegeräte und eine große
Anzahl von Radiogeräten (von 1924 bis heute)


1952/1953
Stern-Radio Staßfurt RFT Type 9E95 (Gewicht: 115kg)
LW,MW,2xKW,UKW m. Plattenspieler und TB Wechselstrom


Bassenawohnung – „Zimma - Kuchl-Wohnung" um 1930
Wenn Sie nun hier in diesen Räumen stehen, möchten wir Sie gerne in die
30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzen. Es ist dies
eine typische Arbeiterwohnung aus der Zwischenkriegszeit, wie sie in
städtischen und kleinstädtischen Gebieten üblich war. Das Bild des
Arbeiterwohnens war bis zum 2. Weltkrieg geprägt von Wohnungselend und
finanzieller Not. Ein großer Teil der Wohnungen war mit 5-10 Personen
in ein oder zwei Räumen überbelegt. Wie die Arbeiterfamilien in dieser
räumlichen Enge ihren Alltag bewältigten, welche Ansprüche sie ans
Wohnen stellten und wie sie diese trotz finanzieller Knappheit
verwirklichten, soll diese Wohnung veranschaulichen.

Sie bestand aus einem Zimmer und einer multifunktionalen Wohnküche. Im
Gegensatz zur bürgerlichen Küche wurden hier auch andere
Haushaltstätigkeiten erledigt. Es wurde die Wäsche gewaschen, falls
kein Trockenboden vorhanden war, getrocknet und dann auch gebügelt. In
tragbaren Zinkwannen wurde gebadet. Der Küchentisch bildete den
zentralen Punkt im Familienleben. Der Herd, oft ein sogenannter
„Sparherd", wurde mit Holz oder Kohle beheizt und diente der
Warmwasseraufbereitung, dem Kochen und stellte die zentrale Wärmequelle
im Winter dar. Der Wasseranschluss und die Toilette befanden sich am
Gang und wurden von allen Bewohnern eines Stockwerks gemeinsam benützt.
Der Wasserhahn und das dazugehörende klassische Becken aus Email geben
diesem Wohnungstyp den Namen - Bassena.

Zu den üblichen billigen Einrichtungen gehörten ein hoher, zweiteiliger
Schrank, oder Kredenz und eine halbhohe Anrichte, die auch als „halber
Schrank" bezeichnet wurde. Dieser halbe Schrank erfüllte in Küchen ohne
Wasseranschluss die Funktion einer Wasserbank, auf der Schüsseln und
Eimer mit sauberen und gebrauchtem Wasser standen. Ein kleiner, oft in
der Wand eingemauerter Kasten diente als Speis' und Vorratskammer. Im
2. Zimmer, meist ein gemeinsamer Schlafraum, standen die Elternbetten,
Kleiderschränke, eine Kommode und, wenn nötig, Kinderbetten. Bei
Platzmangel war es auch üblich, dass Kinder in der untersten
Kommodenlade oder einfach im Ehebett geschlafen haben.

In besonders kalten Nächten spendete ein kleiner „Kanonenofen" Wärme,
ansonsten wurden die Betten mit angewärmten Ziegelsteinen oder manchmal
auch richtigen Bettwärmern vorgewärmt. Stolz war die Hausfrau auf einen
besonders reichlichen und vor allem schön geordneten Wäschekasten. In
besonderen Notzeiten war es auch üblich, sogenannte „Bettgeher" im Haus
zu haben. Fremde Leute kamen und bezahlten, um sich tagsüber, wenn die
Betten leer standen, darin ausschlafen zu können. Mit dem Beginn des
sozialen Wohnverhältnisse vieler Familien Wohnbaus wurden die
verbessert. Ein eigener Wasseranschluss, eine Toilette und ein
getrenntes Badezimmer erhöhten den hygienischen Standard und auch den
Wohnkomfort.

Waschküche um 1920 - 1970
Das Wäschewaschen im vorigen Jahrhundert war eine sehr anstrengende
Arbeit und wurde meistens von Frauen erledigt. Am Tag vor dem Waschtag
hatte die Wäscherin die Wäsche einzuweichen, um einen guten
Reinigungsefekt zu erzielen. Am Waschtag selber musste der Kochkessel
geheizt werden - in unserer Gegend meist mit sog. „Rebenbirtln". Dann
wurden die Wäschestücke mit einer Wurzelbürste gebürstet und
anschließend, wenn vorhanden, beim Mühlbach geschwemmt. Die schwere
nasse Wäsche transportierte man mit dem „Gig",der in jedem Hause war
und händisch meist von einem Mann gezogen wurde, zum nahen Bach, um das
Waschmittel aus dem Gewebe zu schwemmen. Anschließend wurden die
Wäschestücke im Hof oder Garten auf einer Wäscheleine zu Trocknen mit
sog. „Kluppen" befestigt. Die Waschlauge verwendete man oft ein
zweitesmal zum Reinigen von weniger wertvollen Stücken (Teppiche,
Tücher). So ein Waschtag endete meist erst Abends. Erst die Erfindung
der Waschmaschine erleichterte die Arbeit der Frauen im Haushalt und
sie jammerten seit dieser Zeit auch nicht mehr!

Vom Schneider
Das Handwerk des Schneiders hat sich im Laufe der Jahre stark
verändert. Diese Veränderungen reichen von der Arbeitszeit über den
Verdienst bis hin zu den zur Verfügung stehenden Arbeitsbehelfen.
ARBEITSZEIT: In den 40er Jahren arbeitete der Schneider etwa 5 Tage bei
einer Arbeitszeit von mindestens 8 Stunden pro Tag - an einem Kleid, 7
Tage an einem Sakko, 3 Tage an einer Bluse und 2 Tage an einem Rock
oder an einer Herrenhose. Zu dieser Arbeitszeit kam noch die Zeit für
Änderungen, denn man muss bedenken, dass so ein Kleidungsstück nicht
immer sofort wie angegossen passte.
VERDIENST: Im Jahre 1960 bekam ein Schneider 250 Schilling für ein
Kleid. Durchschnittlicher Arbeiterlohn war damals etwa 1.800 Schilling.
Das war für damalige Verhältnisse eine Menge Geld. Heutzutage bekommt
man für das Geld wahrscheinlich nicht einmal mehr die Knöpfe für ein
Kleid. 1980 erhielt ein Schneider für ein Kleid immerhin schon etwa 400
Schilling - durchschnittlicher Arbeitermonatslohn war etwa 12.640
Schilling.
Trotz dieser für heutige Verhältnisse recht billig erscheinenden Preise
konnten es sich damals nur reiche Leute leisten, ihre Kleidung von
einem Schneider nähen zu lassen. Die ärmeren Leute fertigten ihre
Kleidung zum größten Teil selbst an. Im Vergleich zu früher musste man
etwa im Jahre 2000 etwa 1600 Schilling (etwa 116 Euro) bezahlen, wenn
man sich ein Kleid von einem Schneider nähen lassen wollte.

SCHNEIDERWERKSTATT
Die meisten Schneidereien befanden sich im Keller, weil diese
Werkstätten für Handwerker billiger zu erhalten waren. Sie verfügten
daher nur über ein einziges Fenster. Unter diesem Fenster befand sich
der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsfläche, da der Schneider für seine
Arbeit möglichst viel helles Licht benötigte. In der Schneiderkoje sind
fast alle Materialien und Arbeitsbehelfe ausgestellt, die der Schneider
im Laufe der Zeit zur Verfügung hatte: Zentimetermaß, Lineale,
Schneiderkreide, Kleiderpuppen, Kleiderbürsten, Modejournale mit
Schnittbögen und Heften (in denen der Schneider die Maße seiner Kunden
notierte); Nähzubehör wie Heftwolle, Zwirn, Nähseide, Einziehbänder,
Knöpfe, Druckknöpfe, Stecknadeln, Nähnadeln, Fingerhut; Schere,
Stempelkissen und Stempel für Muster und Monogramme (zur Verschönerung
von Tisch- und Bettwäsche) und die wichtige Erfindung Joseph
Maderspergers aus dem Jahre 1814, nämlich die Nähmaschine. Auch
verschiedene Bügeleisen sind in bzw. vor der Koje zu sehen, denn es war
natürlich notwendig, dass der Schneider das Stück, an dem er gerade
arbeitete, immer wieder glatt bügeln musste.

Das Herzstück bildet die „Ladenstraße“ im 1. Stock. Hier reihen sich
viele verschiedene Geschäftslokale (Apotheke, Milchgeschäft, Greißler,
Trafik, Uhrengeschäft, Eisenwarenhandlung, Hutgeschäft, Fleischerei)
und Handwerksbetriebe (Schneiderei, Tischler, Bäckerei, Schuster) in
alten Original Ausstattungen dicht aneinander. In den Kojen spüren und
riechen sie noch die Atmosphäre der alten Zeit – wie wenn der
Handwerker gerade mal die Werkstatt verlassen hätte …


Das Milchgeschäft
Dieser Nachbau eines Milchgeschäftes soll den Museumsbesuchern einen
Rückblick in die Jahre um 1900-1970 ermöglichen. Damals wurden die
ersten Hygienevorschriften für Lebensmittel erlassen. Bis ca. 1900
konnten die Städter ihre Frischmilch nur von den Bauern kaufen, die
täglich mit Pferd und Wagen ihre Produkte in die Stadt brachten. Zum
Teil konnte man die Milch auch beim fahrenden Bauern kaufen, der von
Haus zu Haus fuhr - ohne Kühlung, versteht sich. Um diesen Missstand
abzuhelfen wurden die ersten Molkereien gegründet.
Den Verkauf übernahmen öffentliche aber auch private Milchgeschäfte,
liebevoll „Mülipritschler" genannt. Nicht sehr beliebt waren die
Milchkutscher, die durch ihr grobes Benehmen oft gefürchtet waren.
Diese Kutscher fuhren bereits um 1 Uhr nachts zu den Geschäften und
weckten oft die ganze Nachbarschaft unsanft aus dem Schlaf. Das
„Scheppern" der schweren Milchkannen war weit zu hören. Zwei solche
Kannen sehen Sie links und rechts vor dem Geschäftseingang.

Im Milchgeschäft wurde bis ca. 1960 direkt aus der 25l Milchkanne oder
aus einem großen „Milchhäfn" herausgeschöpft. Später wurde eine Pumpe
als Verbesserung verwendet. Es gab bis 1950 keine leistungsfähigen
Kühlanlagen für Milchgeschäfte. Man hatte Eiskästen mit Blockeis,
dadurch war es auch in den Geschäften immer sehr kalt und ungemütlich.
In Traiskirchen gab es bis 1960 mehrere Milchgeschäfte, die für die
Nahversorgung mit Milch, Käse, Eiern, Butter und Gebäck sorgten. In
Möllersdorf gab es drei Milchläden.

Bürstenbinder - Korbflechter - Strohsimperlerzeugung
Der Bürstenbinder übt seine Tätigkeit in der heutigen Zeit meist in
klein strukturierter Heimarbeit aus. Als Hersteller und Hausierer
seiner Ware, war er bei den Wochenmärkten ein gern gesehener
Aussteller, der auch als Siebmacher einiges verkaufen konnte. Unsere
kleine Ausstellung stammt aus Niederösterreich von einem aufgelassenen
kleinen Gewerbebetrieb in der Buckligen Welt.

In der heutigen Zeit hat man natürlich eine Marktnische gefunden. An
Stelle der Kunststoffborsten sind die Naturborsten getreten, die nicht
immer leicht zu bekommen sind. Die Rohmaterialien zu diesen kleinen
Kunstwerken haben wir hier ausgestellt. Das Gewerbe der Korbflechter-
und Strohsimperlerzeuger war früher immer in burgenländischer Hand.
Durch zahlreiche Kriege in den letzten Jahrhunderten und auf eine
Anweisung von Kaiserin Maria Theresia sollten Blinde und Sehschwache
dieses Gewerbe ausüben. Es gibt übrigens in Wien bis heute noch eine
Schule, in der Blinde diesen Beruf lernen können.

Uhren im Wandel der Zeit
Die älteste Vorrichtung zur Messung der Zeit war der Gnomon, ein
senkrecht stehender Stab, der seinen Schatten auf eine waagrecht
stehende Fläche wirft. Diese Einrichtung wurde bereits 3500 v. Chr. in
Ägypten verwendet. Aus dem Gnomon entwickelte sich später die
Sonnenuhr, bei der ein parallel zur Erdachse aufgestellter Stab seinen
Schatten hinterlässt. Da die Sonnenuhr die Zeit nur bei Tag anzeigte,
wurde die restliche Zeit mit so genannten Wasser- oder Sanduhren
gemessen. Der Zeitablauf wurde bei diesen Uhren über den Auslauf von
Wasser bzw. Sand bestimmt. Das Gefäß, aus dem das Wasser oder der Sand
auslief, trug Markierungen, anhand derer die Zeit abgelesen werden
konnte.

Im Mittelalter tauchten die Öl- und Kerzenuhren auf. Nach der Menge des
verbrannten Öls oder Wachses wurde die Zeit an einer Skala abgelesen.
Die ersten mechanischen Uhren, also Uhren mit Maschinenelementen, die
Achsen oder Zahnräder aufwiesen, waren die Räderuhren. Sie kamen um
1300 auf und wurden aufgrund ihrer großen Ausmaße in Türmen von Kirchen
oder Schlössern untergebracht. Zu dieser Zeit waren die Uhren mit nur
einem Zeiger ausgestattet, der die Viertelstunden anzeigte. Später
versuchte man, die unförmigen Uhren kleiner zu bauen. Um 1510
entwickelte Brunelleschi in Florenz die ersten tragbaren Uhren und
Wecker. Der Nürnberger Feinmechaniker Peter Henlein stellte hierauf
eine dosenförmige Taschenuhr her, das so genannte „Nürnberger
Eierlein". Schon Galilei wollte die Pendelbewegung zur Steuerung einer
Uhr
verwenden. Als im Jahr 1656 Christian Huygens zum ersten Mal das Pendel
als Gangregler der Uhr benutzte, war die Pendeluhr geboren. Minuten-
und Sekundenzeiger sowie Uhrgläser zum Schutz der Zeiger und des
Ziffernblattes kamen ebenso in diesem Jahrhundert auf.

Die ersten elektrischen Zeigerwerke tauchten 1840 auf. Alexander Bain
entwickelte nämlich eine Pendeluhr, die durch elektromagnetische Kräfte
und nicht mehr durch ein herabsinkendes Gewicht angetrieben wurde. 1934
wurde die erste Quarzuhr von A. Scheibe und V. Adelsberger
konstruiert, die wegen ihrer Präzisionszeitmessung die feinsten
mechanischen Uhren überflügelte. Der Gang dieser Uhr wird durch die
elektrisch angeregten, elastischen Eigenschwingungen einer Quarzplatte
gesteuert. Die genaueste Uhr ist aber die Atomuhr, die es seit 1948
gibt. Der Gang
dieser Uhr wird von den Eigenschwingungen eines Atoms im
Mikrowellenbereich gesteuert. Die Zeitmessung ist somit von äußeren
Einflüssen unabhängig. Die Abweichung in 5 Millionen Jahren beträgt
lediglich eine Sekunde.

k. k. Lustlager
Vor ca. 200 Jahren, als Traiskirchen noch Kreishauptstadt war, gab es
in unserer Gegend ein Großereignis. Die ebene Landschaft rund um
Traiskirchen schien dem damaligen Hofkriegsrat geeignet für ein
Großmanöver mit mindestens 30.000 Mann. Kaiser Franz I. wollte eine
Machtdemonstration seines Heeres nach den Niederlagen gegen Napoleon
vorführen. Bei dieser Gelegenheit wollte man auch die
Leistungsfähigkeit des Heeres dem Bündnispartner Russland zeigen. Die
beteiligten Truppen aus Österreich, Böhmen, Mähren, Steiermark, Ungarn
und einige Batterien aus Wien wurden in Traiskirchen zusammengezogen.
Traiskirchen wurde in diesen Tagen zum Mittelpunkt der Monarchie. Da
Kaiser Franz I. jeden Sommer in Baden im Kaiserhaus verbrachte, kamen
mit ihm jede Menge gekrönte Herrschaften zum Übungslager. In erster
Linie Erzherzog Karl und Erzherzog Johann, die Brüder des Kaisers, dann
der Prinz und spätere Deutsche Kaiser Wilhelm. Da bei solchen
Massenansammlungen die Essensversorgung eine wichtige Rolle spielte,
hatten fliegende Händler und Dienstleister eine Menge zu tun. Drei
Kaffeehäuser sowie etliche Gaststätten und Buschenschenken eröffneten
in kürzester Zeit ihren Betrieb. Eine Schießbude und ein Friseur waren
auch dabei.

Österreichische Schilling - Banknoten
erste Serie nach 1945 und letzte Serie vor der Euroumstellung


Ein k.k. Lustlager bei Traiskirchen 9. September 1828
Die Ebene von Traiskirchen war öfter der Schauplatz großer
militärischer Übungen, 1814/1815 und auch 14 Tage lang ab 9. September
1828. Kaiser Franz I., der wie jedes Jahr auch damals in Baden weilte,
wohnte mit einem gänzenden Gefolge dem großartigen Kriegsschaupiele
bei. Des Kaisers Bruder Erzherzog Carl, dessen Gemahlin Henriette, ein
Prinz von Nassau und der preußische Prinz Friedrich Wilhelm, der
spätere Kaiser Wilhelm I. zählten zu diesem Gefolge. 30.000 Mann aller
Waffengattungen waren zusammen gekommen und das Übungsfeld erstreckte
sich von Wr. Neudorf bis gegen Schönau. Das Zentrum lag bei
Traiskirchen. Dort führten unternehmungslustige Kaufleute von Wien zur
Befriedigung der Schaulustigen eigene Bauten auf. Da gab es Wein- und
Kaffeehäuser vornehmsten Stiles mit stockhohen Terrassen,
Speisezimmern, Billardzimmer usw. Am prächtigsten war wohl das
Kaffeehaus Tschermak ausgestattet, dass sich im Mittelpunkt des Lagers
erhob und von dessen Terrasse man einen herrlichen Ausblick genoss, der
freilich einen Gulden kostete. Außer diesem Bau sah man noch 3 große
und viele kleine Gast- und Kaffeehäuser, ja sogar eine Tierbude aus
Wien fand sich ein.
Die ganze Truppenmacht bestand aus 3 Treffen und jedes war von einem
Feldmarschall-Leutnant befehligt. Große Truppenbesichtigungen, zu denen
der Kaiser stets mit seinen Gästen aus Baden erschien, wechselten mit
Rasttagen und kirchlichem Gepränge ab. Einmal störte ein nächtlicher
Dauerregen das Lagerleben und setzte die tiefer gelegenen Stellen des
Zeltlagers unter Wasser. Die Truppen mussten zurückgezogen werden und
konnten erst nach einigen Tagen wieder einrücken. Am 20. September zog
der Feind, bestehend aus den Wiener Truppenkörpern, unter dem Befehl
des Prinzen von Coburg, gegen das Lager. Für den kaiserlichen Hof und
seine Gäste waren auf dem Eichkogel bei Guntramsdorf 2 große Zelte
errichtet worden. Am 21. September um 7.00 Uhr früh hatte sich dort
schon das Bild einer großen Schlacht entwickelt. Das glänzende
Schauspiel dauerte bis Mittag, worauf die hohen Herrschaften wieder
nach Baden zurückkehrten.
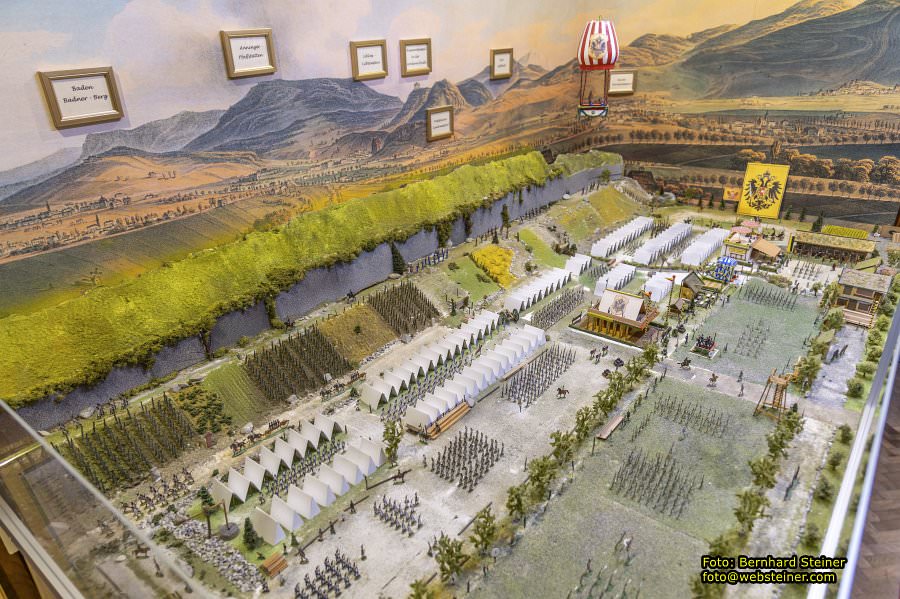
Eisen und Feuer - Geschichte des Schmiedehandwerks
Das Schmiedehandwerk ist eines der ältesten nachgewiesenen Handwerke.
Funde aus der späteren Jungsteinzeit (ab 5000 v. Chr.) sowie aus der
Kupferzeit (ab 3000 v. Chr.) und der Bronzezeit (ab 2000 v. Chr.)
belegen bereits die Fähigkeit des Schmiedens. In der Antike wurden
hauptsächlich Werkzeuge und Waffen hergestellt, aber auch Gebrauchs-
und Ziergegenstände und Schmuck. In der Eisenzeit (ab 800 v. Chr.)
begannen die Kelten aus erzhaltigem Gestein in Hochöfen Eisen heraus zu
schmelzen und in Form von Roheisen zu bearbeiten, zu schmieden. Damit
erreichte das Schmiedehandwerk seinen ersten Höhepunkt. Schmieden
heißt, das Eisen bei hohen. Temperaturen, mit Werkzeugen manuell zu
formen. Der erfahrene Schmied erkennt anhand der Glühfarbe des Eisens
die Temperatur, bei ca. 800 °C ist das Eisen dunkelrot, bei ca. 1200 °C
ist es weißgelb.
Um diese hohe Temperatur zu erreichen ist der Blasbalg ein
unentbehrliches Hilfsmittel. Zum Bearbeiten braucht der Schmied ein
Feuer (die Esse) zum Erhitzen des Eisens, einen Amboss, Hämmer und
verschiedene Zangen, sowie Wasser zum Abkühlen. Das ursprüngliche Bild
des Schmieds hat sich seit dem Mittelalter nicht wesentlich verändert.
Das metallische Klingen, wenn der Hammer auf das glühende Eisen
schlägt, zieht heute noch die Menschen magisch an. Das Feuer, der Ruß
und die Kraft, die für diese Tätigkeit notwendig ist, weckt das
Interesse. Im Lauf der Zeit begann sich auch der Schmied zu
spezialisieren. Ab dem 9. Jahrhundert sind geschmiedete Hufeisen
nachweisbar und damit wurde der Hufschmied ein ganz wesentlicher Zweig
des Schmiedehandwerks. Eine weitere Spezialisierung ist für den Wagner
erforderlich, der geschmiedete Teile für die Anfertigung von Rädern und
Wagen benötigt.

Huf- und Wagenschmiede
Ein Schmied war früher im ländlichen Raum ein Universalhandwerker. Erst
mit der Bildung größerer Siedlungen und dem steigenden Bedarf einzelner
Produkte entstanden verschiedene Berufssparten, wie Werkzeugschmied,
Waffenschmied, Goldschmied, Wagenschmied oder Hufschmied. Das Gewerbe
der Huf- und Wagenschmiede war in Traiskirchen von großer Bedeutung.
Die Stadt lag für Pferdefuhrwerke eine Halbtagesreise von Wien bzw. Wr.
Neustadt entfernt. Viele Fuhrwerke machten daher in Traiskirchen Pause
und/oder nützten die Ruhezeit für Reparaturarbeiten.
Ein Hufschmied ist ein
Spezialist für die Pflege, das Ausschneiden und das Beschlagen von
Tierhufen mit Hufeisen oder anderen Materialien. Die Hufeisen und
Hufnägel stellt er traditionell auch selbst in seiner Schmiede her bzw.
passt die Hufeisen der Form des Hufes an.
Ein Wagenschmied baut und
repariert die Metallbeschläge an Kutschen und Fuhrwerken. Die
wichtigsten Werkzeuge eines Schmiedes sind Hammer und Amboss. Der
Hammer zählt zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit. Ein Amboss
(althochdeutsch anaboz: „Woran man schlägt") ist eine Unterlage aus
gehärtetem Stahl zum Umformen und Bearbeiten von Eisenmetallen. Die
Werkzeuge der Schmiede hier im Museum wurden aus verschiedenen
Betrieben zusammen getragen. Das meiste stammt vom Schmiedemeister Emil
Kögler (geb. 1886) aus Pfaffstätten.

Schulordnung
1.) Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Voraussetzungen für einen ordentlichen Unterricht.
2.) Das Lehrpersonal braucht jetzt nur noch an Wochentagen zwischen 6
Uhr vormittags und 6 Uhr nachmittags anwesend zu sein. Der Sonntag
dient dem Kirchgang und der Sonntagsschule. Jeden Morgen wird im Bureau
des Direktors das Gebet gesprochen.
3.) Einfache Kleidung ist Vorschrift. Die Lehrpersonen dürfen sich
nicht in hellschimmernden Farben bewegen und nur ordentliche Strümpfe
tragen. Ueberschuhe und Mäntel dürfen in der Klasse nicht getragen
werden, da in allen Räumen ein Ofen zur Verfügung steht. Ausserdem wird
empfohlen, in Winterszeiten täglich 4 Pfund Kohle pro Lehrperson
mitzubringen.
4.) Während der Pausen darf nicht gesprochen werden. Eine Lehrperson,
die Tabak raucht, Alkohol in irgendwelcher Form zu sich nimmt,
Billardsäle oder politische Lokale aufsucht, gibt Anlass, seine Ehre,
Gesinnung, Rechtschaffenbeit und Redlichkeit anzuzweifeln.
5.) Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 13,30 Uhr und 14 Uhr erlaubt. Jedoch darf die Arbeit dabei nicht eingestellt werden.
6.) Es wird von jedermann die Ableistung von unbezahlten Ueberstunden
erwartet, wenn der Unterrichtsbetrieb es begründet erscheinen lässt.
7.) Der Klassenvorstand hat die Klassenräume sauber zu halten.
Junglehrer melden sich bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und bleiben
nach Dienstschluss zum Reinigen des Schulhauses zur Verfügung.
8.) Jede Lehrperson hat die Pflicht, für die Erhaltung seiner
Gesundheit Sorge zu tragen, im Krankheitsfalle wird die Lohnzahlung
eingestellt.
9.) Beamten des Bezirksschulrates und des Landesschulrates ist mit Ehrerbietung und Bescheidenbeit zu begegnen.
10.) Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit dieser neuen Schulordnung
betont. Zum Ausgleich wird eine wesentliche Steigerung der persönlichen
Leistung erwartet.
JOKO Lehrmittelanstalt 2630 Ternitz, gegründet anno 1898.
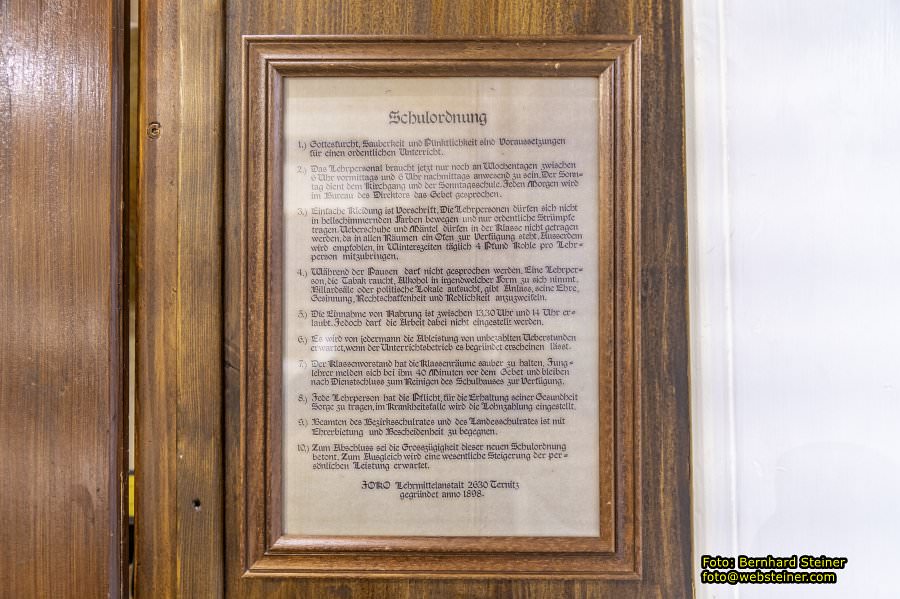
Die Schule
Das Wort „Schule" stammt vom griechischen Wort „scholé", und bedeutet
eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie heute für Schüler ist,
nämlich Freizeit und Muße. Bei den Römern bezeichnete das Wort bereits
schon Unterricht. Schulen im heutigen Sinn gab es früher noch nicht.
Kinder von vornehmen Leuten wurden von Privatlehrern unterrichtet. Im
Mittelalter erteilten Mönche den Unterricht in Klöstern. Aus diesen
Klosterschulen entstanden dann die Gymnasien. In Österreich führte
Maria Theresia 1774 die allgemeine Schulpflicht ein. Die Schule soll
grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die für ein
selbstständiges Leben in der Gesellschaft erforderlich sind. Dazu
gehört überall auf der Welt das Lesen, Schreiben und Rechnen.

Die Gegenstände, die sich in dieser Klasse befinden, sind meistens aus
der Zwischenkriegszeit und der Nachkriegszeit. Die Schüler verwendeten
um 1900 Schiefertafeln, auf denen sie mitschrieben, erst später kamen
die Hefte (um 1940). Die Schulbücher mussten die Kinder selbst kaufen.
Aber sie hatten meist nur zwei Bücher, ein Rechenbuch und ein Lesebuch.
Die Klassen waren sehr groß und deshalb stand der Lehrer auf einem
Podest, so dass er alle Schüler gut sehen konnte und sie ihn gut hören
konnten.

Technik im Wandel - Zu diesem Ausstellungsschwerpunkt zählen eine
Dampfmaschine aus dem Jahr 1911 sowie eine umfangreiche
Fahrzeugsammlung (Motorräder, Fahrräder, Traktor, Auto). Historische
Telefone zeigen die Entwicklungen auf dem Gebiet der Kommunikation. Ein
Ausstellungsraum zeigt alte Werkzeuge des Zeitungs- und Buchdrucks.

DAMPFMASCHINE Baujahr 1911, Pilsen
Diese Dampfmaschine war in der Fabrik der Fa. Julius Meinl in
Münchendorf für die Sektabfüllung im Einsatz und wiegt 7.000kg. Genau
an dieser Stelle befand sich zu Zeiten der Gründung der Kammgarnfabrik
1824 das durch Wasser betriebene Antriebsrad einer Mühle. Unsere
Maschine hat einen doppelt wirkenden Zylinder, wobei der Dampf
abwechselnd auf beiden Seiten des Kolbens einwirkt. Die Leistung wurde
dadurch verdoppelt. Dampfmaschinen lösten in der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts ein neues Zeitalter aus, den Beginn der
Industrialisierung. Dem Engländer James Watt wird die Erfindung der
Dampfmaschine in den Jahren 1768-1782 zugeschrieben. Fortschritte in
der Landwirtschaft und Industrie waren die Folge. Dampfschiffe und
Dampfeisenbahnen traten ihren Siegeszug um die Welt an.
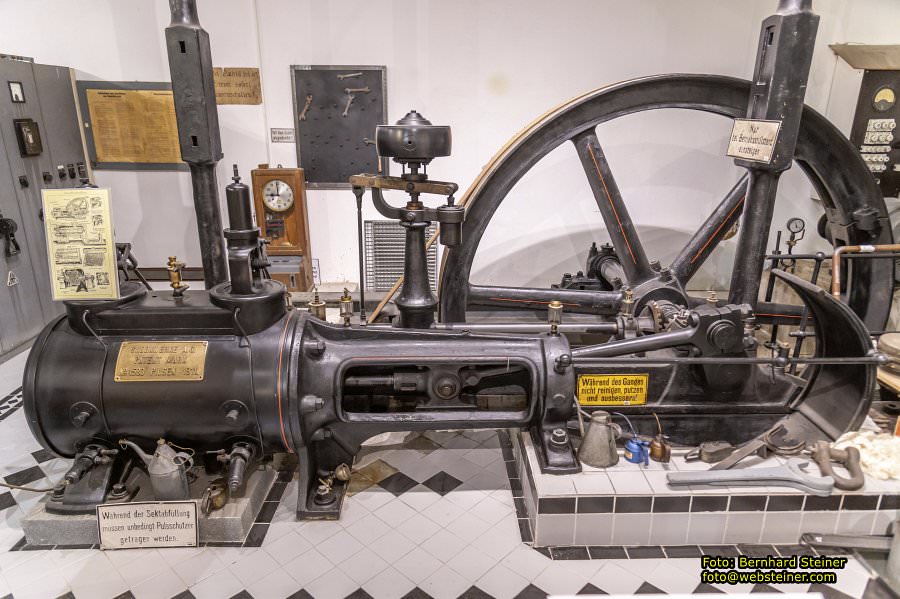
Geschichte des Fahrrads
Die Draisine oder Laufmaschine ist ein einspuriges, von Menschenkraft
betriebenes Fahrzeug ohne Pedale, das als Urform des heutigen Fahrrads
gesehen werden kann. Der deutsche Forstbeamte Karl von Drais stelle
1817 seine Erfindung vor. Er fügte den bereits im 18. Jahrhundert
bekannten nichtlenkbaren Laufrädern eine Lenkvorrichtung hinzu.
Einige Weiterentwicklungen folgten: Die Michauline (benannt nach
Franzosen Pierre Michaux) ist ein Tretkurbe-fahrrad und direkter
Vorläufer des Hochrads. Die Michaulinen sind die ersten Fahrräder, die
in größeren Stückzahlen hergestellt wurden. Sie waren überwiegend
Freizeitobjekte für wohlhabende Männer der gehobenen Bürgerschicht und
Aristokratie. Die Weltausstellung 1867 in Paris machte diese Produkte
auch in England und den deutschen Staaten populär. Der
Deutsch-Französische Krieg (1870-71) beendete die Produktion und die
weitere Entwicklung in Kontinentaleuropa. In den USA und England
erlangten die „French bicycles" oder „Boneshakers" jedoch einen
gesellschaftlichen Durchbruch. Nachdem das erste Hochrad auf den Markt
gebracht wurde, hatten die Michaulinen nur noch die Funktion eines
Lerngeräts und verschwanden alsbald vom Markt.
* * *
ENGLISCHES HOCHRAD - Baujahr 1885, Blattfederung, Löffelbremse, Original Ständer

Hochräder wurden ab 1861 gebaut und sind typischerweise aus einem
großen Vorderrad von 40 bis 60 Zoll (101,6 bis 152,4 cm) Durchmesser
und einer mit einem Lenker versehenen Radgabel aufgebaut. Als Nachteile
des Hochrads wurden und werden das schwierigere Auf-und Absteigen, die
größere Unfallgefahr und die schlimmeren Unfallfolgen angesehen. Die
Pedale sind direkt auf der Radachse montiert. Durch den größeren
Abrollumfang bei gleicher Pedalkurbeldrehzahl und besserem Fahrkomfort
konnte sich das Hochrad rasch gegenüber seinem Vorläufer durchsetzen.
Der Fahrer rückte durch die Rad-Größe nach vorne und damit nach oben.
In Großbritannien wurde es ein beliebtes Sportgerät und Statussymbol
junger, wohlhabender Männer, die auf dem Hochrad auf Augenhöhe mit
aristokratischen Reitern waren. Zwischen 1870 und 1892 wurden etwa
200.000 Hochräder hergestellt.
Um 1885 wurde es vom vielseitig verwendbaren Sicherheitsniederrad (vom
Engländer John Kemp Starley) abgelöst. Dieses entwickelte sich zum
heute gebräuchlichen Standard-Fahrrad. Es besitzt einen rautenförmigen
Rahmen und zwei gleich große Räder und wird von zwischen den Rädern
angeordneten Pedalen aus über eine Kette am Hinterrad angetrieben. 1885
setzte sich die Bezeichnung „Fahrrad" durch. Eine Verbesserung des
Fahrkomforts brachte die Erfindung des Luftreifens (John Boyd Dunlop
1888) sowie der Freilauf (1889 von A.P. Morrow). Die erste
Gangschaltung wurde 1907 entwickelt. Hochrad-Fahren blieb noch lange
Zeit Kunstradsport, während das Niederrad bzw. das Fahrrad zu einem
Massenverkehrsmittel wurde.

Wichtige Verkehrsachsen ziehen sich seit jeher durch die Stadt: Erst in
Form eines römischen Handelswegs, dann als Hauptroute für
Pferdefuhrwerke von Wien Richtung Süden. Hinzu kam der Wiener
Neustädter Kanal als wichtiger Transportweg für Brennholz, die Badner
Bahn für den Ziegeltransport zur Wiener Ringstraße, seit 1881 die
Aspangbahn und seit 1962 die A2 Südautobahn.

Die Aspangbahn WIEN-SALONIKI-BAHN
Die Geschichte der Aspangbahn ist eng mit jener des Wiener Neustädter
Kanals verknüpft und wurde anfangs von der Politik Österreich-Ungarns
mitbestimmt. Eine Finanzkrise der Donaumonarchie führte Ende der 1860er
Jahre zum Verkauf staatlichen Vermögens, unter anderem des Wiener
Neustädter Schifffahrtskanals. Der Käufer, eine private
Aktiengesellschaft mit später mehrheitlich belgischen Eigentümern,
verdiente zwar anfangs an der Schifffahrt noch sehr gut, musste jedoch
bald auch an den Bau von Eisenbahnen denken. Die außenpolitische
Neuorientierung des Habsburgerreichs in Richtung Balkan führte zur
Planung einer Bahn von Wien über den Wechsel nach Radkersburg und
weiter zur bosnischen Grenze bei Doberlin/Novi. Von hier sollte eine im
Osmanischen Reich gebaute Bahn eine direkte Verbindung zur Ägäis
herstellen. Vom nie realisierten Projekt einer „Wien-Saloniki-Bahn"
blieb die „Eisenbahn Wien-Aspang" (EWA), eine am 7.8.1881 eröffnete
Lokalbahn von Wien in die Bucklige Welt. Die anschließende Strecke über
den Wechsel wurde erst 1910 - allerdings nicht von der EWA - gebaut und
von den k.k. Staatsbahnen betrieben.
Um innerhalb Wiens teure Grundstückskäufe zu vermeiden, wurde die
Schifffahrt auf dem Wiener Neustädter Kanal im Raum Wien 1879
eingestellt, sodass die Bahn parallel zum verbliebenen Werkskanal
geführt werden konnte. Auf dem Gelände des Kanalhafens im Bezirk
Landstraße errichtet man einen für die ursprünglich geplante Fernbahn
würdigen Bahnhof. Dank zahlreicher Zweigstrecken und
Werks-Anschlussbahnen, sowie der Übernahme der Schneebergbahn 1899
entwickelten sich sowohl der Personen-, wie auch der Güterverkehr
dieser Privatbahn lange Zeit überaus positiv. Erst die Wirtschaftskrise
der 1930er-Jahre mit Fabrikschließungen und einem rückläufigen
Frachtaufkommen, sowie die beginnende Kraftfahrzeugkonkurrenz zwangen
schließlich die EWA-Eigentümer 1937 den Betrieb den Österreichischen
Bundesbahnen (BBÖ) zu überlassen. Die eigentliche Verstaatlichung
erfolgte dann Anfang 1942. Die BBÖ verlagerte den über Wiener Neustadt
hinausgehenden Verkehr fast zur Gänze auf die Südbahn, sodass die
Aspangbahn seither aus den beiden Abschnitten Wien-Felixdorf (innere
Aspangbahn) und Wiener Neustadt-Aspang-Fehring (äußere Aspangbahn)
besteht.
Dem Ausbau der Industrie im südlichen Wiener Becken seit dem Zweiten
Weltkrieg ist es zu verdanken, dass die innere Aspangbahn heute noch
existiert und ihr Bestand auch nicht zur Diskussion gestellt wird. Auf
eine pendlergerechte Einbindung der Aspangbahn in das S-Bahnnetz der
Ostregion, sowie eine zeitgemäße Ausstattung der Bahnhöfe und
Haltestellen warten die Bewohnerinnen und Bewohner der
Anrainergemeinden bisher allerdings vergeblich. Der Bahnhof
Traiskirchen liegt an der Walter von der Vogelweide-Straße im östlichen
Stadtgebiet. Heute ist die Bahnlinie vor allem für Pendler von
Bedeutung.

Pferdetramway in Baden
Die „Badner Bahn" in ihrer heutigen Form entstand aus zwei Teilen. Zum
einen eine Pferdetramway, die ab 1873 Baden Leesdorf mit Rauhenstein
verband. Zum anderen wurde 1886 von der neuen Wiener
Tramway-Gesellschaft eine Dampfstraßenbahnstrecke von Wien nach Wr.
Neudorf eröffnet. Die „Rauhenstein"-Linie führte vom Badener Bahnhof
bis unter die Ruine Rauhenstein. Eine Fahrt dauerte 24 Minuten und
kostete 20 Kreuzer. Betrieb war zwischen 1. Mai und 30. September. Am
22. Mai 1895 wurde schließlich die Straßenbahn Baden - Sooß - Bad
Vöslau eröffnet, die von Beginn an elektrisch betrieben wurde - die
Straßenbahn in Baden ist damit die älteste elektrisch betriebene
Normalspurstraßenbahn in Österreich.
„Neue Wiener Tramwaygesellschaft“
Die ersten Pläne für eine schienengebundene Verbindung der Ziegelöfen
im Süden Wiens mit dem Stadtzentrum gab es bereits um 1860. Die
Konzession für Bau und Betrieb wurde schließlich 1885 an die „Neue
Wiener Tramswaygesellschaft" vergeben. Die Strecke verlief ab 1886
zwischen Wien-Gaudenzdorf (nahe dem Margaretengürtel) und Wiener
Neudorf. In den ersten beiden Betriebsjahren wurden ca. 280.000
Fahrgäste mit Dampfstraßenbahnen befördert. Nach Gründung der
„Actiengesellschaft der Wiener Localbahnen" (WLB) 1893 wurde die
Strecke über die Eichenstraße bis zum Matzleinsdorfer Platz verlängert.
1895 fuhr die Bahn dann bis Guntramsdorf, 1899 kam es zum Lückenschluss
nach Baden.
Ziegeltransport mit der Badner Bahn: In der Gründerzeit (1860-1910) war
der Bedarf an Baumaterial sehr groß. Pro Jahr wurden um die 10
Millionen Ziegel nach Wien transportiert.

Die elektrische Bahn
Seit 30. April 1907 wird die gesamte Strecke von Wien-Oper bis
Baden-Josefsplatz durchgehend elektrisch betrieben. 1910 wurden vier
Millionen Fahrgäste gezählt. Während des 1. Weltkriegs musste der
Betrieb aufgrund von Personalmangel und fehlendem Materialien erheblich
reduziert werden. Die Ziegeleien an der Strecke wurden nach dem Krieg
geschlossen, der Güterverkehr war an seinem Tiefpunkt. Dafür nahm der
Personenverkehr zu. Die zunehmende Konkurrenz durch den
Individualverkehr führte bei der WLB schon früh zu Konsequenzen: 1931
wurde die Straßenbahn nach Rauhenstein wochentags und die Badner Bahn
zwischen Traiskirchen Lokalbahn und dem Aspang-Bahnhof eingestellt.
1951 wurde die Linie Vöslau-Baden der Badner Bahn eingestellt.
Die Renaissance der Lokalbahn
Nach den Kriegsschäden dauerte es über zwei Jahre, bis die komplette
Strecke zwischen Wien-Oper und Baden wieder befahrbar war. In den
1950er Jahren setzte die Bevölkerung vermehrt auf Individualverkehr -
so war die Badner Bahn zu dieser Zeit akut von der Einstellung bedroht.
1954 zählte die WLB etwa nur noch 3,5 Millionen Fahrgäste. Die Bahn
investierte in Infrastruktur und in neue Triebwagen und Waggons. Die
Entstehung eines neuen Stadtteils in Maria Enzersdorf und die neuen
„Kölner" Triebwagen, die ab 1970 zum Einsatz kamen, sorgten für einen
Aufschwung bei den Fahrgastzahlen. Mit einer Erneuerung der
Gleisanlagen konnte die Streckengeschwindigkeit auf 80 km/h gesteigert
werden. Dem „Kölner" folgte die WLB-Reihe 100, die zwischen 1979 und
1993 gebaut wurde.
Die WLB heute
In den 1980er Jahren wurde der Halbstunden-Takt eingerichtet, später
der 15-Minuten-Takt, seit September 2000 verkehrt die Badner Bahn
zwischen Wien und Wr. Neudorf zu den Hauptverkehrszeiten sogar alle 7,5
Minuten. Dafür wurden sechs Niederflurtriebwagen der Reihe 400
angeschafft. Die Fahrgastzahlen stiegen während dieser Jahre
kontinuierlich auf rund 8,6 Millionen im Jahr 2004. Die Digitalisierung
hielt auch bei der Lokalbahn Einzug, die WLB investierte zudem in
Sicherheitstechnik und Gleisanlagen sowie ein neues Zentralstellwerk in
Wr. Neudorf 2007. Heute ist die Badner Bahn ein wichtiger Bestandteil
des Berufsverkehrs zwischen Baden und Wien. 2019 konnte die WLB mit
13,4 Millionen Fahrgästen einen neuen Rekord verzeichnen. Die Züge
legten in diesem Jahr insgesamt 80.000 Fahrten mit einer Länge von über
1,9 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht mehr als 47
Erdumrundungen.

DAS SEMPERITWERK TRAISKIRCHEN
1896 kaufte Gummiwarenfabrikant Josef Miskolczy, ein gebürtiger Ungar,
Teile einer aufgelassenen Mühle in Wienersdorf, heute Traiskirchen, um
hier Gummibänder und gummierte Stoffe, sowie Riemen und Strumpfbänder
zu erzeugen. 1900 beginnt in Wienersdorf die Autoreifenproduktion. 1905
bereits die Gründung der ersten Betriebsfeuerwehr. Miskolczy gab seinen
Pneumatiks den Namen „SEMPERIT" übersetzt: „Es geht immer". Ab 1907
hieß dieses Werk eigentlich „Österreichisch Amerikanische Gummifabrik".
Im Laufe der Jahrzehnte vergrößerte sich der Betrieb flächenmäßig
gewaltig. Die ehemalige Malzfabrik und die Luttermühle wurden erworben
und die Zahl der Arbeiter stieg um 1930 bereits auf 2000 Beschäftigte.
Die Produktion stieg 1936 auf 124.000 Autoreifen und einer Größe des
Firmenareals von 180.000 m². 1945 wurden leider große Teile des
Maschinenparks von der russischen Besatzungsmacht abmontiert und außer
Landes gebracht. Viele Arbeiter verhinderten unter Einsatz ihres Lebens
den totalen Abbau der Maschinen. Durch dieses mutige Auftreten konnten
die Herren Ganglberger u. Lengel, die sogar mit Haftstrafen in Sibirien
bedroht wurden, das Schlimmste verhindern. Bereits 1946 kam die
Produktion schleppend wieder in Schwung. Im Jahr 1952 gab es bereits
Top Qualität bei SEMPERIT. 1994 hatte das Werk Traiskirchen 2429
Beschäftigte. Dieser sehr soziale Betrieb wurde von der Continental AG
in Hannover zu Jahresende 1995 übernommen u. am 31.12.2009 endgültig
geschlossen.

Wichtige Verkehrsachsen ziehen sich seit jeher durch die Stadt: Erst in
Form eines römischen Handelswegs, dann als Hauptroute für
Pferdefuhrwerke von Wien Richtung Süden. Hinzu kam der Wiener
Neustädter Kanal als wichtiger Transportweg für Brennholz, die Badner
Bahn für den Ziegeltransport zur Wiener Ringstraße, seit 1881 die
Aspangbahn und seit 1962 die A2 Südautobahn. Ergänzt wird diese
Sammlung mit historischen Fahrzeugen.

Im Erdgeschoss präsentieren wir die Themenbereiche Verkehr, Mobilität
und Technik. Eine Dampfmaschine aus 1911, historische Motorräder und
Fahrräder und eine Schmiede zeigen so manche technische Entwicklung.
Ein Schauraum des Reifenproduzenten Semperit bildet den Übergang zum
Freigelände. Hier ist ein Wasserrad am Mühlbach, eine Haltestelle, ein
Wagon der Badner Bahn, Baujahr 1926 und ein Sägegatter aus 1920 zu
bestaunen.
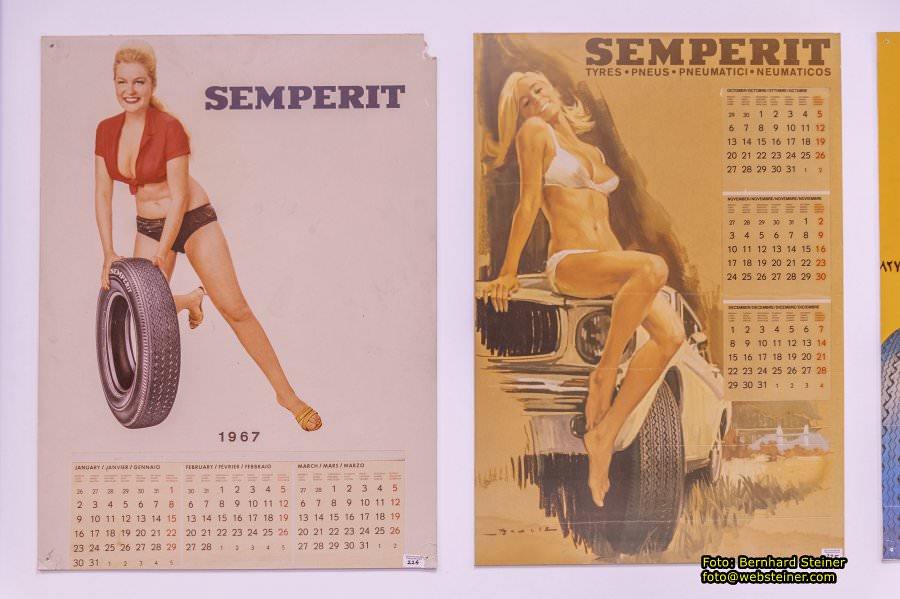
Die Badner Bahn
Am 20. Juli 1873 wurde die erste Teilstrecke der „Badener Tramway
Gesellschaft" später Wiener Lokalbahnen AG, auch Badner Bahn genannt,
dem Verkehr übergeben. Es war die Strecke von Leesdorf nach Rauhenstein
und es verkehrte eine Pferdestraßenbahn. Eine Fahrt vom Bahnhof bis
Rauhenstein kostete 20 Kreuzer und dauerte 24 Minuten. Am 16. Juli 1894
konnte diese Linie als erste normalspurige elektrische Straßenbahn
Österreichs eröffnet werden. Ein Jahr später wurde die Strecke nach Bad
Vöslau ausgebaut. Die von Wien wegführende Teilstrecke hatte eine
andere Geschichte: Es fehlte zwischen den zahlreichen Ziegelwerken im
Süden Wiens und den Großbaustellen der Gründerzeit in der Stadt eine
leistungsfähige Verkehrsverbindung. So wurde 1886 eine eingleisige
Strecke vom Linienwall in Wien, das ist der heutige Margaretengürtel
bis nach Wiener Neudorf gebaut. Von zahlreichen Gleisanschlüssen wurden
damals die Ziegel für die großen Ringstraßenbauten im Containersystem
damals Ziegeltruhen genannt nach Matzleinsdorf gebracht und von dort
mit Pferdefuhrwerken weitertransportiert. Täglich verkehrten so
zwischen 8 und 13 Züge in jeder Richtung. Der Personenverkehr war zu
dieser Zeit von geringerer Bedeutung. Im Jahre 1895 wurde die Strecke
nach Guntramsdorf verlängert und die Fahrzeit betrug etwas mehr als
eine Stunde.
Die Eröffnung des durchgehenden elektrischen Betriebs erfolgte 1907.
Die Züge fuhren somit ab Wien-Oper straßenbahnmäßig bis zur
Philadelphiabrücke, dann als Eisenbahn über die Überlandstrecke bis
Baden-Leesdorf und wiederum als Straßenbahn in den Ortskern von Baden.
Somit ist die WLB Wiener Lokalbahn bis heute ein Mittelding zwischen
Straßenbahn und Eisenbahn. Die aufkommende Autobuskonkurrenz in den
1920er Jahren veranlasste die Betreiber, die Ringlinie und die
Rauhensteiner Strecke in Baden einzustellen. Die stärkste Beanspruchung
hatte die Lokalbahn im Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen, als zahlreiche
neue Industriebetriebe entlang der Strecke die Beförderungszahlen
sprunghaft anstiegen ließen. Dem Aufschwung folgte ein jähes Ende, als
die Anlagen und Fahrbetriebsmittel durch Bombenangriffe und
Kampfhandlungen schwer beschädigt wurden. Es dauerte dann bis 1947 bis
alle Schäden wieder behoben wurden und der durchgehende Betrieb wieder
aufgenommen werden konnte. Am 14. Februar 1951 verkehrte der letzte Zug
nach Bad Vöslau.

Ziegeltransportwaggon der W.L.B.
Dieser extra für den Ziegeltransport gebaute Waggon (Lore) stammt aus
dem Jahr 1903. Der Corpus des Wagens wurde in Donawitz und die Bäder in
der Leobersdorfer Maschinenfabrik erzeugt. Um 1850 bis 1910 herrschte
in Wien, speziellander Ringstraße, eine rege Bautätigkeit. Zudiesem
Zweck wurden viele Millionen von Ziegel verbaut. Diesen biologisch
wertvollen Baustoff erzeugte man im südlichen Niederösterreich, wie
Vösendorf, Wr. Neudorf, Guntramsdorf, Traiskirchen (6 Werke), Vöslau
und Leobersdorf. Der W.L.B. Waggon mit der Nr. 860 hat 11,2 m² und
konnte mit 7,9 m² Ziegel beladen werden. Der Transportweg mit der
Badener-Bahn war sehr kostengünstig und sehr praktisch, da er für Wien
vor der „Haustür" lag und die beladenen Waggons auf den Geleisen der
Wiener Straßenbahn bis zur Baustelle gebracht werden konnten.
Kurioserweise schaffte man 1946 den Schutt der Bombenruinen des zweiten
Weltkrieges auf dem selben Weg, mit dem selben Wagen wieder zu den
selben Plätzen zurück, wo die Ziegel erzeugt wurden. Also zu den
Ziegelteichen in unserem Gebiet nach Niederösterreich. Die W.L.B.
schenkte dieses historische Stück dem Stadtmuseum. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Hauses restaurierten den Waggon in zweijähriger Arbeit,
um ihn hier den Museumsbesuchem zu zeigen.

Die Schwimmende Landstraße - Der Wiener Neustädter Kanal ein historischer Wasserweg
Der Wiener Neustädter Kanal wurde 1803 eröffnet. Der Wasserweg sorgte
für eine enorme Verbesserung der Transportbedingungen der damaligen
Zeit und war eine technische Pionierarbeit. Auf 65 km, zwischen Wien
und Wiener Neustadt, mit 50 Schleusen und rund 100m Höhenunterschied,
konnten Lastkähne mit einer Ladung von 30.000 kg verkehren. Damals
übliche Pferdefuhrwerke schafften 2.000 kg. Die Schiffe waren 2 m breit
und 23 m lang und transportierten vorwiegend Holz, Kohle und Ziegel,
auch Kalk, Roheisen, Harz, Tonwaren und auch Obst, Wein und Getreide.
Die industrielle Revolution „überholte" diesen technischen Durchbruch
jedoch schnell. Dampflokomotiven lösten die Kanalschiffe als
Transportmittel ab. 1879 wurde die Schifffahrt auf dem Kanal teilweise
eingestellt. Der Großteil des Kanals blieb bestehen, verfiel aber
zusehends. Einige Mühlen und Fabriken (Marmeladenfabrik, Elektron,
Matador, ÖLW/Ramminger u.a.) siedelten sich an seinem Streckenverlauf
an. Um eine komplette Trockenlegung zu verhindern, übernahm das Land NÖ
1956 den Kanal. Heute ist er ein beachtenswertes Denkmal für Industrie,
Technik und Verkehr vergangener Zeiten und ein Erholungsgebiet von
großer Bedeutung.
Der Wiener Neustädter Kanal in Zahlen
1797 Baubeginn in Guntramsdorf
Baukostenvoranschlag: 3,7 Millionen Gulden
Tatsächliche Baukosten: 11 Millionen Gulden
25. April 1803 Übergabe an die Schifffahrt
1. Juli 1879 Letzte Fahrt
Länge: 65 km
Gesamtgefälle: 100 Höhenmeter
Wassertiefe: 1,61,9 Meter
Schleusenkammern: 50
Spiegelbreite: 11 Meter
Sohlenbreite: 5,70 Meter
Schleusenbreite: 2 Meter (später 2,5 Meter)
Länge der Lastenkähne: 23 Meter
Höchstlast: 30.000 kg
Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h
Fahrtdauer Wien - Wr. Neustadt: 14 Stunden
* * *
Blick auf die Brettersäge (um 1930) im Freigelände mit einem großen Baumstamm

Elektrischer Triebwagen Nr. 227 der WLB.
Dieser Triebwagen hat die Nr. 226 und wurde Jahre 1927 von der Grazer
Waggonfabrik gebaut. Für die damalige Zeit waren die Wagen hochmodern.
Die Triebwagen verfügten sogar über ein kleines Buffett als Service für
den damals noch sehr geschätzten Gast. Das fahrende Kaffeehaus wurde in
Baden von der Konditorei Wiedhalm und in Wien vom ehemaligen bekannten
Gastronomen O.K. Otto Kaserer versorgt. Das WLB Personal freute sich
dann jedesmal über Kaffee und Schlagobersreste. Unser Triebwagen 226
wurde im 2. Weltkrieg leider zweimal sehr stark beschädigt, aber immer
wieder instandgesetzt. Ein Teil der Wagen wurde 1971 etwas
modernisiert, unter anderem erhielten die Wagen ein ungeteiltes
Stirnwandfenster. 1972 wurde eine andere Nummernbezeichnung eingeführt:
21-28 usw. Bis 1979 konnte man die alten Wagen noch immer gelegentlich
auf der Strecke sehen. In den 52 Jahren hat unser Waggon sicher an die
5 Millionen km zurückgelegt. Am 24.5.1994 wurde der Triebwagen vom
Bahnhof Guntramsdorf mit einem Straßenroller ins Stadtmuseum gebracht
und vorerst im ersten Hof des Museums aufgestellt. Im Sommer 1999
übersiedelte der Waggon auf den Platz wo er jetzt steht und hoffentlich
auch bleibt. Im Herbst 2001 wurde mit der Dacherneuerung begonnen,
wobei sogar ein Baugerüst aufgebaut werden musste. 10 Mitarbeiter des
Stadtmuseums waren nun vier Jahre damit beschäftigt, den Triebwagen
wieder so zurückzubauen, wie er wohl 1927 ausgesehen hat. In einer
kleinen Feier konnten am 15. Oktober 2005 die Museumsmitarbeiter, die
an diesem großen Projekt beteiligt waren, den Triebwagen wieder dem
„Verkehr" übergeben. Ca. 4000 unentgeltliche Arbeitsstunden brauchten
die Museumsfreunde für die Restaurierung dieses schönen Stückes. Die
Kosten beliefen sich auf ca. 20.000 €. Der Wagen wurde so umgebaut,
dass er auch für kleinere Feiern bis 20 Personen genutzt werden kann.
An dieser Stelle sei auch der Stadtgemeinde und der TBVG., der
Feuerwehr Möllersdorf, sowie der Fa. Broschek gedankt.

Luftschutzbunker


Die große Feuerwehrsammlung umfasst Dutzende historische
Löschfahrzeuge. Kleine Gerätschaften wie etwa eine Krückenspritze aus
1828, Einreißhaken, Leineneimer und verschiedene Kleinlöschgeräte
zeigen die Entwicklung der Feuerwehrgeräte von ihren Anfängen bis
heute. Zu sehen sind auch Helme und Uniformen ab dem Jahr 1896 bis
heute und zahlreiche Informationen zu den regionalen Feuerwehreinheiten.



TANKLÖSCHFAHRZEUG 2000 (TLF 2000), Steyr 480, Aufbau Rosenbauer Linz
Motor: 4-Takt-Dieselmotor Hubraum 5320 cm³ Leistung 95 PS bei 2300 U/min Baujahr 1959
Abmessungen: Länge 6615 mm, Breite 2400 mm, Höhe 2150 mm
Gesamtgewicht 9100 kg
Pumpe: Rosenbauer Type 59000 Nr. 59062
Hoch- und Normaldruck-Nebelpumpe mit Schnellangriffseinrichtung
Fahrerhaus: Doppelkabine
Wasser- und Schaumtank mit 2000 l Inhalt
Seit 1989 außer Betrieb



Die große Feuerwehrsammlung umfasst Dutzende historische
Löschfahrzeuge. Kleine Gerätschaften wie etwa eine Krückenspritze aus
1828, Einreißhaken, Leineneimer und verschiedene Kleinlöschgeräte
zeigen die Entwicklung der Feuerwehrgeräte von ihren Anfängen bis
heute. Zu sehen sind auch Helme und Uniformen ab dem Jahr 1896 bis
heute und zahlreiche Informationen zu den regionalen
Feuerwehreinheiten. Einen besonderen Stellenwert hat die Sammlung
Arndorfer. Prof. Dr. Herbert Arndorfer baute und sammelte
leidenschaftlich Modell-Feuerwehr-Autos. Von 1960 bis 2017 kamen rund
1.500 Objekte zusammen, die seine Witwe nach seinem Tod dem Museum
Traiskirchen übergab.

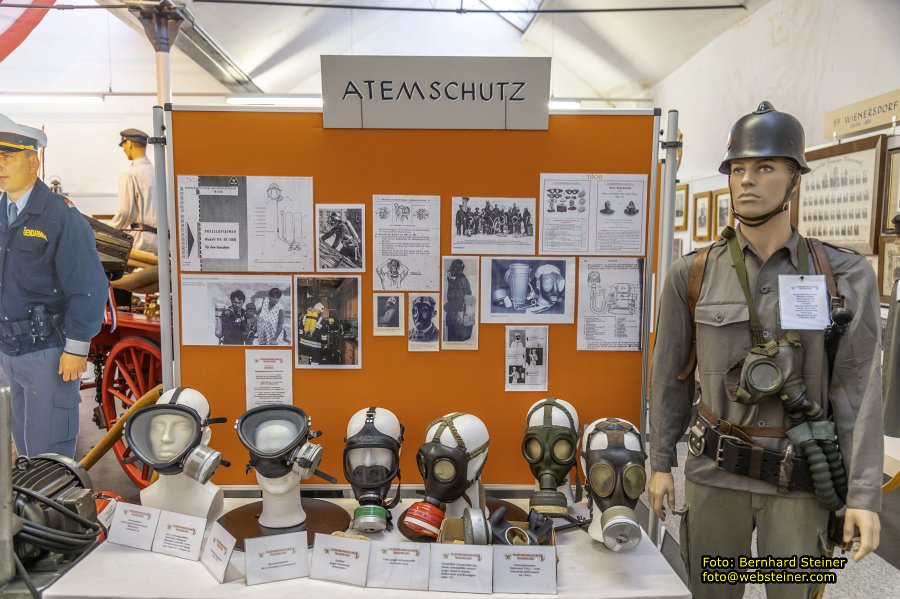
WASSERWAGEN, Baujahr 1899 Erzeuger Firma W. Knaust Wien für Pferdebespannung.
Es handelt sich um einen Vierrädrigen Wagen mit Metallkarosserie,
Vorderräder auf Doppelelliptischen Blattfedern, das hintere Fahrgestell
sitzt auf zwei Halbelliptischen Federn.
Wasserkessel: 750 Liter ovaler, genieteter Metallkessel mit
verriegelbarem Füllstutzendeckel, Wasserentleerungsventil an der
Unter-Seite des Kessels mit Hebeln rechts und links vor dem
Füll-Stutzen - vom Kutschbock aus zu betätigen. An der Rückseite des
Kessels wird ein Würfelähnlicher Wasserbehälter mit 400 Liter
Fassungsraum zur Bereitstellung für Dampfspritzen mitgeführt.
Ausrüstung: An der Unterseite der Karosserie befindet sich eine
Werkzeugtruhe mit Öffnung ober einem Trittbrett am Ende des Wagens,
rechts und links vom Kutschbock befinden sich Wagenlaternen, r. u. l.
je eine Petroleumfackel, drei Stück Saugschläuche mit
Messing-Gewindekupplungen 280-3 ein Saugkorb mit Gewinde S80-1, eine
Dachleiter zweiteilig mit Scharnieren, Gesamtlänge 5m.

Schlauchhaspelkarren mit
Handzugdeichsel und mit Kreuz auf der Achse für zirka 200 Meter
Schläuche samt Kupplungen und einem kleinen Requisitenkasten für zwei
Strahlrohre mit Hydrantenschlüssel. 1939 wurde die Freiwillige
Feuerwehr Wienersdorf in Feuerwache Wienersdorf umbenannt. Alle
Fahrzeuge und Geräte erhielten 1939 eine grüne Lackierung.



„LLF" Opel 1.9 to Kurzhauber FF TRAISKIRCHEN
Feuerwehrtechnischer Aufbau nach den Baurichtlinien des ÖBFV.
Erzeuger: Fa. Rosenbauer, Baujahr 1964 mit Vorbaupumpe „Automatic RV 120" Leistung: 1200 l/min bei 10 atü.
Ansaugen mittels automatischgesteuerter Doppelkolben-Entlüftungspumpe (Trokomat).
Dieses Fahrzeug wurde an die FF Schaditz verkauft mit der Bedingung,
nach der Ausmusterung des Fahrzeuges der Abteilung FEUERWEHR im
Stadtmuseum Traiskirchen zur unbefristeten Zurschaustellung überlassen.

Opel Blitz 5600, Freiwillige Feuerwehr Enzersfeld
Baujahr 1943, Leistung 75 PS, Ausstattung Vorbaupumpe, 14 Sitzplätze, Holzkarosserie mit Blechbeschlag, Suchscheinwerfer
Der Opel Blitz wurde im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht
eingesetzt und nach 1945 als Pritschenwagen zum Transport von Gemüse
verwendet. Erst 1955 wurde der LKW von der Firma Rosenbauer zum
Feuerwehrfahrzeug umgebaut. Bei der Fahrzeugsegnung im Jahr 1955 war
der Opel Blitz wegen eines technischen Defekts nicht fahrbereit und
musste von den Kameraden zur Segnung geschoben werden. Zuerst vermutete
man, dass die Batterie versagt hätte. Eiligst wurde Ersatz beschafft
und eingebaut. Da diese Batterie aber nicht hineinpasste, musste der
rechte Motordeckel leicht geöffnet bleiben, was auf den Fotos von
damals zu erkennen ist. Die Schadensursache aber war eine ganz andere,
und zwar war das Antriebsrad der Nockenwelle (Novotextrad) gebrochen.
Das Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Enzersfeld mit der
Bezeichnung „LF" (Löschfahrzeug) verwendet und hat über viele Jahre
hinweg gute und zuverlässige Arbeit geleistet. Um den aktuellen
Fuhrpark im Fahrzeughaus unterzubringen, entschied sich die Feuerwehr
Enzersfeld im Jahr 2020, den Opel Blitz als Dauerleihgabe an das
Stadtmuseum Traiskirchen zu übergeben.

Feuerwehrmuseum: Retten – Löschen – Bergen – Schützen
In einer angrenzenden Halle ist seit 2000 ein Feuerwehrmuseum mit
Löschfahrzeugen, Handdruckspritzen, einige mit Pferden bespannte
Löschfahrzeuge und historische Kraftfahrzeuge zu sehen. Kleine
Gerätschaften wie z. B. eine Krückenspritze aus 1828, Einreißhaken,
Leineneimer und verschiedene Kleinlöschgeräte zeigen die Entwicklung
der Feuerwehrgerätschaft bis heute. Zu sehen sind auch Helme, Uniformen
und zahlreiche Informationen zu den regionalen Feuerwehreinheiten.
Tauchen sie ein in eine Welt in der es nur ein Motto gibt:
Einmal Feuerwehr – immer Feuerwehr!


Spritzenfahrzeug Gräf & Stift 40/45
Erzeuger: Gräf & Stift, Wien 19, Weinbergg. 70
Baujahr: 1914
Motor: Benzinmotor, Hubraum: 7,36 Liter
Höchstgeschwindigkeit: 27 km/h
Aufbau: Wh. Knaust Wien
Einbaupumpe: 1200 Liter/min
Schlauchwagen mit 200 m Schlauch
Schiebeleiter 3-teilig mit Abstützung
Ehemals Werksfeuerwehr Ternitz
Leihgabe des Vereins zur Förderung der historischen Fahrzeuge der österreichischen Automobilfabriken

Volksgenossen!
In der Nacht vom 18. auf den 19. September 1938, um Mitternacht, wird
auch in Niederdonau der Straßenverkehr vom Links- auf den Rechtsverkehr
umgestellt. Zur klaglosen Durchführung dieser Maßnahme ist höchste
Sorgfalt aller Verkehrsteilnehmer erforderlich.
Kraftfahrer! Radfahrer!
Haltet Euch streng an die Grundregeln des Straßenverkehrs! Fahrt
rechts! Weicht rechts aus! Überholt links! Beim Einbiegen nach rechts
führt einen engen, nach links einen weiten Bogen aus! In der
Übergangszeit wird jede Geschwindigkeit, die den besonderen
Verhältnissen der Verkehrsumstellung nicht Rechnung trägt, als eine
Gefährdung des Verkehrs gewertet werden.
Fußgänger!
Benützet ausschließlich die vorgesehenen Gehwege! Überquert die
Fahrbahn nur an den hiefür bestimmten Orten und nicht schräg, sondern
senkrecht zur Richtung des Fahrverkehrs! Vor Überschreiten der Fahrbahn
blickt zuerst nach links und dann nach rechts. Unterlaßt das Auf- und
Abspringen von Straßenbahnen oder Autobussen!
Eltern und Erzieher!
Achtet auf Eure Kinder und belehrt sie rechtzeitig, sich im
Straßenverkehr richtig zu verhalten! Straßen sind keine
Kinderspielplätze!
Landeshauptmannschaft Niederdonau

Austro Fiat „AFN L"
Erzeuger: Österr. Automobil - Fabriks A.G.
Feuerwehr - Mannschafts- und Rüstwagen, offen, Sitze für insgesamt 8
Personen, Vorbaupumpe, Tragkraftspritze hinten, Schlauchhaspel auf dem
Dach.
Motor: 4 Zylinder Viertakt - Vergaser, Hubraum 2.837 cm, 42 PS bei 2200 Umdrehungen. Bj. 1931
Frw. Feuerwehr Senning, Post Sierndorf, abgemeldet am 18. Nov. 1964

FLUGHAFENLÖSCHFAHRZEUG FLF, Marke Yankee Walter Twin CBK 3000 Baujahr 1968
Die Betriebsfeuerwehr des Wiener Verkehrsflughafens Schwechat setzte
dieses von dem amerikanischen Hersteller Walter gebautes
Flughafenlöschfahrzeug in insgesamt drei Einheiten ein. Die Fahrzeuge
haben einen begehbaren Aufbau und einen ferngesteuerten
Schaum/Wassermonitor auf dem Dach der Kabine. Die Bestückung besteht
aus zwei 3800 l/min – Feuerlöschkreiselpumpen mit Zumischern; die
Beladung aus Löschwasser 11.300 Liter und 1900 l Schaummittel. Im Jahr
1997 wurden die Fahrzeuge außer Dienst gestellt.


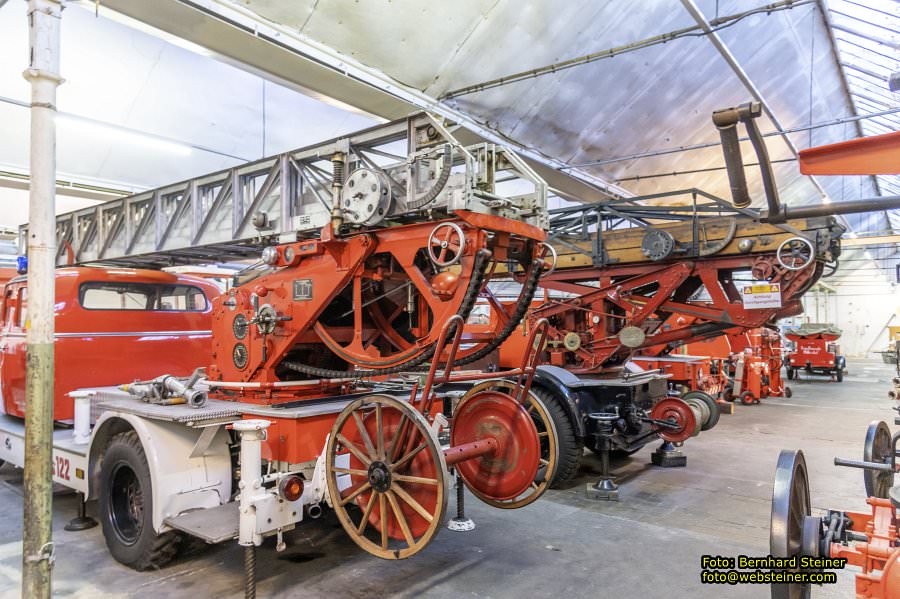
Kleine Wasserstraße - Wiener Neustädter Kanal
Diese Abteilung des Museums gibt es bereits seit 1993. Der Grund war
der 200. Geburtstag der Eröffnungsfahrt am 13. Mai 1803. Ein Teil des
Verlaufes des Kanals geht durch das Gemeindegebiet von Traiskirchen.
Unsere Gemeinde ist eigentlich eine „Drei-Flüsse Stadt". 1. Der Kanal,
2. Der Badener Mühlbach, 3. die Schwechat. Diese drei „Wasserstraßen"
fließen durch unsere Ortschaft. Aus diesem Grund verwechseln Radfahrer
und Wanderer gelegentlich die Namen der drei Gewässer.
Westlich des verbauten Stadtgebietes durchfließt in einer Länge von ca.
700 m der Wiener Neustädter-Kanal unser Gemeindegebiet. Der Kanal hatte
früher eine Sohlenbreite von 6 m und war 1,5 m tief. Das Gefälle betrug
von Wiener Neustadt bis Wien 104 m und der Kanal hatte 50 Schleussen
(zwei Schleussen befinden sich im Gemeindegebiet). Die Kähne waren 22,7
m lang, 1,73 m breit und für eine Traglast von 33.600 kg berechnet.
Insgesamt standen 64 solcher Lastschiffe zur Verfügung. Ein beladenes
Schiff brauchte von Wiener Neustadt bis Wien zwei bis zweieinhalb Tage.
1794 unterbreiteten Bernhard Tschoffen und seine Gefährten das im Jahr
1786 von Archtitekt Maireé ausgearbeitete Kanalprojekt dem Kaiser
Franz, der der Gesellschaft mit 500.000 Gulden als Großaktionär beitrat.
1797 wurde mit dem Bau der Teilstrecke Wien - Vöslau begonnen, wobei
die Regierung zu den aufgenommenen Erdarbeiten auch Soldaten und
schließlich sogar Sträflinge beistellte. Vor dem Gelände des Wiener
Hauptzollamtes wurde der große Kanalhafen angelegt.
1801 wurde das Kanalbett vom Wass der Piesting und dem Kalten Gang gespeist.
1803 konnte der Verkehr zwischen Wien und Wiener Neustadt mit 16
Frachtbooten aufgenommen werden, zu denen bald ganz Schiffszüge kamen.
Täglich wurden einige hundert Pferde eingesetzt. Schon im ersten
Betriebsjahr wurden 190.000 Zentner Steinkohle, eine Million Stück
Ziegel sowie 10.000 Kubikklafter Holz nach Wien befördert.
1878 befanden sich entlang des Kanales von Wiener Neustadt bis Wien zwölf Mahlmühlen und fünf Fabriken.
Nach 1945 wurde es still um den alten Kanal.
Um den Kanal seinen Interessenten zu erhalten, kaufte ihn im Jahr 1956
das Land Niederösterreich um öS 500.000,- womit der Bestand dieses
Wasserlaufes sichergestellt wurde.
Der Wiener Neustädter Kanal in Zahlen
1797 Baubeginn in Guntramsdorf
Baukostenvoranschlag: 3,7 Millionen Gulden
Tatsächliche Baukosten: 11 Millionen Gulden
25. April 1803 Übergabe an die Schifffahrt
1. Juli 1879 Letzte Fahrt
Länge: 65 km
Gesamtgefälle: 100 Höhenmeter
Wassertiefe: 1,6-1,9 Meter
Schleusenkammern: 50
Spiegelbreite: 11 Meter
Sohlenbreite: 5,70 Meter
Schleusenbreite: 2 Meter (später 2,5 Meter)
Länge der Lastenkähne: 23 Meter
Schiffswerft Passau
Höchstlast: 30.000 kg
Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h
Fahrtdauer Wien - Wr. Neustadt: 14 Stunden

Holzschnitt der Stadt Wien 1873
Bei dieser Ansicht von Wien werden Sie bemerken, dass viele Gebäude,
die wir heute kennen, noch gar nicht gebaut oder die Fundamente eben
erst ausgehoben wurden. Traiskirchen ist also am Entstehen der
Ringstraße und deren Bauten indirekt beteiligt. Mit der
Pferdestaßenbahn oder der ersten "Elektrischen" wurden die
Ziegeltransporte direkt zu den vielen Großbaustellen am Ring
durchgeführt. Tausende böhmische "Ziegelweiber" und Maurer trugen die
schwere Last zum Teil auf dem Kopf bis in das 5. Stockwerk oder in den
dreistocktiefen Keller. Jeder Ziegellieferant hatte sein eigenes
Monogramm in den Ziegel gepresst, um eine Zuteilung und
Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Die Ziegelwerkbesitzer verdienten
sich dabei die berühmte "Goldene Nase ". Die " Ziaglbehm " hingegen
lebten oft in großer Armut. In den 6 Ziegelwerken von Traiskirchen war
es nicht anders. Kinderarbeit war an der Tagesordnung! Rechts an der
Wand gibt es einen großen Holzschnitt von Wien um 1873 zu sehen. In
diesem Jahr fand in der aufstrebenden Millionenstadt die
Weltausstellung statt. Diese Zeit war die Hochblüte der Ziegelerzeugung
für die vielen schönen Ringstraßenbauten, welche heute noch Wien's
Charme ausmachen. Millionen der Ziegel kamen natürlich aus Traiskirchen!

1683 Rot-weiß-rote Schicksalstage in Wien
Die Geschichte, den vergeblichen Versuch der Türken Wien zu erobern,
begann schon 1529. Da sollte Ungarn unter osmanische Kontrolle kommen.
Im selben Jahr brach Sultan Suleiman II. mit 130.000 Mann in der Türkei
auf, um die Österreichische Haupt- und Residenzstadt Wien am 25.
September das erste Mal zu belagern. 17.000 Verteidiger verschanzten
sich in der befestigten Stadt, doch die Eingeschlossenen hatten Glück.
Die Österreicher unter Graf Salm kämpften mit solchem Heldenmut, dass
die durch verheerende Seuchen geschwächten Türken den Rückzug antraten.
Die Hauptleidtragenden war die Bevölkerung des Wiener Umlandes. Manche
Ortschaften wurden bei diesen Kriegswirren total zerstört und die
Bewohner stark dezimiert. In Traiskirchen wurde die Pfarrkirche St.
Margareta bis auf die Grundmauern eingeäschert. Aus diesem Grund holte
sich das Kaiserhaus aus Tirol und Südtirol fleißige Bauern, die für die
darniederliegende Landwirtschaft arbeiten konnten. Die Namen der
Siedler sind heute noch bei uns sehr häufig zu finden. Nach 154 Jahren,
1683 standen die Türken unter Kara Mustafa Pascha mit 107.000 Mann
wieder vor den Toren Wiens. Kaiser Leopold war samt Familie nach Passau
geflohen. Inklusive Bürgerwehr und Freiwilligen zählten die Verteidiger
nur 15.000 Mann. Bürgermeister war Johann Andreas von Liebenberg, der
durch seine Tapferkeit gegen die Türken auffiel und sogar sein Leben im
Kampf gegendie Türken opferte. Die Stadt wurde dabei von Erdberg bis zu
Rossau belagert. Türkische Brandgeschoße gefährdeten die vielen
Schindeldächer der Stadt. Die Grab- und Schanzarbeiten der Osmanen bis
unter die Stadtmauer beschädigten die Stadt zusätzlich. Das war die
Stunde des polnischen Königs Jan Johann Sobieski III. Er war nicht ganz
der großherzige, selbstlose Retter in der Not. Erst nach einer
„kleinen" Spende von 500.000 Gulden konnte Papst Innozenz XI König
Sobieski „motivieren", sich in den Kampf zu stürzen. Ebenso erhielt der
erst 20-jährige Prinz Eugen von Savoyen seine Feuertaufe. Herzog Karl
von Lothringen, sowie 10.000 tapfere Sachsen eilten heran, 9.500
Franken und 113.000 Bayern marschierten aus dem Wienerwald über den
Kahlenberg und Leopoldsberg, um Wien zu retten. Die Belagerung dauerte
gesamt 62 Tage bis zum 12. September und kostete Kara Mustafa das
Leben. Die Türken mussten abziehen! Die kaiserlichen Truppen verfolgten
die Krieger des Sultans bis nach Ungarn und eroberten Stadt um Stadt
zurück. Im September 1697 siegte Prinz Eugen in der Schlacht bei Zenta
und rettete damit endgültig das Abendland und das Haus Habsburg.
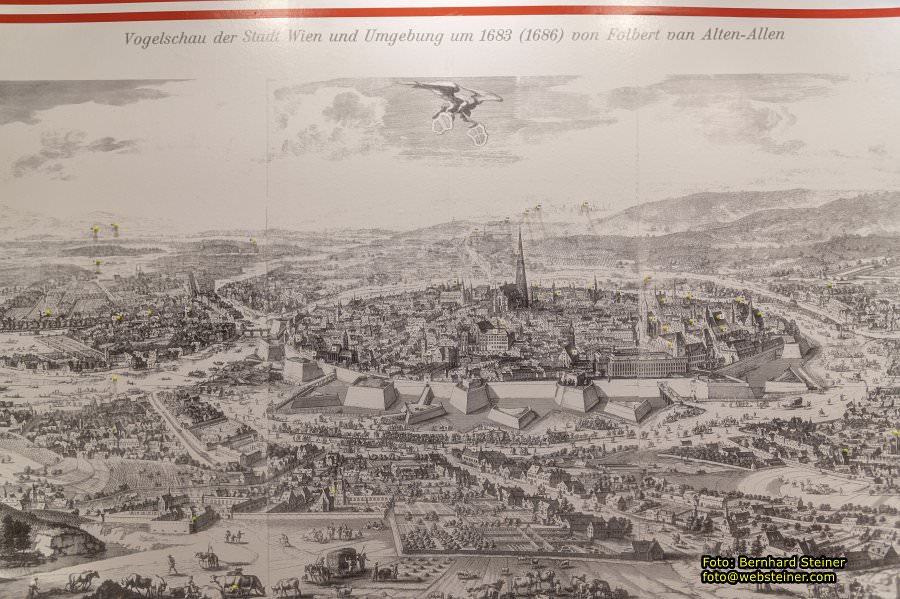
Hier ist eine Buchdruckerei zu
sehen, wie sie bis Anfang der 1970er Jahre in Österreich anzutreffen
war (meist waren zu dieser Zeit aber zusätzlich weitere automatisierte
Druckmaschinen in Verwendung). Der Buchdruck zählt zu den
Hochdruckverfahren, bei denen die druckenden Elemente erhöht sind.
Gedruckt wird von einzelnen Lettern aus Blei oder Holz (bei großen
Schriften für Plakate), von ganzen Zeilen aus Blei, Messinglinien und
Klischees (für Bilder) aus Zink, Magnesium oder Kunststoff.
Die einzelnen Bleilettern werden vom Schriftsetzer zu einem fortlaufenden Text zusammengefügt - dem Schriftsatz.
Dazu stehen ihm der Handsatz (hat sich seit seiner Erfindung durch
Johannes Gensfleisch zum Gutenberg um 1445 kaum verändert) und der
Maschinensatz zur Verfügung.
Beim Handsatz steht der Setzer
vor dem aufgestellten Setzkasten mit der gewünschten Schrift. Er nimmt
Letter für Letter händisch aus den Fächern und fügt sie im Winkelhaken
zu einer Zeile zusammen. Die Zeilenbreite hat er zuvor mit dem Frosch
auf dem Winkelhaken eingestellt. Die fertige Zeile hebt er aus und
stellt sie auf das Satzschiff (ein spezielles Metall-Tablett), auf dem
so der ganze Text entsteht.
Beim Maschinensatz werden
Gießmatrizen für die einzelnen Buchstaben aneinandergereiht und nach
dem Ausschließen mit flüssigem Blei ausgegossen. Die Matrizen können
dann wiederverwendet werden. Man unterscheidet Gießmaschinen, bei denen
die Matrizen händisch aneinandergereiht wurden (hauptsächlich für große
Schriftgrade im Einsatz) von Setz- und Gießmaschinen, bei denen das
Setzen dank einer Tastatur rascher erfolgen konnte (sie wurden vor
allem für große Textmengen wie in Zeitungen und Büchern verwendet).
Letztere werden weiter unterteilt in Einzelbuchstaben-, Setz- und
Gießmaschinen (wie die Monotype; 1897 von Tolbert Lanston entwickelt)
und Zeilensetz- und Gießmaschinen wie Typograph (1888 bis 1890 von John
R. Rogers gemeinsam mit Fred E. Bright entwickelt), Linotype, und von
dieser abgeleitet Monoline (1892/93 von Wilbur St. Scudder).
Die Linotype zählt zu den
meistverbreiteten Bleisetzmaschinen. Sie wurde von Ottmar Mergenthaler
1886 erfunden, später mehrfach verbessert und in zahlreichen Modellen
bis Ende 1976 hergestellt. Die Arbeit an der Linotype erfolgt im
Sitzen: Der Setzer tastet an einer speziellen Tastatur (separate Tasten
für die Versalien Großbuchstaben), wodurch die Matrizen mit den
entsprechenden Buchstaben aus einem oberhalb der Tastatur angebrachten
Magazin ausgelöst werden. Sie rutschen nach unten, sammeln sich zu
einer ganzen Zeile, die am Zeilenende mittels Keilen ausgeschlossen
wird und werden dann per Hebeldruck zur Gießvorrichtung transportiert.
Dort wird die Zeile mit flüssigem Blei ausgegossen und ausgestoßen, die
Matrizen werden über ein Schlüsselsystem automatisch wieder in das
Magazin sortiert. Der fertige Satz wird auf der Abziehpresse ein erstes
Mal abgedruckt, um Fehler korrigieren zu können. Nach der Korrektur und
einer weiteren Kontrolle auf der Abziehpresse kommt der Satz zur
Druckmaschine.
Für den Druck wird der Satz im
druckmaschineneigenen Schließrahmen fixiert und mit diesem in die
Druckmaschine eingehoben. Einfärbewalzen tragen Druckfarbe auf die
erhöhten Stellen des Satzes auf. Nun kann Papier eingelegt und gedruckt
werden. Ältere Druckmaschinen erforderten noch Handan- und auslage
(jeder Papierbogen wurde händisch in die Maschine gelegt und händisch
entnommen), bei neueren Modellen erfolgt dies mit Saug- und Blasluft
automatisch. Die hier gezeigten Druckmaschinen funktionieren beide mit
Handan- und auslage, eine verfügt über Elektroantrieb, die zweite
musste per Fußantrieb betrieben werden. Beide Maschinen zählen zu den
Tiegeldruckmaschinen. Auch die meistverkaufte Druckmaschine der Welt,
der Original Heidelberger Tiegel, ist dieser Gruppe zuzurechnen. Die
zweite große Gruppe von Buchdruckmaschinen stellen die Schnellpressen
dar (1812 von Friedrich Koenig erfunden). Tiegeldruckmaschinen und
Schnellpressen verdrängten rasch die davor verwendeten eisernen
Kniehebelpressen, die ihrerseits die hölzernen Pressen, die Gutenberg
auf Basis der Weinpresse entwickelt hatte, ab etwa 1800 ersetzt hatten.
Endfertigung - Sobald die
Druckfarbe getrocknet ist, kann das Druckerzeugnis am Planschneider (im
Stapel) auf das gewünschte Endformat geschnitten werden. Der
Planschneider hier im Museum funktioniert noch per Handkurbel, moderne
Maschinen sind elektrisch und computergesteuert. Bei Bedarf kann das
Produkt auch auf der Rill-/Perforiermaschine gerillt (für späteres
Falzen) oder perforiert werden. Eine Endfertigungsabteilung verfügt in
der Regel auch über eine oder mehrere Falzmaschinen, Heftmaschinen,
Bohrmaschinen (für Lochungen), Rütteltische, etc. Aufwendig
ausgestattete Endfertigungsabteilungen verfügen auch über Geräte und
Maschinen, um Bücher zu binden - daher werden Endfertigungsabteilungen
oft auch als Buchbindereien bezeichnet. Echte Buchbindereien sind aber
in der Regel mit weiteren Spezialgeräten ausgestattet, z. B. mit
Heißfolien-Prägepressen, um beispielsweise goldene oder silberne
Titelzeilen auf dem Buchrücken und dem Bucheinband anbringen zu können,
mit Fadenbindemaschinen, Buchpressen, etc.
Neben den Buchdruckmaschinen sind hier einfache
Bürovervielfältigungsmaschinen zu sehen. Für anspruchslose
Vervielfältigungsaufträge wurde der Text mit einer Schreibmaschine
geschrieben und in einem direkten Übertragungsverfahren eine Druckform
hergestellt, mit der einige hundert Exemplare (meist bis maximal A4)
vervielfältigt werden konnten. Diese Methode wurde von den
Fotokopiergeräten vollständig verdrängt, noch bevor der Computer die
Satzherstellung ganz übernommen hatte.
heutige Druckverfahren - Heute
wird der Bleisatz nur mehr sehr selten eingesetzt im künstlerischen
Bereich etwa für Gedichtsatz und für Heißfolienprägungen im Druck wie
im Buchbindereibereich. Bleisetzmaschinen wurden in den 1970er Jahren
vollständig vom Fotosatz verdrängt, der anschließend (1990er Jahre) vom
Desktop Publishing ersetzt wurde. Buchdruckmaschinen werden heute noch
für Sonderarbeiten in Druckereien eingesetzt (Prägen, Stanzen,
Stauchen, Perforieren, Nummerieren). Gedruckt wird heute hauptsächlich
im Offsetdruck, einem Flachdruckverfahren. Man unterscheidet hier den
Bogenoffsetdruck, bei dem einzelne Papierbogen bedruckt werden, vom
Rollenoffsetdruck, der zur Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften
von einer Papierrolle weg arbeitet. Daneben wird der Siebdruck, ein
Durchdruckverfahren, zum Bedrucken von Textilien, Schildern, Etiketten,
Plakaten, etc. eingesetzt. Der Tiefdruck hat in Österreich keine
Bedeutung mehr - in Deutschland und anderen größeren Ländern wird er
für die Herstellung von großen Auflagen von bunten Illustrierten
verwendet. Kleine Auflagen werden heute mittels alternativer
Druckverfahren direkt aus dem Computer gedruckt (Digitaldruck,
Vollfarbkopie).

Ziegel ... ein wichtiger Baustoff seit mehr als 7000 Jahren ...
In Anatolien und in Jericho wurden im 7. Jahrtausend v. Chr.
Luftgetrocknete Lehmziegel hergestellt und verwendet. In trockenen
Gebieten geschieht dies heute noch. Im 4. Jahrtausend v. Chr. baute man
Wehranlagen und Paläste aus gebrannten Ziegeln. Gebrannte Ziegel sind
ein sehr haltbares Produkt. Sie überleben Jahrtausende, wie
Ausgrabungen bezeugen. Ziegel sind nicht nur Baumaterial, sondern auch
Träger der ersten Schriften (Keilschrift der Sumerer in Mesopotamien,
im 3. Jahrtausend v. Chr.).
Das Wissen der Ziegelherstellung gelangte über den griechischen
Kulturraum zu den Römern, die die Technik verfeinerten und
unterschiedliche Ziegel hoher Qualität erzeugten. Nach dem Untergang
der römischen Kultur (Völkerwanderungszeit) geriet der Ziegel in den
Alpenländern in Vergessenheit und tauchte erst im frühen Mittelalter
wieder auf. Im Laufe der Zeit produzierten viele kleine
Ziegelbrennereien auf lokaler Ebene sehr unterschiedliche Ziegel. Erst
nach den Zerstörungen durch die Türken entstand unter Kaiser Leopold I.
ein Gesetz bezüglich der Ziegelherstellung in Österreich. Im Jahre 1715
wurden durch ein kaiserliches Patent Größe, Qualität und Preise der
einzelnen Ziegelarten geregelt.

Ziegelherstellung - Die
Schritte der Ziegelherstellung sind über Jahrtausende praktisch gleich
geblieben. Der Tegel (Ziegelton) ist ein tonmineralreiches
Sedimentgestein, welches aus feinkörnigen Meeres-, See- oder
Flußablagerungen stammt. Er wird in Ton- oder Lehmgruben abgebaut und
gegebenenfalls mit einem Magermittel (z. B. Quarzsand) vermischt. Nach
einer Lagerung (über den Winter) werden die Ziegel geformt (Model oder
Strangpresse) und getrocknet. Nach dem Durchtrocknen werden die Ziegel
gebrannt (900-1200°C). Die ziegelrote Farbe entsteht durch (natürliche)
Beimengungen von Eisenoxiden bzw. Eisenhydroxiden. Gelbliche bis
grünliche Ziegel entstehen aus Ziegeltonen, die reich an organischem
Material und/oder kalkreich sind. Eisenfreie Lehme ergeben nahezu weiße
Ziegel.
Beim Ziegelbrand entstehen aus den Tonmineralien ein sehr feinkörniges
und verfilztes Gemenge von meist schlecht kristallisierten
Alumosilikaten, welches für die Festigkeit und Beständigkeit des
Ziegels verantwortlich ist. Zur Ziegelcharakteristik gehörten die
Farbe, der makroskopische Aufbau (Homogenität, Konform und Größe des
Matemittels) und die mineralogische Zusammensetzung (besonders der
Schwerminerale, die über die Herkunft des Ziegeltones Auskunft geben
können).
Die Bezeichnung Ziegel leitet sich vom lateinischen „tegula" her (von
tectum - Dach): Tegula (= Rohstoff-Bezeichnung Tegel) - ziagal
(althochdeutsch) - ziegel (mittelhochdeutsch) ab.

Ziegelsammlung
Im Stadtgebiet von Traiskirchen gab es ehemals sechs Ziegeleien.
Das Wort Ziegel ist ein landläufiger Sammelbegriff für getrocknete,
aber auch hoch gebrannte keramische Mauersteine. Es gibt aber auch
Klinker und Fliesen, gebrannte bzw. glasierte Dachziegel sowie
gehärtete lehmige bis tonige Zuschlagstoffe in Mörtel und Kunststein.
Sehenswert sind die gestempelten Ziegel an der Stirnseite des Raumes.
Jede Ziegelei hatte ihre eigene Abkürzung: Einige Beispiele sind: LR -
Leopold Ramminger, KT - Karl Theuer, oder einer der bekanntesten
Ziegeln HD - Heinrich Drasche. Seine Firma wird später die Firma
Wienerberger.
Die Herstellung nannte man früher das „Ziegel schlagen". Das Material,
der Lehm, wurde aus einer Ziegel- oder Lehmgrube abgegraben. Der Ton
musste dann einen Winter lang ausfrieren. Im Frühjahr war er dann gut
knetbar. Meistens brachten die Männer, die Ziegelarbeiter, den Lehm in
Scheibtruhen zum Schlagtisch. Der Lehm wurde dann in eigene Formen aus
Holz geschlagen. Dies war eine typische Frauenarbeit. Mit dem
sogenannten Streichbrett wurde dann alles glatt gestrichen. Zuvor
mussten die Formen allerdings mit Sand ausgestreut werden, ähnlich wie
beim Kuchenbacken, damit der Lehm nicht in der Form haften blieb. Diese
Arbeit wurde von sogenannten „Sandlern" gemacht. Später verbreitete
sich dieser Ausdruck für Menschen, die man zu keiner anderen Arbeit
gebrauchen konnte. Die geformten Ziegel wurden dann aus der Form
herausgestürzt und am Boden flach zum Trocknen aufgelegt. Dieser
Arbeitsschritt musste oft von Kindern ausgeführt werden. Eine gute
Arbeitspartie brachte es auf bis zu 1.500 Ziegel am Tag!
Zwischen 4 und 6 Wochen wurden die Ziegel dann getrocknet, bevor sie
ein sogenannter „Einscheiber" in den großen Ringofen schlichtete, wo
sie gebrannt wurden. Der Brennvorgang dauerte etwa eine Woche. Ein
„Ausscheiber" holte die Ziegel dann wieder ans Tageslicht und bekam
dafür einen höheren Lohn. Er musste ja am heißen Ofen arbeiten und mehr
trinken als die anderen Arbeiter. Südlich von Wien gab es viele
Ziegeleien. Die fertigen Ziegel wurden mit Schiffen am Wiener
Neustädter Kanal und später mit der Badner Bahn nach Wien
transportiert. Viele Millionen Ziegel wurden für den Auf- und Ausbau
der Hauptstadt Wien benötigt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: