web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Freilichtmuseum Vorau
Museumsdorf Vorau, Juli 2024
Mehr als 20 sehenswerte bäuerliche Objekte der letzten 500 Jahre mit originalem Inventar dokumentieren die oststeirische Arbeitswelt der vergangenen Jahrhunderte und zeigen den damaligen Alltag der einfachen Bevölkerung. Alle Gebäude sind im ursprünglichen Zustand erhalten. Sammlungen von Maschinen, Geräten und Werkzeugen geben Einblick in teilweise schon ausgestorbene Handwerksberufe. Im Jagahaus ist eine ärztliche Hausapotheke mit chirurgischen Geräten zu sehen, nebenan haben eine eingerichtete Dentistenordination, eine Buchdruck-Handsetzerei sowie Kinovorführapparate Platz gefunden.

Das Freilichtmuseum Vorau wurde ab 1970 errichtet, die Häuser aufgebaut
und das Inventar gesammelt. Am 1. Mai 1979 wurde es eröffnet. Es
enthält viele Originalgebäude und eine umfangreiche Sammlung von
Werkzeug, Fahrnissen und handwerklichem Inventar. Mehrere
Sonderausstellungen bereichern das Museum. Die Ausstellungsräume
umfassen eine Fläche von 1690 m². An Originalgebäuden sind zu sehen:
Rauchstubenhaus Marotti (1706), Bauernstube Zenzl im Graben (1783),
Feldkästen (ab 1636), Mühlen und Ölstampf, Ausgedinge-Stube Hoanl
(1875), Bauernsäge und Preßhaus, Geräteschuppen für Fahrnisse,
Bauernschmiede, Krautgrube und Krautkessel, Böllerhäuschen, kleine
Tenne ... u.a.m. - weiters die Brunnen-Sitzgruppe und den schönen
Schweltenzaun.

Alles was früher an Geräten und Werkzeug verwendet wurde, ist zu sehen.
Es ist erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln gearbeitet werden
mußte. Und doch waren die Menschen damals zufriedener als heute. Man
lebte einfach und bescheiden, fast alles war Handarbeit. Erst ab 1950
zogen die Technik und fortschrittliche Wirtschaftsformen ein. Ein
großer Umbruch war die Folge.
An Sonderausstellungen sind zu sehen: Buchdruck und Handsetzerei,
ärztl. Hausapotheke und Pillenherstellung, der Dentist, Schulmuseum,
der Imker, verschiedene Handwerker und ihr Werkzeug, der Schuhmacher,
Werkzeuge vom Tischler, Wagner, Seiler, Faßbinder, Sattler &
Tapezierer, u.v.a. Bei der Krautgrube kann man die uralte Form der
Krautkonservierung sehen, wie dies hier bis 1950 üblich war. Jeder
Bauer hatte seine Krautgrube. Das Wetterhäuschen zeigt, wie man sich
früher vor dem Unwetter zu schützen suchte. Weitere Überraschungen kann
man bei einem Gang durch die vergangenen Jahrzehnte erleben. Kommen
Sie, Sie werden überrascht sein.

Neben den Gebäuden zeigt das Freilichtmuseum alte Gerätschaften,
Maschinen und Werkzeuge von immer seltener werdenden Handwerksberufen:
Zimmerer, Tischler, Fassbinder, Wagner, Schuster, Hafner, Leinenweber,
Sattler, Seiler, Binder, Schindelmacher und Buchdrucker. Weiters sind
eine historische ärztliche Hausapotheke, alte chirurgische Geräte aus
dem Krankenhaus Vorau und eine komplett eingerichtete
Dentistenordination zu sehen.


Das 1979 gegründete Freilichtmuseum ist heute das zweitgrößte Museum der Steiermark. Es wird von einem Verein geführt.

Diese mächtige Torsäule diente
wegen der zeitlosen Haltbarkeit zur Befestigung der Tore und Türl an
den Zäunen (dazu benötigte man das Loch). Mit Zäunen wurden Viehweiden,
Anger, die Gebäude, kleinere Äcker abgesichert. In dieser Gegend sieht
man noch viele "Torsäulen" die heute keine Funktion mehr haben. Hier
sind noch 8 in ihrer ursprünglichen Verwendung zu sehen. Die Torsäulen
hatten keine mystische / astronomische oder religiöse Bedeutung, sie
dienten nur diesem praktischen Zweck. Sie mit den "Menhiren"
(Langsteine) in England oder auf der Insel Malta in Verbindung zu
bringen, ist wohl etwas abwegig. Sie hatten hier auch keine kultische
Bedeutung - schon gar nicht als "Schießscharte" im Kriegsfall, wie
einmal in einer Zeitung behauptet wurde.

In der Rauchstube Marotti spürt man die Entbehrungen und Kargheit des
bäuerlichen Lebens. Die Schulklasse aus der Wende zum 19. Jh. zeigt die
Schulsituation am Ende der Kaiserzeit. Zahlreiche Kurzfilme geben
Einblick in die Arbeitsweise der vergangenen Jahrhunderte.
Viel Rauch und kein Luxus - Rauchstubenhaus Marotti
Das Wohnhaus aus dem Jahr 1706 war bis 1971 bewohnt. Es ist vollständig
aus Holz gebaut und war ursprünglich mit Stroh gedeckt. Aus Kosten- und
Haltbarkeitsgründen schützt seit 2014 ein Schilfdach, manchmal auch
Reetdach genannt, das Gebäude vor allen Witterungen. Das Wohnhaus
gliedert sich in 3 Teile: Rauchstube, Laben und Kammer. Die Laben –
eine Art Vorraum - und die Kammer sind wahrscheinlich erst später
angebaut worden. 1974 baute es der Museumsgründer mit zahlreichen
HelferInnen hier auf. Es war das erste Gebäude des Freilichtmuseums
Vorau. Das Grundstück, ein ehemaliger Forstgarten, gehört dem
Chorherrenstift Vorau.

Der Schweltenzaun - Dieser
schöne Zaun ist typisch für diese Gegend und war früher sehr
verbreitet. In Verbindung mit den Stein-Säulen wirkt er besonders
schön. Seine Herstellung ist allerdings sehr arbeitsaufwendig und nur
wenige sind dazu auch noch in der Lage.
Herstellung: Zuerst müssen die zwei Meter langen "Schwelten" aus einem
Fichtenbloch gespalten werden, dann werden die Pflöcke (Stipfel) aus
Fichtenästen gerichtet und zuletzt die "Wieden" (auch Fichtenäste, aber
dünn) vom Baum gehackt. Die "Stipfel" werden im Abstand von ca 30 cm
eingeschlagen und dann die "Schwelten" eingelegt. Mit den vorher im
Feuer leicht angesengten ("gebähten") Wieden werden die Schwelten
zwischen den Pflöcken eingebunden, wobei diese gedreht (gewunden)
werden, damit sie nicht abreißen. Der Schweltenzaun ist sehr lange
haltbar (25-30 Jahre!) und sehr fest (stark). Er diente der Umzäunung
(Einfriedung) von Weiden, Schweineangern, Hausgärten...
Es gibt nur wenige Männer, die ihn heute noch herstellen können. Herr
Kandlhofer und Herr Petz (Hanslois) stellten ihn im August 1996 auf. Er
ist jetzt auch in unserer Gegend kaum noch zu finden und soll daher
hier im Museum als Beispiel alter Zauntradition gezeigt werden.

Die Rauchstube 1706
Sie war gleichzeitig Küche, Wohn- und Arbeitsraum, Fleischselch und
Aufenthaltsraum für die Familie. Alle häuslichen Arbeiten fanden hier
statt. Nur hier konnte am offenem Feuer in den gußeisernen Kesseln
gekocht, in den Pfannen gebraten und im Backofen das Brot gebacken
werden. Man sieht die Betten, ein Gitterbett, eine Wiege und in der
Mitte die Gehschule für die Kleinkinder. Vorne stehen ein hölzener
Rollstuhl und ein Spinnrad. Auf dem Backofensims steht verschiedenes
Geschirr, ebenso im langen Gesims an den Wänden: hölzerne Teller und
Schüsseln aus Ton. Am großen, Jogellandtisch" in der Ecke wurde
gegessen - vorher aber immer gebetet. In der Ecke befindet sich das
Kastl, darüber ein großes Kreuz und einige Heiligenbilder. Der
jahrhundertlange Rauch hat die Wände schwarz gebeizt und mit einer
Kruste aus Ruß überzogen Die Rauchstuben waren immer einfach und
bescheiden eingerichtet Seitlich über dem Herd ist ein größerer Vorrat
an„Kienspänen" für die Beleuchtung hergerichtet.
Seit 1945/50 gibt es auch hier keine solchen Stuben mehr; sie wurden
abgerissen, brannten ab oder wurden verkauft. Diese hier ist die
einzige noch bestehende. Unter der langen Sitzbank befindet sich eine
Hühnersteige für die Legehühner, die hier ihre Eier ablegten Sie wurden
auch in der Stube gefüttert. Hinter der Tür ist ein Kastel mit Laden
für Mehl Schmalz, Salz etc. Auch die Abwasch ist dort zu sehen. Solange
geheizt wurde, war dichter Rauch in der Stube, der bis in Augenhöhe
reichte. Erst nach dem Abheizen wurde durchgelüftet und die Wärme der
Ofenglut breitete sich angenehm in der Stube aus.


Wenig Zeit fürs Lernen - eine Schulklasse um 1900
Die Kinder wurden früher oft in Bauernstuben unterrichtet. In jeder
Bank saßen 2 bis 6 SchülerInnen je nach Größe und Alter. Der Lehrer
(seltener eine Lehrerin) stand hinter einem Schreibpult, das auf einem
erhöhten Podium stand. So konnte er/sie die Kinder besser sehen. Nicht
selten waren 60 bis 80 Kinder in einer Klasse, doch es konnten auch
mehr sein. Im Abteilungsunterricht hatte der/die LehrerIn mehrere
Schulstufen (Abteilungen) gleichzeitig zu unterrichten. In der 1. und
2. Klasse benutzten die Kinder die kleinen Schiefertafeln. Ab der 3.
Klasse durften sie mit Feder und Tinte im Heft schreiben. Die
Schulmöbel, Anschauungsbilder, Amtsschriften, Lehrbücher, Handarbeiten,
etc. stammen aus dem Bezirk Hartberg.

UNSERE SCHULORDNUNG
1. Wir kommen rein gewaschen, reinlich gekleidet und rechtzeitig in die Schule.
2. Auf dem Schulweg benehmen wir uns artig und anständig.
3. Vor dem Eintritt in das Schulhaus reinigen wir uns die Schuhe.
4. Die Knaben nehmen ihre Kopfbedeckung schon vor dem Eintreten in das
Klassenzimmer ab, die Mädchen sogleich nach dem Eintreten.
5. Im Klassenzimmer begeben wir uns sofort auf unsere Plätze und bereiten uns ruhig auf den Unterricht vor.
6. Wenn der Lehrer oder andere Personen das Klassenzimmer betreten oder verlassen, stehen wir auf und grüßen höflich.
7. Während des Unterrichtes bemühen wir uns, gerade zu sitzen und
aufmerksam zuzuhören. Werden wir gerufen, erheben wir uns rasch und
antworten laut und deutlich.
8. Wenn einer von uns zu spät kommen sollte, entschuldigt er sich
sofort. Gegen sämtliche Lehrpersonen sind wir ehrerbietig, gehorsam,
offen und wahr.
9. Während der Pause machen wir keinen Lärm. Beim Spiel im Schulhof
sind wir nicht ausgelassen. Zu unseren Mitschülern sind wir immer
freundlich und hilfsbereit. Wir wollen einander dienen!
10. In allen Streitfällen, die wir nicht allein in Güte schlichten
können, wenden wir uns vertrauensvoll an unseren Lehrer. Einen Verlust
oder einen Fund von Gegenständen melden wir sofort.
11. Wir halten unsere Schulräume rein. Auch Bücher und Hefte halten wir sauber und in gutem Zustande.
12. Wir werden daheim stets fleißig lernen und unsere Aufgaben gewissenhaft und rein ausarbeiten.
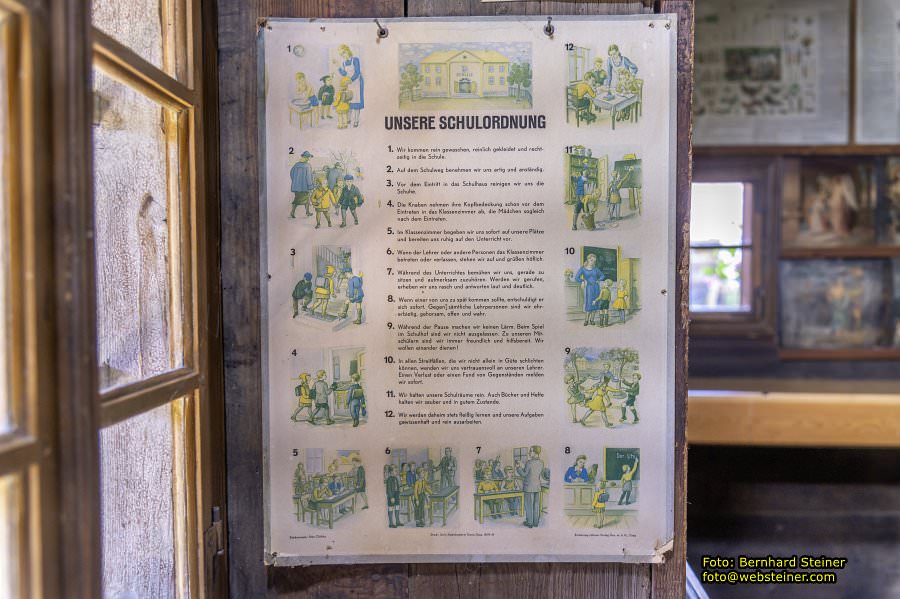

Auf dem knapp 1 ha großen Areal des Freilichtmuseums sind alte Bauwerke
aus dem ländlichen Raum, die überwiegend in der östlichen
Obersteiermark abgetragen wurden, originalgetreu wieder errichtet
worden. Der Bestand, der einen zentralen Platz umschließt, umfasst etwa
zwanzig Objekte, darunter einen Bauernhof, zahlreiche Nebengebäude und
Feldkästen, eine Mühle, eine Schmiede und mehrere Waldarbeiterhütten.
Die Häuser werden durch alte Einrichtungsgegenstände und bäuerliches
Werkzeug ergänzt.

Ackerbau
Alle hier ausgestellten Geräte und Maschinen wurden bis in die Mitte
des 19. Jhdts. in der Landwirtschaft gebraucht. Bis dahin war in
unserer Gegend die Feldarbeit zumeist händisch zu verrichten.
Dabei kamen unter anderem folgende Geräte zum Einsatz: Pflug, Egge,
Sense, Sichel, Wetzstein, Dengelstock, Rechen, Gabel, Haue, Reiter
(Sieb), Drischel, Schmeißstock, Schmeißmaschine, Putzmaschine (O-Wind),
Tennschaufel, Geräte für die Herstellung der Deckschab (Verwendung für
das Strohdach), Brandfurkel. Als Zugtiere kamen Pferde, Ochsen und Kühe
zum Einsatz. Sie wurden meist paarweise eingespannt. Nach dem 2.
Weltkrieg begann der Traktor die Landwirtschaft stark zu verändern. Er
und die zahlreichen von ihm angetriebenen Maschinen sind nicht mehr aus
der Landwirtschaft wegzudenken. Der Mähdrescher erledigt heute die
einst mühsame und personalintensive Ernte des Getreides binnen weniger
Stunden.

Kutschen und Schlitten waren
der „Mercedes" begüteterer Bauern. Sie waren durchwegs von Pferden
gezogen. Und Pferde hatten nur große Bauern !Es gab welche mit
hözernen, mit Leder besetzten Sitzen, mit geflochtenen Körben, einfache
„Steirerwagerl"...in den „Kaiserfarben" (rot-gelb-schwarz) gestrichen,
mit Bremsen und Laterne. Wie man es sich eben leisten konnte. Und wie
heute mit den diversen Automarken. Also für jede Brieftasche das
passende Gefährt.

Alles wird verwertet - Hausschlachtung
Zur Selbstversorgung schlachteten die Bauern vor allem Schweine und
Rinder, mitunter auch Schafe und Ziegen. Zuerst betäubte man das Tier,
danach wurde es gestochen. Die Landwirte verwerteten das ganze Tier.
Selbst das Blut, die Innereien und der Darm wurden verwendet. Die Haut
kam in die Gerberei, wo sie zu Leder verarbeitet wurde. Aus dem Fett
erzeugte man Schmalz. Das Fleisch legte die Bäuerin in die Sur (würzige
Flüssigkeit). Dieser Vorgang heißt einbeizen. Nach 14 Tagen selchte man
das Fleisch. Da es keine Kühltruhen oder Kühlschränke gab, war dies die
einzige Möglichkeit, Fleisch für längere Zeit zu konservieren.

Die Bauernsäge
Sie wurde 1979 erworben und 1980 hier wieder aufgestellt. Viele Bauern
hatten eigene Sägen, mit denen sie ihr Holz (Bloche) zu Brettern,
Pfosten oder Bauholz schnitten. Vorher mußten sie alles händisch
zersägen, was eine sehr schwere und mühevolle Arbeit war. Die schweren
„Zimmerbäume" für die Gebäude (Stuben, Ställe, Stadel etc.) mußte man
per Hand mit dem „Breitbeil" aushacken, wobei viel Holz zerhackt wurde.
Das war die Arbeit des Zimmermannes, der die Teile dann auch
zusammenzimmerte. Hier sieht man alle Geräte und Vorrichtungen einer
Säge. Der Antrieb erfolgte mit Wasserkraft. Im Untergeschoß ist der
Antriebsmechanismus zu sehen. Auch eine komplette
Säge-Feiler-Einrichtung ist da. Das große Wasserrad gehört zur
Tomez-Mühle (5m im Durchmesser).






Haustrunk am Bauernhof - Apfelsaft und Most
Die Erzeugung von Apfelsaft bzw. Most war eine wichtige Arbeit im
Herbst. Auf beinahe jedem Bauernhof gab es Geräte zur Saftgewinnung.
Das Pressobst wurde im Rollnursch oder einer entsprechenden Maschine
zerquetscht. In der Mostpresse presste man aus dieser Maische durch das
Gewicht des Pressbaumes den Apfelsaft heraus.
Der Süßmost gärt in Fässern. 4 bis 6 Wochen später kann der Most
getrunken werden. Nach Abschluss der Gärung verschließt man die Fässer.
In den letzten Jahrzehnten haben Druckpressen die alten Holzpressen auf
den Bauernhöfen vollständig verdrängt. Von der Qualität des Mostes
zeugen die vielen Auszeichnungen, die die Mostbauern des Jogllandes
bereits erhalten haben.

Der Weg zum eigenen Öl - Ölstampf und Mühle
Ölstampf und Mühle waren oft im gleichen Raum oder Gebäude
untergebracht, da beide dieselbe Wasserkraft nutzten. Der Ölstampf
diente der Gewinnung des Leinöls. Der Lein (Linsert) ist die Frucht des
Flachses. Er wird im Backofen getrocknet, dann in den Anken
(Vertiefungen im Ankenbloch) mit Stesseln zu Mehl zerstampft. Danach
wird er gesiebt, in der Pfanne geröstet, mit etwas Wasser versetzt und
wieder gestampft. Dabei löst sich das Öl. In der Presse (Rad- bzw.
Spindelpresse) wird das Öl ausgepresst. Die Bauern verwendeten das
Leinöl als Nahrungs-, Heil- und Futtermittel (Ölkuchen). Nur größere
Bauern hatten einen Ölstampf. Für das Stampfen wurde eine Ölmaut
einbehalten. Die letzten Ölstampfen bestanden bis ca. 1950. Auch Gerste
wurde im Stampf gestampft. Man benötigte sie als Rollgerste in der
Suppe, im Breinsterz oder in der Wurstfülle.



Nägel mit Köpfen - Bauernschmiede Unterer Zisser
Diese Schmiede stammt aus Schachen und ist ein Geschenk der Familie
Saurer. Sie stand noch bis 1979 in Verwendung. Zur Anfertigung
bestimmter Eisenteile bzw. zur Reparatur landwirtschaftlicher Geräte
war eine Schmiede unerlässlich. Größere Bauernhöfe besaßen dazu eigene
Schmieden. Eine Esse mit Blasbalg und die entsprechenden Werkzeuge
waren für einen Schmied unerlässlich. Störschmiede, das waren von
Bauernhof zu Bauernhof wandernde Facharbeiter, erledigten bis etwa 1930
diese Arbeiten, falls einem Bauern die Zeit oder das notwendige
Geschick fehlte. Während Hufschmiede eine Prüfung ablegen mussten,
wurden Wagenschmiede meist angelernt.


Viel Platz für Vorräte - Doppelter Feldkasten
Der 1804 erbaute Feldkasten kommt aus Erdwegen bei Grafendorf. In den
zwei Geschoßen bewahrten die Menschen Feldfrüchte und Lebensmittel
(Selchfleisch, Eier, Schmalz, etc.) auf. Die außen seitlich befestigten
Blechmarken geben Einblick in den Ab- bzw. Aufbau der Holzgebäude im
Freilichtmuseum.
Ab- und Aufbau eines Objektes:
1. Die Nummerierung der einzelnen Bauteile erfolgt von unten nach oben
2. Jede Seite erhält eine eigene Farbe
3. Zeichnen eines „Bauplanes"
4. Vorsichtiges Lösen der einzelnen Holzteile
5. Reinigen und Imprägnieren
6. Zusammensetzen des Gebäudes am neuen Standort

Seit 2021 beherbergt das Museum das wahrscheinlich kleinste Museum
Österreichs – eine Nachbildung des gesamten Museums durch einen Tiroler
Krippenbauer.

Trockenraum für den Flachs - Hoarstube Trattenbauer
Der Bauernhof Trattenbauer (Familie Glößl) brannte am Ende des 2.
Weltkrieges 1945 ab. Damals war die Stube dieses Gebäudes der einzig
bewohnbare Raum. Die Stube des Hauses aus Schachen diente als
Trockenraum für den Flachs. Durch die Hitze des Ruabnhaufenofens dörrte
der dort ausgebreitete Flachs. Derart vorbereitet, konnte er gebrechelt
und anschließend versponnen werden. Die Bäuerin wusch die zu Strähnen
gewickelten Fäden in Aschenlauge. Besaß der Bauernhof einen Webstuhl,
kam der „Störweber" ins Haus und verwob das Garn zu Hausleinen. Dieses
bleichten die Frauen auf der Wiese. Dabei begoss man es laufend mit
Wasser. Die Hausleinenstücke, der Stolz jeder Hausfrau, waren 20 m lang
und 1 m breit. Sie waren eine wertvolle Brautausstattung, wenn die
Töchter heirateten.

Das Freilichtmuseum Vorau („Museumsdorf Vorau“) in Vorau in der
Steiermark zeigt historische Bauernhäuser mit Nebengebäuden sowie
historische Gegenstände des Alltags.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: